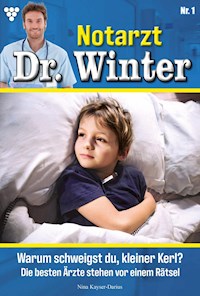Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurfürstenklinik
- Sprache: Deutsch
Mit den spannenden Arztromanen um die "Kurfürstenklinik" präsentiert sich eine neue Serie der Extraklasse! Diese Romane sind erfrischend modern geschrieben, abwechslungsreich gehalten und dabei warmherzig und ergreifend erzählt. Die "Kurfürstenklinik" ist eine Arztromanserie, die das gewisse Etwas hat und medizinisch in jeder Hinsicht seriös recherchiert ist. Nina Kayser-Darius ist eine besonders erfolgreiche Schriftstellerin für das Genre Arztroman, das in der Klinik angesiedelt ist. 100 populäre Titel über die Kurfürstenklinik sprechen für sich. »Ach, hier sind Sie!« sagte Dr. Volker Gebert in jenem gedehnten, spöttischen Tonfall, den er speziell für Frauen reserviert zu haben schien – in diesem Fall handelte es sich um die Röntgenärztin Dr. Cordula Niendorf. Dr. Gebert arbeitete, wie Cordula, noch nicht sehr lange an der Kurfürsten-Klinik in Berlin-Charlottenburg, aber immerhin drei Monate länger als sie. Er war Oberarzt in der Röntgenologie geworden und damit ihr Chef. Vom ersten Tag an hatte er ihr und ihren Kolleginnen das Leben schwer gemacht – ihr jedoch ganz besonders, und das bildete sie sich bestimmt nicht ein. »Ja, hier bin ich«, erwiderte sie mit erzwungener Ruhe. Wie oft schon hatte sie sich geschworen, sich von diesem arroganten Menschen nicht provozieren zu lassen! Aber es gelang ihr zu ihrem größten Ärger nicht immer. Sie war nun einmal sehr temperamentvoll, mit ihr gingen, wie ihr Vater immer sagte, öfter mal die Gäule durch. »Ich mache Pause.« »Das sehe ich.« Falls das überhaupt möglich war, wurde seine Stimme noch spöttischer. »Frau Dr. Niendorf macht Pause, während alle anderen nicht wissen, wohin vor lauter Arbeit. Lassen Sie es sich gut schmecken! Wir machen die Arbeit, die Sie liegengelassen haben, gern für Sie mit!«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurfürstenklinik – 88–
Röntgenärztin Dr. Courdula N.
… steht vor ihrer bisher schwersten Bewährungsprobe
Nina Kayser-Darius
»Ach, hier sind Sie!« sagte Dr. Volker Gebert in jenem gedehnten, spöttischen Tonfall, den er speziell für Frauen reserviert zu haben schien – in diesem Fall handelte es sich um die Röntgenärztin Dr. Cordula Niendorf. Dr. Gebert arbeitete, wie Cordula, noch nicht sehr lange an der Kurfürsten-Klinik in Berlin-Charlottenburg, aber immerhin drei Monate länger als sie. Er war Oberarzt in der Röntgenologie geworden und damit ihr Chef. Vom ersten Tag an hatte er ihr und ihren Kolleginnen das Leben schwer gemacht – ihr jedoch ganz besonders, und das bildete sie sich bestimmt nicht ein.
»Ja, hier bin ich«, erwiderte sie mit erzwungener Ruhe. Wie oft schon hatte sie sich geschworen, sich von diesem arroganten Menschen nicht provozieren zu lassen! Aber es gelang ihr zu ihrem größten Ärger nicht immer. Sie war nun einmal sehr temperamentvoll, mit ihr gingen, wie ihr Vater immer sagte, öfter mal die Gäule durch. »Ich mache Pause.«
»Das sehe ich.« Falls das überhaupt möglich war, wurde seine Stimme noch spöttischer. »Frau Dr. Niendorf macht Pause, während alle anderen nicht wissen, wohin vor lauter Arbeit. Lassen Sie es sich gut schmecken! Wir machen die Arbeit, die Sie liegengelassen haben, gern für Sie mit!«
Es war ungerecht, was er sagte, und er wußte das natürlich ganz genau. Alle anderen hatten ihre Pause längst hinter sich, nur Cordula war bisher nicht dazu gekommen. Sie hatten in der Tat ungeheuer viel zu tun gehabt, es war fast wie Fließbandarbeit gewesen, was die Röntgenologie an diesem Vormittag hatte leisten müssen. Zum Glück kam es nicht allzu oft vor, daß es so hektisch und stressig war. Jedenfalls hatte Cordula seit ihrem Dienstbeginn am frühen Morgen noch keine fünf Minuten Pause gehabt, und jetzt mußte sie wenigstens etwas trinken und ein halbes Brötchen essen, denn ihr war schon schwindelig vor Hunger.
Bevor Cordula darauf hinweisen konnte, daß alle anderen ihre Pause bereits gehabt hatten, erschien ein weiterer Kollege in der Tür, Dr. Ferdinand Branitzky. Cordula wußte nicht, wen sie schlimmer fand, ihn oder Volker Gebert. Ferdinand Branitzky war ein schwacher Mensch, der sich immer der Meinung desjenigen anschloß, der gerade am meisten zu sagen hatte. Sie fand ihn ekelhaft, während Volker Gebert eher ihren Zorn erregte.
»Die Frau Doktor genehmigt sich eine Pause, Ferdi«, sagte Dr. Gebert höhnisch. »Komm, wir wollen sie nicht länger stören, sonst bekommt sie vielleicht noch etwas in den falschen Hals.« Ferdinand Branitzky brauchte einen Moment, bis er den dummen Witz verstanden hatte, dann stimmte er in das Gelächter seines neuen Chefs ein.
Sie schlossen die Tür hinter sich, und Cordula mußte erst einmal tief durchatmen. Wenn sie nur gewußt hätte, warum dieser gräßliche Mensch sie derartig verfolgte! Sie hatte ihm überhaupt nichts getan, aber anscheinend reichte allein ihr Anblick, um ihn gegen sie aufzubringen.
Sie zwang sich dazu, ihr halbes Brötchen aufzuessen, obwohl ihr schlagartig der Appetit vergangen war. Volker Gebert hatte es bei anderer Gelegenheit schon geschafft, ihr so zuzusetzen, daß ihr die Tränen gekommen waren – das war eine ungeheure Demütigung für sie gewesen. Zumindest so weit war es heute nicht gekommen. Mit diesem Gedanken versuchte sie, sich irgendwie zu trösten.
Ihr war das Gerücht zu Ohren gekommen, daß er seine Oberarzt-Stelle an der renommierten Kurfürsten-Klinik einflußreichen Gönnern zu verdanken hatte – aber das konnte stimmen oder auch nicht. Er blieb eine Plage, der Dr. Gebert, und sie würde sich, wenn sich an der jetzigen Situation nichts änderte, über kurz oder lang nach einer neuen Stelle umsehen müssen.
Doch bevor sie das tat, würde sie um ein Gespräch mit dem Verwaltungsdirektor der Klinik, Thomas Laufenberg, bitten. Er war ein sehr ruhiger, sympathischer Mann, der sich für sie stark gemacht hatte, wie sie mittlerweile wußte. Vielleicht konnte er ihr einen Rat geben. Immerhin war es denkbar, daß sie sich falsch verhielt und ihren neuen Chef irgendwie reizte. Aber eigentlich glaubte sie das nicht. Dr. Volker Gebert gehörte zu den Menschen, die ihre Frustrationen gern an anderen ausließen – vorzugsweise an denen, die sie für schwächer hielten.
Sie trank ihr Wasser, schluckte den letzten Bissen und verließ den Raum, um sich wieder an die Arbeit zu machen. Zum Glück war von Dr. Gebert und Dr. Branitzky weit und breit nichts zu sehen.
*
»Ach, Papa!« maulte Jenna Körber. »Ich will nicht in diese blöde Klinik! Muß es denn ausgerechnet jetzt sein, wo ich für das Tennis-Turnier aufgestellt bin?«
»Ja, es muß jetzt sein!« stellte Johannes Körber sehr bestimmt fest. »Dr. Harmsen hat gesagt, er kommt nicht weiter, und er hat dringend angeraten, dich einmal gründlich untersuchen zu lassen. Es ist nicht normal, daß du so oft Kopfschmerzen hast und daß dir schwindelig wird. Es werden Aufnahmen von deinem Kopf gemacht, sie untersuchen dein Blut in allen Richtungen, und wer weiß, was sie noch für Untersuchungen machen. Die Kurfürsten-Klinik ist eins der besten Krankenhäuser der Welt, wenn sie dort nicht finden, was dir fehlt, dann finden sie es nirgends.«
»Vielleicht fehlt mir ja gar nichts«, sagte Jenna. »Ich will so gern bei dem Turnier mitmachen, Papa!«
»Nächstes Mal«, erwiderte Johannes.
Es tat ihm wirklich leid, seiner Tochter diesen Herzenswunsch nicht erfüllen zu können – aber auf der anderen Seite war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn er verwöhnte sie maßlos, seit seine Frau vor zwei Jahren an Brustkrebs gestorben war. Das war eine entsetzliche Zeit gewesen – vor allem natürlich für Antonia, seine Frau, aber auch für Jenna und ihn. Noch immer legte sich Trauer wie ein graues Tuch auf sein Gemüt, wenn er daran zurückdachte.
War es da ein Wunder, daß er in der Folgezeit alles getan hatte, um Jenna über den Verlust hinwegzuhelfen? Sie war zehn Jahre alt gewesen, als ihre Mutter starb, jetzt war sie zwölf. Und natürlich fehlte ihr Antonia mehr denn je. Ein Mädchen, daß sich an der Schwelle zum Frau-Sein befand, brauchte eine Mutter, die ihm in dieser schwierigen Zeit half. Er selbst versuchte sein Bestes, aber er konnte Antonia nicht ersetzen, das wußte er nur zu gut.
Außerdem hatte er nicht genug Zeit für Jenna – er war Manager in einem Medienkonzern und wenn er nicht mit seiner Tochter zusammen war, arbeitete er. Arbeit bis an den Rand der Erschöpfung war sein Rezept gegen Trauer und Depressionen.
»Du bist erst zwölf, du kannst in deinem leben noch jede Menge Turniere spielen, Jenna.«
Als er sie ansah, floß sein Herz über vor Liebe. Sie hatte die braunen wuscheligen Locken ihrer Mutter geerbt und auch deren herzförmiges, hübsches Gesicht. In einigen Jahren würde sie aussehen wie Antonia. Er stand auf und ging zu ihr. Liebevoll zog er sie an sich. »Wir wollen doch nichts riskieren, Jenna, oder? Wenn Dr. Harmsen rät, dich so schnell wie möglich in der Kurfürsten-Klinik untersuchen zu lassen, dann sollten wir auf ihn hören. Er ist schon lange unser Hausarzt, und bisher waren seine Ratschläge immer gut.«
Sie schmollte noch immer. »Aber warum gerade jetzt? Es würde doch nichts ausmachen, wenn ich ein paar Tage später gehe, Papa!«
»Du weißt doch selbst, wie das ist: Dann ist wieder etwas anders. Ein Mathe-Test, eine Englischarbeit, ein Ausflug oder was weiß ich. Der passende Zeitpunkt wird nie kommen. Ich will aber nicht, daß wir diese Untersuchung noch länger aufschieben.«
Endlich gab sie auf. »Na, gut! Aber das nächste Turnier darf ich spielen, versprich es mir!«
»Ich werde mich hüten«, sagte er lachend. »Wenn man dir den kleinen Finger gibt, nimmst du ja immer gleich die ganze Hand!«
»Ach, Papa!« Sie gab ihm einen Kuß, dann rannte sie aus dem Zimmer – wahrscheinlich, um wieder eins ihrer endlosen Telefonate mit einer ihrer Freundinnen zu führen. Was hatten Jugendliche eigentlich früher gemacht, als es noch kein Telefon gab – geschweige denn Handys?
Er sah auf die Uhr und stellte fest, daß es höchste Zeit wurde, ins Büro zurückzufahren. Wenn es irgend möglich war, aß er mit Jenna zusammen zu Mittag. Sie wurde nach der Schule von einer sehr netten Frau aus der etwas weiteren Nachbarschaft betreut, die auch kochte und das Haus in Ordnung hielt. Er konnte von Glück sagen, daß Frau Cornelsen nach Antonias Tod selbst auf ihn zugekommen war und ihm das Angebot gemacht hatte, für ihn zu arbeiten. Ihr Mann hatte sie ein Jahr zuvor verlassen und zahlte nicht für die drei Kinder. Die junge Frau schlug sich seitdem wirklich sehr mühsam durchs Leben.
»Frau Cornelsen, ich fahre dann wieder!« rief er.
Sie kam aus der Küche. »Ja, gut. Ist Jenna oben?«
Er nickte. »Sie geht übermorgen in die Kurfürsten-Klinik, wie bereits besprochen. wenn Sie ein bißchen was zum Essen vorbereiten, Frau Cornelsen, brauchen Sie in der Zeit von mir aus nicht zu kommen. Sie freuen sich sicher auch, wenn Sie mal ein bißchen mehr Zeit für Ihre Kinder haben.«
»Ach, meine Mutter betreut sie ja, wenn ich hier bin, das klappt eigentlich ganz gut. Die beiden Kleinen sind sowieso bis nachmittags im Kindergarten – nur der Große, der jetzt schon in der Schule ist, ist ab mittags zu Hause.«
»Warum bringen Sie ihn nicht mit hierher?« fragte Johannes. »Mich stört das nicht – und Jenna sicher auch nicht.«
Eva Cornelsen lächelte verlegen. Sie war eine hübsche Frau von achtundzwanzig Jahren, der man jedoch ansah, daß das Leben bisher nicht allzu freundlich mit ihr umgegangen war: Sie war zu dünn, und zwischen Mund und Nase hatten sich bereits zwei scharfe Falten gebildet. Seit sie allerdings für Johannes arbeitete, hatte sie ein wenig zugenommen und wirkte auch nicht mehr ständig abgehetzt.
»Überlegen Sie es sich«, sagte er freundlich. Dann rief er in den ersten Stock: »Tschüß, Jenna!«
»Tschüß, Papa!« tönte es zurück, doch seine Tochter ließ sich nicht blicken.
»Sie telefoniert garantiert«, seufzte er. »Ich glaube, die schlimmste Strafe wäre, wenn man ihr das Handy wegnähme.«
»Da ist sie nicht die einzige«, bemerkte Eva Cornelsen. »Heutzutage haben ja schon Sechsjährige so ein Ding. Ich finde das übertrieben.«
»Ich auch!« versicherte er, und dann verließ er endgültig das Haus. Er nahm auf der Rückbank der Limousine Platz, sein Fahrer ließ augenblicklich den Motor an. Gleich darauf rollten sie auf die Straße und waren im nächsten Moment verschwunden.
Eva schloß die Tür und kehrte in die Küche zurück. Dieser Job hatte ihr das Leben gerettet! Herr Körber wußte das vielleicht nicht, aber sie selbst war seinerzeit völlig verzweifelt gewesen. Merkwürdig, dachte sie. Er hat seine Frau verloren, das war eine große Tragödie für ihn – aber für mich war es die Rettung. Wie nahe doch Glück und Unglück beieinander liegen!
*
»Was für ein ekelhafter Kerl!« bemerkte Dr. Julia Martensen leise, als der Röntgenologe Dr. Volker Gebert mit schnellen Schritten zum Fahrstuhl lief, der ihn von der Notaufnahme wieder auf seine Station bringen sollte.
»So kenne ich dich ja gar nicht, Julia«, bemerkte Dr. Adrian Winter erstaunt.
Adrian leitete die Notaufnahme der Kurfürsten-Klinik, und die Internistin Julia Martensen gehörte, neben dem Chirurgen Bernd Schäfer, zu seinem engsten Team. Immer wieder ließen sich diese beiden zum Dienst in der Notaufnahme einteilen, weil sie die dortigen Anforderungen interessant fanden und weil sie gern mit Adrian zusammenarbeiteten. Die meisten anderen Ärzte mieden die Notaufnahme, wenn sie konnten, weil es die anstrengendsten Dienste waren, die man sich in einem Krankenhaus überhaupt vorstellen konnte. Und da die Kurfürsten-Klinik über eine sehr große Notaufnahme verfügte – die größte im weiten Umkreis –, war die Chance, dort ein paar ruhige Stunden verbringen zu können, relativ gering.
»Er hat kalte Augen«, stellte sie fest, »und immer tut er so, als sei er der einzige Röntgenologe hier, der von seinem Fach etwas versteht. Und wenn der Name ›Dr. Niendorf‹ fällt, verzieht er verächtlich das Gesicht. Mit Frauen scheint er sowieso Probleme zu haben.«
Bernd Schäfer, der rundliche Dritte im Bunde, hatte sich mittlerweile zu ihnen gesellt. »Wie ich höre, ist von Dr. Gebert die Rede«, stellte er fest.
»Das hast du gleich mitbekommen?« Adrian wunderte sich immer mehr. »Mir scheint, da ist mir einiges entgangen. Ich habe bisher kaum mit dem Kollegen zu tun gehabt.«
»Freu dich«, bemerkte Bernd trocken. Er schien Julias Ansicht über Dr. Gebert zu teilen. »Er ist ein bemerkenswert unsympathischer Mensch. Wie kommt es denn, daß dir das entgangen ist?«
»Na ja, ich habe schon ab und zu eine Bemerkung über ihn gehört, aber bisher hatte ich höchstens dreimal ganz kurz mit ihm zu tun – deshalb kann ich mir kein Urteil über ihn erlauben.«
»Hochmütig, intrigant, gefährlich«, faßte Bernd zusammen. »Ehrlich gesagt, ich wundere mich, daß der Mann hier eine Stelle bekommen hat. Sonst wird doch immer so viel Wert darauf gelegt, daß in der Kurfürsten-Klinik nicht nur erstklassige Mediziner arbeiten, sondern daß sie auch menschlich gefestigt sind – oder wie man das ausdrücken soll.«
»Es gibt da Gerüchte«, wußte Julia. »Jemand im Verwaltungsrat soll ihn durchgesetzt haben.«
»Davon habe ich auch noch nichts gehört«, sagte Adrian. »Mir scheint, ich lebe in einer anderen Welt als ihr.«
»Nein, du sperrst nur deine Ohren zu, sobald es Klatsch und Tratsch zu hören gibt«, erwiderte Julia, »und das ist natürlich ein besonders netter Zug an dir. Bernd und ich sind da etwas anders gestrickt.« Sie zwinkerte Bernd zu. »Stimmt’s?«
Bernd grinste breit. »Stimmt. Ich höre Klatsch manchmal ganz gern. Schlimm wird es nur, wenn man die Geschichten selbst weiterträgt. Hört mal, habt ihr nicht auch Hunger? Ich brauche dringend eine kleine Stärkung.«
Seit Bernd vor wenigen Wochen einmal fast zusammengebrochen war, weil er nicht rechtzeitig etwas zu essen bekommen hatte, reagierten Julia und Adrian nicht mehr mit Spott, wenn er eine solche Bemerkung machte, sondern eher mit Sorge. »Dann sieh zu, daß du etwas in den Magen bekommst!« kommandierte Adrian. »Ich habe noch keinen Hunger.«
»Ich gehe mit, Bernd«, entschied Julia. »Einen Salat würde ich jetzt gern essen.«
»Und ich ein Schnitzel mit Bratkartoffeln«, schwärmte Bernd. »Beeil dich, Julia, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen!«