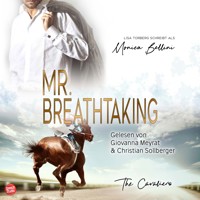3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Schneechaos wirft Emmas Pläne über den Haufen. Eigentlich will sie sich nur zu Hause in Saint Cloud vergraben und darauf warten, dass die gefühlsduselige Weihnachtszeit, die sie hasst, vorübergeht. Stattdessen muss sie die übergroßen Stofftiere für ein krankes Mädchen ausliefern, obwohl das wahrlich nicht ihr Job bei Cuddly Toys ist. Mit Einhorn und Co. macht sie sich auf den Weg in den Norden Minnesotas und einem Blizzard entgegen – und plötzlich sitzt sie im Haus des Kunden fest. Nik Hanson raubt ihr schon an der Haustür den Atem und die kleine gelähmte Annie und ihre bezaubernde Mutter spannen Emma für die Weihnachtsvorbereitungen ein. Ausgerechnet sie! Zwischen Kerzen und Keksen flirtet Nik ganz offen mit ihr und verwirrt sie immer mehr. Nach und nach erkennt Emma, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und öffnet ihr Herz. Doch der Schneesturm zieht vorbei und die Realität holt sie mit voller Wucht ein. Können Gefühle gegen widrige äußere Umstände ankommen? Ein bezaubernder Liebesroman mit Happy-End-Garantie aus dem verschneiten Midwest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Schneechaos wirft Emmas Pläne über den Haufen. Eigentlich will sie sich nur zu Hause in Saint Cloud vergraben und darauf warten, dass die gefühlsduselige Weihnachtszeit, die sie hasst, vorübergeht. Stattdessen muss sie die übergroßen Stofftiere für ein krankes Mädchen ausliefern, obwohl das wahrlich nicht ihr Job bei Cuddly Toys ist. Mit Einhorn und Co. macht sie sich auf den Weg in den Norden Minnesotas und einem Blizzard entgegen – und plötzlich sitzt sie im Haus des Kunden fest. Nik Hanson raubt ihr schon an der Haustür den Atem und die kleine gelähmte Annie und ihre bezaubernde Mutter spannen Emma für die Weihnachtsvorbereitungen ein. Ausgerechnet sie! Zwischen Kerzen und Keksen flirtet Nik ganz offen mit ihr und verwirrt sie immer mehr. Nach und nach erkennt Emma, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und öffnet ihr Herz. Doch der Schneesturm zieht vorbei und die Realität holt sie mit voller Wucht ein. Können Gefühle gegen widrige äußere Umstände ankommen?
WARNUNG: Taschentücher bereitlegen. Dieses romantische Wintermärchen aus dem Midwest enthält ein wahrhaft bezauberndes Happy End.
Inhaltsverzeichnis
Kuschel-Winter-Blizzardliebe
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Frostklirrend schockverliebt in New York
Winterliebe in Neufundland
Die Autorin
Impressum
If kisses were snowflakesI'd send you a blizzard.
Wenn Schneeflocken Küsse wären,
würde ich dir einen Blizzard schicken.
(Verfasser unbekannt)
Kapitel 1
21. DEZEMBER
»Sie sollen sofort zum Chef kommen, Miss White.«
Laut schallt die hohe Stimme durch den Raum. Erstaunt hebt Emma den Kopf – und alle anderen ebenfalls. Als ob plötzlich keine aufgeregten Kunden über die Headsets auf sie einreden und um dringende Lieferung noch vor Weihnachten – das nur noch vier Tage entfernt ist – bitten würden, verstummen sie und schauen zu Miss Rundle. Seitdem die Chefsekretärin zu Sommerbeginn ihren ausladenden Hintern auf den Stuhl in Mr Thatchers Vorzimmer platziert hat, kommuniziert sie innerhalb der Firma ausschließlich telefonisch. Morgens parkt sie ihren Wagen auf dem eigens für sie reservierten Platz unmittelbar neben dem Eingang, stolziert grußlos direkt in ihr Büro und verlässt es bis zum Abend nicht mehr. Diese Frau ist nicht nur bewegungsfaul und verfressen, sie ist mit einer gehörigen Portion Bösartigkeit gesegnet. Die steht ihr auch jetzt, neben einem schadenfrohen Grinsen, ins Gesicht geschrieben.
»Also, was ist? Brauchen Sie eine schriftliche Einladung?«
Seufzend schüttelt sie den Kopf und murmelt: »Ich komm gleich.«
»Sofort, Miss White!«
Ihr Kreischen hat dieselbe Wirkung wie Kreide auf einer Schiefertafel: Jedes einzelne Härchen auf Emmas Körper stellt sich auf. Wie schon vor ein paar Stunden, als unmittelbar nacheinander zwei Hiobsbotschaften eintrafen. Der gesamte Mittlere Westen geht im Schneechaos unter. Unzählige Flüge wurden ersatzlos gestrichen und die Räumfahrzeuge kommen kaum mehr nach, um zumindest die wichtigsten Verkehrsadern freizuhalten. Ein Lieferwagen ist von der Fahrbahn abgekommen, dabei ist die Vorderachse gebrochen, und der Fahrer hat eine Rippenprellung und eine Gehirnerschütterung. Ein anderer ist in einer Schneewechte stecken geblieben und aufgrund der schlechten Sicht ist ein anderes Fahrzeug in ihn hineingefahren. Der Chauffeur hatte sich gerade abgeschnallt und war mit voller Wucht mit dem Oberkörper gegen das Lenkrad und mit dem Kopf in die Windschutzscheibe geprallt. Zwar sind die beiden Männer zum Glück nur leicht verletzt, aber wenn sie die Ware nicht rechtzeitig an die Händler ausliefern, werden unzählige Kinder traurig vor dem Weihnachtsbaum stehen.
Das ist der Grund, weshalb Emma heute nicht in ihrem Büro hinter verschlossenen Türen sitzt, sondern hier im Großraumbüro, in dem Bestellungen angenommen und die Auslieferungen organisiert werden. Seit sieben Jahren arbeitet sie für Cuddly Toys, und vor zweieinhalb haben ihr die Thatchers die Leitung der Logistikabteilung übertragen. Genau zur rechten Zeit, damit sie sich an die Verantwortung gewöhnen und das Weihnachtsgeschäft ohne Pannen über die Bühne bekommen konnte. Und im vergangenen Jahr lief die verkaufsstärkste Saison des Stofftier-Herstellers rein organisatorisch sogar noch besser, und das, obwohl die Chefin im November einen Schlaganfall erlitten hat und alle Mitarbeiter, allen voran Emma, sehr besorgt waren. Zu Recht, denn wenige Monate später hörte Emilias Herz einfach auf zu schlagen. Und dann kam Miss Rundle ...
Jetzt schiebt Emma den Drehstuhl zurück, steht auf, zieht den weiten Pulli nach unten und umrundet den Schreibtisch. Neben Kendra, der Einzigen im Raum, die kein Headset auf dem Kopf hat, bleibt sie stehen und legt ihr eine Hand auf die Schulter.
»Nimmst du bitte meine Anrufe an? Ich warte auf einen von dem Transportunternehmen aus Minneapolis. Sobald sich die melden, während ich beim Chef bin, stell bitte sofort zu ihm durch.«
»Ja, klar«, antwortet Kendra hastig, bevor sie die Unterlippe zwischen die Zähne zieht und einen raschen Blick zur Tür wirft. Emma ist froh, dass sich ihre Kollegin einen Kommentar verbeißt, denn sie trägt das Herz auf der Zunge. Sie selbst hingegen hält ihres gut verschlossen – und auch den Mund. Mit raschen Schritten durchquert sie den Raum und schiebt sich an Miss Rundle vorbei, ohne sie anzusehen. Eilig geht sie den Gang entlang und betritt nach einem kurzen Klopfen, dem ein lautes »Herein« folgt, das Chefzimmer – und hört das laute Schnaufen des Vorzimmerdrachens hinter sich.
»Mr Thatcher«, beginnt die Frau schwer atmend. »Ich ...«
»Jetzt nicht. Schließen Sie die Tür bitte von außen, Miss Rundle, und stellen Sie keine Gespräche durch.«
Früher, als seine Frau noch lebte, hätte er Emma jetzt zugezwinkert. Denn sosehr sich die beiden geliebt haben, Emilia Thatcher war ihrem Mann gegenüber immer sehr fürsorglich und hat ihn manchmal wie ein Kind behandelt, was wohl daran lag, dass sie selbst keine hatten. Daher sagte er hin und wieder schmunzelnd zu ihr, dass sie die Tür von außen schließen sollte. Aber jetzt lächelt er nicht. Trotz des schlohweißen, dichten Haares und seiner siebzig Jahre ist Edgar Thatcher immer noch eine stattliche Erscheinung. Daran ändern auch die Falten nichts, die sich im letzten Jahr in sein Gesicht gegraben haben und die heute noch mehr sind als sonst. Er deutet auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Emma setzt sich, und wie immer gleitet ihr Blick automatisch zu dem Gold gerahmten Bild seiner Frau.
»Sie fehlt mir so sehr.« Seine leisen Worte lassen sie aufsehen. Nicht einmal verstohlen wischt er sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Sie hat immer für alles eine Lösung gehabt.«
Emmas Herz, das ohnehin schon damit zu tun hat, diesen großen, starken Mann in diesem Zustand zu sehen, poltert laut in ihrer Brust. Edgar und seine Frau Emilia waren seit dem Tag, an dem sie in den Laden stolperte und die beiden sie vom Fleck weg einstellten, wie Großeltern für sie. Eine Art Familienersatz ... Jetzt ist sie es, die sich mit der Hand über die Augen streift, die plötzlich feucht werden.
»Sag nicht, dass du zusperren willst, Edgar!«, stößt sie hervor und vergisst dabei die eiserne Regel. »Entschuldigen Sie bitte, Mr Thatcher«, schickt sie leise hintennach.
»Lass nur, Emma, wir sind allein«, erwidert er mit einer beschwichtigenden Geste. »Und nein, wenn ich das vorhätte, wüsstest du es längst.«
Erleichtert lässt sie die angehaltene Luft heraus. Es klingt, als ob jemand einen Luftballon mit einer Nadel gepikst hätte.
»Dann kann es ja nicht so schlimm sein, oder?«, fragt sie hoffnungsvoll.
»Wie man’s nimmt. Ein solches Schneechaos vier Tage vor Weihnachten ist eine mittelprächtige Katastrophe für uns.«
»Nicht einmal eine kleine«, beruhigt sie den alten Mann, lehnt sich vor und fasst nach seiner Hand. »Ich warte auf eine Zusage von dem Transporteur in Minneapolis. Wenn er die Ware von den beiden hängen gebliebenen Wagen übernimmt, geht sich alles aus.«
»Nicht alles.« Edgar schüttelt traurig den Kopf. »Da ist noch die wichtige Lieferung hinauf in den Norden, und dort kommt nur ein kleinerer Wagen durch.«
»Ich dachte, dass die Tiere schon längst beim Kunden sind!«
Verflixt! Edgar hat den Spezialauftrag vor ein paar Wochen nur beiläufig erwähnt – und dann nicht mehr.
»Die Produktion hatte ein Problem mit den Augen für das Einhorn«, brummt ihr Chef leise.
Emma zieht fragend die Augenbrauen hoch.
»Für Anfertigungen in dieser Größe haben wir nie welche vorrätig, wie du weißt, und wenn, dann nur braune Teddybärenknopfaugen, aber sicher keine blauen Einhornaugen«, erklärt er. »Irgendwie ist das bei der Materialbestellung untergegangen, und als wir es bemerkten, war es fast zu spät. Obwohl das jetzt ohnehin egal ist.«
»Sind die Tiere fertig oder nicht?« Sie drückt seine Hand fest zusammen, und endlich fokussiert er sie wieder.
»Hank und ich haben eine Nachtschicht eingelegt.«
Jetzt weiß sie, warum er so müde aussieht. »Aber dann ist doch alles okay, Edgar.« Sie lächelt ihm zu.
»Nur, wenn du mir hilfst, Snow.« Sie zuckt zusammen, entzieht ihm mit einem Ruck ihre Hand und umklammert damit die andere in ihrem Schoß.
Damals, als sie mit neunzehn hier in Saint Cloud angekommen und den Thatchers in die Arme gelaufen ist, haben sie ihr geholfen, ihren Namen ganz offiziell abzulegen. Emilia Thatcher nannte sie Emma, als sie ihr sagte, wie sehr ihr Emilia gefiel. »Du brauchst deinen eigenen Namen, nicht meinen«, hat die alte Frau erwidert. Sie war es auch, die bei den Behörden die Änderung der Dokumente beantragte und durchsetzte, dass sie fortan Emma S. White hieß.
Jetzt spürt sie Edgars Blick auf sich und sieht auf. »Schau mal aus dem Fenster, S...« Er bricht ab und verbessert sich: »Emma.«
Mit dem Kinn deutet er zum Fenster und sie schaut nach draußen. Der Sturm hat sich verzogen, und die Strahlen einer schüchternen Wintersonne bahnen sich da und dort ihren Weg zwischen riesigen Schneeflocken, die wie aufgefädelt vom Himmel fallen. Die Meteorologen scheinen recht zu behalten. Der starke Westwind schiebt das Zentrum des Tiefs immer weiter nach Osten Richtung Wisconsin und Illinois. Soll Chicago unter dem Schnee versinken und soll der Lake Michigan zufrieren – wir haben fürs Erste genug, denkt sie.
»Sieben Jahre sind eine lange Zeit, mein Kind«, sagt Edgar mit seiner warmen, brummigen Stimme. »Mehr als ein Viertel deines Lebens. Ich habe gehofft, dass du ...«
Er bricht mitten im Satz ab, als sie stirnrunzelnd »Was hast du gehofft?« fragt.
Natürlich spricht er von ihrem alten Namen und ihrer Vergangenheit, aber Edgar ist ein sensibler Mann, und so erwidert er leise: »Dass du mir hilfst, Emma.«
»Aber natürlich helfe ich dir!« Erleichtert springt sie auf, umrundet den Schreibtisch und dreht schwungvoll seinen Stuhl an der Armlehne herum. Dann beugt sie sich vor, umschlingt ihn mit ihren Armen und legt ihr Kinn auf seine Schulter. Tief atmet sie seinen vertrauten Geruch ein.
»Sag mir, was ich tun kann, und ich mache es!«
Kapitel 2
22. DEZEMBER
Der Tag könnte als perfekter Wintertag durchgehen. Die Sonne spiegelt sich im hohen Schnee beiderseits der Straße, und Emma ist froh, dass sie an die Sonnenbrille gedacht hat. Das Thermometer auf dem Armaturenbrett zeigt hier minus zehn Grad Außentemperatur an, viel kälter als gestern. Sie ist erst eine knappe Stunde unterwegs. »In die falsche Richtung«, murmelt sie, als sie das Ortsschild von Little Falls passiert. Seitdem Emilia tot ist, liebt sie Edgar mehr als sonst jemanden auf der Welt und würde alles für ihn, der viel mehr als nur ihr Chef ist, tun. Zumindest dachte sie das – bis gestern, als sie voreilig zusagte, ihm zu helfen. Aber wie hätte sie auch ahnen können, dass ausgerechnet er, der alles von ihr weiß, sie in den Norden schicken würde?
Langsam fährt sie bei Little Falls auf der US-10 weiter. Vielleicht hilft es, wenn sie ganz fest daran denkt, dass der Motor jetzt einfach seinen Geist aufgibt – doch der Wunsch erfüllt sich nicht. Edgar hat den Dodge Durango erst im Herbst letzten Jahres gekauft, um mit seiner Frau zu Silvester nach Chicago zu fahren. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen, weil Emilia krank wurde, und seither steht das Ungetüm mit dem V8-Motor und 364 PS unter der Haube fast nur in der Garage. Der Wagen riecht immer noch neu und hat nicht einmal zweitausend Meilen auf dem Tacho. Wenn sie ihn also nicht vorsätzlich in einen Graben oder gegen einen Baum fährt, wobei von beiden weit und breit nichts zu sehen ist, wird der riesige SUV sie mitsamt der wertvollen Fracht an sein Ziel bringen – ob sie will oder nicht. Links von ihr liegt Little Falls unmittelbar am nach Saint Cloud und weiter in den Süden fließenden Mississippi. Bis zum weit entfernten Meer, wo sie damals hinwollte und immer noch nicht war, weil sie einfach hängen geblieben ist.
Ein Wagen schießt mit lautem Hupen links von ihr vorbei. Emmas Blick wird von den beiden Schildern auf dem Überkopfpfeiler angezogen. Ihr rechtes Bein beginnt zu vibrieren. Das Zittern wird stärker, breitet sich von unten her aus, ergreift ihren ganzen Körper. Fest umklammert sie das Lenkrad, fährt an den Straßenrand und bremst ab. Keine dreißig Meter vor den Schildern, auf denen die beiden Alternativen für die Weiterfahrt zu sehen sind. Sie macht den Motor aus, zieht die Handbremse an und starrt auf die weiße Schrift auf grünem Grund. Wenn sie sich links hält und auf der US-10 bleibt, führt sie diese geradewegs über Motley an den Ort, den sie vor sieben Jahren verlassen hat. Cass Lake, wo sie alle Brücken hinter sich abbrach und mit ihrem ganzen Hab und Gut im Rucksack den nächstbesten Holztransport angehalten hat.
Emma fixiert das Schild und presst die Lippen zusammen. Sie löst eine Hand vom Lenkrad, nimmt die Brille ab und wischt sich über die tränenden Augen. Den Blick nach oben vermeidend schiebt sie die Sonnenbrille wieder auf die Nase und löst die Handbremse. Sie stellt die Automatik auf Drive und nimmt die MN-371 Richtung Breinerd. Behutsam senkt sie den immer noch leicht bebenden Fuß auf das Gaspedal und erhöht die Geschwindigkeit. Dabei wirft sie einen Blick in den Rückspiegel und schaut geradewegs in die strahlend blauen Augen des Einhorns. Wie die anderen beiden großen Stofftiere ist es in starker, transparenter Plastikfolie verpackt. Sie weiß, dass es nicht atmen kann und nur ein lebloser Körper ist, und doch hat sie das Gefühl, dass ihr dieses Fabeltier dafür dankt, dass sie nicht einfach umgekehrt ist.
Aber wie könnte sie? Nicht nur Edgars wegen, dem sie so viel schuldig ist, dass ein ganzes Leben nicht dafür reichen würde, ihm für all das Gute zu danken, das er und seine Frau für sie getan haben. Nein! Emma drückt die Sohle ihres Stiefels noch fester auf das Pedal und spürt, wie der schwere Wagen kraftvoll anzieht. Sie muss so rasch wie möglich nach Deer River gelangen. »Das Kind leidet an einer unheilbaren Krankheit, und es ist nicht absehbar, wie viele Weihnachten noch vor ihr liegen, hat Mr Hanson gesagt. Deshalb will er Annie jeden Wunsch erfüllen, solange es möglich ist.« Edgars Worte, als er ihr von dem letzten Anruf des Kunden mit dem Spezialauftrag erzählte, hallen in Emmas Kopf nach, während sie sich immer weiter von Little Falls entfernt. Nur eines zählt jetzt: ihre Mission, egal, wie nahe sie dabei ihrer Vergangenheit kommen mag. Sie muss rechtzeitig ans Ziel kommen, um einem liebenden Vater dabei zu helfen, sein schwerkrankes Kind glücklich zu machen. Sie schließt ihre Finger fester um das Lenkrad und erhöht die Geschwindigkeit auf achtzig Meilen.
Die Straße verläuft rechts von dem mäandernden Mississippi, der sich immer wieder in mehrere Arme teilt und manchmal zu kleinen Seen verbreitert und dessen Wasseroberfläche hinter der im Sonnenlicht gleißenden Schneeflächen hervorblitzt. Die Räumfahrzeuge haben gute Arbeit geleistet, sodass Emma auf ihrem Weg nach Norden zügig vorankommt. Die Schnellstraße endet an der Ortstafel von Breinerd. Sie durchfährt das Ortsgebiet, dann weiter auf der MN-210. In Crosby, einem kleinen, trostlosen Ort, folgt sie den Wegweisern auf die MN-6, die exakt nach Norden führt. Irgendwann nimmt sie die Sonnenbrille ab, weil die Sonne hinter den Wolken verschwindet, die wie Wattebäusche am Himmel hängen. Ihr Blick schweift immer wieder rechts und links aus den Seitenfenstern über die Landschaft, und plötzlich ist es wieder da, dieses unangenehme Prickeln, das jeden einzelnen ihrer Nerven bis ans Ende durchläuft und ihren Körper zum Zittern bringt. Sie ist etwa fünfzig Meilen nordöstlich von hier aufgewachsen, und die Landschaft ist der rund um Cass Lake so ähnlich, dass sie das Radio anmacht und auf volle Lautstärke stellt, um gegen die Flashbacks anzukämpfen. Serpent Lake, Roosevelt Lake, Thunder Lake. Unzählige Seen wechseln sich mit Wäldern ab. Eine Tafel weist sie darauf hin, dass sie sich ab hier nicht nur im Chippewa National Forest, sondern in der Leech Lake Indian Reservation befindet, dem Reservat, in dem sie geboren wurde und aufgewachsen ist. Als ob sie dafür einen Hinweis gebraucht hätte! Ihre Unruhe steigt. Fast übersieht sie die Geschwindigkeitsbeschränkung und die Steinmauer mit der roten Aufschrift »Remer Welcomes You!«. Daneben ein Schild, das darauf hinweist, das der kleine Ort Bigfoots Heimat ist.
Emma bremst abrupt ab und hält vor einer mit Holz und Steinen getäfelten Fassade mit der Stoßstange in einem mit Rußpartikeln bedeckten Schneehaufen. The Woodsman Cafe steht über die gesamte Breite des Hauses geschrieben. Menschen, deren Gesichter dem ihren nicht unähnlich sind, schauen neugierig durch die breite Fensterfront nach draußen. Emma ist klar, dass der mittlerweile mit Schlammspritzern übersäte Dodge Durango nicht der Grund dafür ist. Fahrzeuge mit Allradantrieb, auch teure wie dieses, sind hier im Land der Seen unweit der kanadischen Grenze nicht unüblich. Das Interesse gilt ihr allein. Sie könnte den Gurt wieder anlegen und weiterfahren – stattdessen strafft sie die Schultern und schnappt sich den Parka vom Beifahrersitz, als sie aussteigt. Sie zieht die Daunenjacke über und wirft die Tür zu. Kleine Atemwölkchen steigen in der kalten Luft vor ihrem Gesicht auf. Ohne durch die Scheiben nach drinnen zu sehen, geht sie auf die hölzerne Tür des Lokals zu und tritt ein. Die Atmosphäre ist in dem holzgetäfelten Ambiente noch eisiger als die Außentemperatur. Alle Anwesenden starren sie an – und keiner sagt ein Wort.
Sofort fühlt sie sich sieben Jahre zurückversetzt – nur war damals sie auf der anderen Seite. Heute fühlt sie sich wie ein Fremdkörper, als ob die Gene ihrer weißen Mutter die ihres Vaters ausgelöscht hätten. Die Ojibwe sind die größte einheimische Bevölkerungsgruppe der Ureinwohner Nordamerikas. Mehr als dreihunderttausend Menschen des Volkes, das der Kulturgruppe Anishinaabe angehört, leben beiderseits der Grenze in Kanada und den USA. Doch wie alle Native Americans wurden auch ihre Vorfahren von den weißen Eroberern bekämpft, verfolgt und in Reservate verbannt, in denen heute jedoch nur noch ein geringer Teil von ihnen lebt. Doch diejenigen, die ihre Familien so wie hier in der Leech Lake Indian Reservation gründen, zusammenhalten und sich für die Erhaltung der Traditionen einsetzen, haben nichts von ihrer Ursprünglichkeit verloren. Es ist also kein Wunder, dass sich Vorsicht und Argwohn mit der DNA weitervererbt haben. Emma ist zwar nur zur Hälfte Ojibwe und obwohl ihre Haut weißer ist als die ihres Vaters, weisen ihre Physiognomie und die schwarzen, glatten Haare eindeutig auf ihre Herkunft hin.
Die Menschen hier wissen, dass sie eine von ihnen ist! Plötzlich fällt all die Anspannung, die sich während der Fahrt aufgebaut hat, von ihr ab. Mit neben dem Körper herabhängenden Armen und dem geöffneten Parka blickt sie in die Runde, beugt leicht den Kopf und sagt »Aniin.« Der informale Gruß, den die Angehörigen eines jeden der weit über hundert Stämme der Ojibwe verstehen, wird rundum teils gemurmelt, teils mit einem Lächeln erwidert – auch von denjenigen, die eindeutig keine indianischen Wurzeln haben. Bei den beiden handelt es sich um das Ehepaar, das The Woodsman Cafe seit einigen Jahren führt, wie sie kurz darauf erfährt.
»Ich habe Sie hier noch nie gesehen.« Die Frau stellt eine Tasse mit dampfendem, aromatischem Tee vor ihr ab.
»Ich komme aus Saint Cloud«, erwidert Emma.
»Aus der Großstadt«, sagt jemand am Nebentisch.
Zwar würde Emma Saint Cloud mit seinen achtzigtausend Einwohnern wahrlich nicht als solche bezeichnen, doch sie nickt. Sie hebt das Heißgetränk an die Lippen und trinkt einen weiteren Schluck. Der intensive Blick des Mannes mit den hellen Augen und dem faltigen Gesicht irritiert sie. Sie senkt den Kopf.
Sie würde jetzt das Handy aus der Tasche ziehen und so geschäftig tun, wie sie es bei anderen immer sieht. Aber ihres ist in den Tiefen ihrer Tasche vergraben, die sie unter den Beifahrersitz geschoben hat, bevor sie wegfuhr. Die privaten Nummern, die sie darauf gespeichert hat, sind zwei: die von Edgar Thatcher und die von ihrer Kollegin Kendra, die zehn Jahre älter als sie selbst und verheiratet ist und zwei Kinder hat. »Man weiß ja nie im Leben«, hat sie gesagt, als Emilia und Edgar ihr das Smartphone vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt haben. Seither haben sie sich ein einziges Mal gehört, als Kendras Mann einen Unfall hatte und sie um sechs Uhr am Morgen aus dem Krankenhaus angerufen hat, weil sie nicht zur Arbeit kommen konnte. Um ehrlich zu sein, verwendet Emma das Handy nur, wenn sie privat auf einem Amt oder beim Arzt wegen eines Termins anrufen muss – oder um eine Pizza zu bestellen. Apps sind für sie reine Theorie, und mit Edgar Nachrichten zu tauschen, fiele weder ihm noch ihr im Traum ein – sie sehen sich ohnehin jeden Tag. Sie weiß auch nur, dass es heute voll aufgeladen ist, weil sie es gestern am Abend an das Ladekabel gehängt hat. Die Ablenkungstaktik würde also auch dann nicht funktionieren, wenn sie das Teil mit ins Lokal genommen hätte.
Die Besitzerin des Lokals schaut von dem Gast mit den langen Haaren, die mit silbrigen Fäden durchzogen sind und seine bronzefarbene Haut noch dunkler wirken lassen, wieder zu ihr.
»Und was bringt Sie im Winter zu uns? Urlauber treiben sich hier nur in der warmen Jahreszeit herum, und drei Tage vor Weihnachten denkt doch jeder ausschließlich ...«
»Eine Lieferung«, unterbricht Emma den Redeschwall der blonden Frau.
»Muss ja was Wichtiges sein.« Die Neugierde steht der Wirtin ins Gesicht geschrieben. Typisch Weiße, denkt Emma und wundert sich im selben Moment, dass sie es tut. In der Stadt würde es eher auffallen, wenn jemand eine solche Frage nicht stellen würde, und längst hat sie aufgehört, sich selbst als Indianerin zu sehen. Aber hier ...
»Ein Weihnachtsgeschenk«, murmelt sie, kippt den Rest vom Tee und zieht zwei Dollarscheine aus der Tasche und legt sie auf den Tisch. Nur weg von hier, bevor die Frau sie noch nach dem Empfänger fragt und der alte Mann sie weiterhin anstarrt.
Froh, dass sie den Parka nicht ausgezogen hat, steht sie auf, murmelt einen Dank und geht zur Tür. Den Gang auf die Toilette vermeidet sie bewusst und tritt nach draußen. Und dann hört sie, wie der Ojibwe vom Nebentisch, der ungefähr so alt sein muss, wie ihr Vater jetzt wäre, spricht.
»Die Kleine ist nicht aus der Stadt. Ich erinnere mich an ihr Gesicht, aber nicht an ihren Namen ...«
Zum Glück, denkt Emma, als die hölzerne Tür hinter ihr zufällt. Sie betätigt den Funkschlüssel, steigt in den Wagen, startet und drückt zugleich das Gaspedal durch. Die rechten Räder des Dodge rumpeln über den Schneehaufen und eine Fontäne aus Schnee und Schmutz spritzt hinter dem Wagen auf. Das anhaltende Piepsen, da sie sich nicht angeschnallt hat, dröhnt in ihren Ohren. Doch erst als sie die Ortsausfahrt hinter sich gelassen hat, hält Emma an. Ohne auszusteigen, schält sie sich umständlich aus dem Parka, wirft ihn auf den Beifahrersitz und legt den Sicherheitsgurt an. Das Navi zeigt eine Fahrzeit von fünfunddreißig Minuten bis Deer River an. Vom Ort sind es noch etwa fünfzehn Minuten bis zu dem Haus des Kunden irgendwo im Wald, hat Edgar die Worte des Mannes wiederholt.
Selbst wenn sie sich eine Stunde bei den Hansons aufhalten sollte, womit sie aber nicht rechnet, wird sie am frühen Abend wieder zu Hause sein und diesen Abstecher in die Vergangenheit vergessen. Mit einem Blick in den Himmel, wo die weißen Wattebäusche von riesigen grauen Wolken, die miteinander Fangen spielen, ersetzt wurden, drückt sie das Gaspedal nach unten.
Je näher sie dem Ort am Ostrand des Reservats kommt, umso dunkler wird der Himmel. Die blattlosen Äste der Laubbäume und die der immergrünen Kiefern bewegen sich im aufkommenden Wind. Die Temperatur ist in der letzten halben Stunde stark angestiegen. Als die Ortstafel von Deer River in Sicht kommt, zeigt die Anzeige auf dem Armaturenbrett null Grad an. Emma verringert die Geschwindigkeit – und die Erinnerung trifft sie mit voller Wucht.
Sofort muss sie an ihren Heimatort Cass Lake denken. Es gibt ein Motel, an einer Fassade sieht sie die Aufschrift »Jesus Loves You!«, gegenüber einen Drugstore und ein Stück weiter einen Minimarket. Ein Schild mit einem Pfeil preist einen Golfclub an, und sie fragt sich, wer in ein Naturreservat kommt, um zu golfen, wo es doch hier so vieles gibt, was man kaum anderswo tun kann. Doch dann lenken sie die wenigen Menschen beiderseits der schnurgeraden Straße ab, die stehen bleiben und ihr unverhohlen nachblicken. Hier im Reservat hat sich nichts geändert: Immer noch starrt man Fremden nach, die sich außerhalb der Urlaubssaison hierherverirren.
Die Häuserzeilen beiderseits der Straße enden und ein paar Hundert Meter weiter sieht Emma rechts ein riesiges rostbraunes Gebäude mit der Aufschrift White Oak Casino. Kopfschüttelnd starrt sie auf die Fahnenstangen vor dem Eingang, an denen bunte Flaggen wehen, und die unzähligen Autos auf dem Parkplatz. Deer River bietet wahrlich allen etwas: den Touristen Natur und Golf, den Einheimischen das Glücksspiel in Kombination mit Alkohol.
Ihr Magen ballt sich krampfartig zusammen und plötzlich sieht sie das zerfurchte Gesicht ihres Vaters vor sich. Sie bremst ab und trotz des Allradantriebs schlittert der Dodge auf der schneeglatten Fahrbahn. Mit bebenden Fingern greift sie nach der kleinen Plastikflasche, öffnet sie und trinkt gierig den Rest des Wassers. Als sie den Verschluss wieder draufmachen will, fällt er in den Fahrzeugraum zu ihren Füßen. Sie schnallt sich ab, sucht ihn tastend, findet ihn, schließt die Flasche. Emma atmet tief ein und starrt geradeaus, um den Blick auf das Gebäude zu vermeiden.
Ihr Puls verlangsamt sich, und endlich fällt ihr wieder ein, weshalb sie hier ist. Der auf dem Navi eingegebene Zielort Deer River liegt längst hinter ihr. Sie greift nach dem Zettel in der Ablage neben dem Schalthebel und liest Edgars Angaben. Hier hilft das Navi nichts mehr, denn zwischen Wäldern und Seen haben Straßen keine Namen, sondern nur die offiziellen Nummern. Doch eines ist klar: Sie ist zu weit gefahren. Emma löst die Handbremse, schaltet auf Rückwärtsgang und biegt wenige Minuten später in die Straße ein, die am Ball Club Lake vorbei zum Lake Winnibigoshish führt. Etwa hundert Meter vor dem See, dessen Name in Ojibwe brackiges Wasser bedeutet, sollte sie rechts einen schmalen Weg und ein Holzschild mit dem Namen des Kunden sehen. Und genau so ist es.
Trotz des Sturms, in den sich der Wind mittlerweile verwandelt hat, und der durch die vom Boden aufwirbelnden Schneekristalle schlechte Sicht ist die große Tafel unübersehbar. Emma setzt den Blinker – und fährt zusammen. Ein Lieferwagen kommt hupend aus dem Wald gefahren. Sie setzt zurück. Der Fahrer des Fahrzeugs, dessen Außenspiegel fast die Bäume beiderseits des Weges berühren, tippt sich an die Mütze. Er fährt in einem großen Bogen an ihr vorbei und nimmt die Straße nach Deer River. Auf dem rot lackierten Wagen liest sie den Namen, der im selben Schriftzug auch auf der Holztafel am Straßenrand steht: Hanson. Ihr Kunde, der auf die eigens für ihn angefertigten Stofftiere wartet, scheint hier nicht nur zu leben, sondern auch zu arbeiten.
Ihre Vermutung bestätigt sich, als sie fünf Minuten später zwischen dem dichten Baumbestand auf eine Lichtung kommt, an der mehrere große aus Stein und Holz gebaute Häuser stehen. Sie erkennt, dass es drei sein müssen, da jedes von ihnen ein eigenes Dach hat. Leicht versetzt stehen sie so nah nebeneinander, dass sie wohl miteinander verbunden sind. Über der breiten Tür des rechten Gebäudes ist ein Schild mit dem Namen Hanson in demselben Schriftzug angebracht, den sie bereits vorhin auf dem Lieferwagen und der Tafel am Beginn der schmalen Straße gesehen hat. Emma hält an und macht den Motor aus. Aus einem hohen steinernen Kamin steigt Rauch auf, den der Wind genau in ihre Richtung bläst.
Kapitel 3
Fröstelnd greift sie nach dem Parka, öffnet die Tür, schwenkt die Beine aus dem Wagen und richtet sich auf – als ein lauter Knall ertönt. Sie zuckt zusammen. Ein zweiter Donnerschlag, dessen Echo sich mehrfach fortsetzt, lässt sie Halt suchend nach dem Rahmen der Fahrzeugtür greifen. Plötzlich zuckt ein Blitz über den Himmel – und dann öffnen sich die Schleusen. Aus dem Nichts prasseln Hagelkörner auf sie herab. Reflexartig hält sie die Hände über den Kopf, anstatt wieder einzusteigen. Der Parka fällt zu Boden. Aus dem Augenwinkel sieht sie eine große Gestalt auf sie zulaufen. »Kommen Sie!« Eine Hand packt sie fest am Oberarm und dirigiert sie eilig zu dem mittleren Haus. Im Eingang steht eine wunderschöne Frau ungefähr in ihrem Alter.
»Sie müssen Miss White sein und ich bin Aki Hanson«, sagt sie, streckt ihr die Hände entgegen und zieht sie nach drinnen.
»Emma«, erwidert sie schwer atmend und streicht sich über die klitschnassen Haare.
»Ich bin Nikolas Hanson, Nikolas nur mit K.«
Erst jetzt fällt ihr wieder der Mann ein, der sie ins Haus gebracht hat. Das ebenmäßige, strahlende Gesicht der Indianerin hat sie abgelenkt. Ruckartig wendet sie den Kopf – und sieht einen muskulösen Hals und breite Schultern, die von einem blau-braun karierten Hemd bedeckt sind.
Emma schaut auf – und erstarrt.
Er verschlägt ihr den Atem. Aus seinem dunkelblonden Haar tropft Wasser, rinnt über seine Stirn, verfängt sich in den geschwungenen Augenbrauen oberhalb der braun gesprenkelten Augen. Seine schmale Nase ist gerade mal so breit, dass sie nicht weiblich wirkt. Wobei er in Wahrheit absolut gar nichts Weiches an sich hat. Seine markanten Gesichtszüge und das Kinn, das von kurzen, bis über die Wangen reichenden Bartstoppeln übersät ist, sind von unbeschreiblicher Perfektion. Mr Hanson stellt die Schönheit seiner Frau in den Schatten. Noch nie hat Emma einen Mann gesehen, der so attraktiv ist, dass es verboten sein müsste. Ein warmes Kribbeln breitet sich von ihrem Bauch in jede Richtung aus und schickt einen Schauer durch ihren Körper, der sie zittern lässt.
»Sie Arme!«, ruft Aki Hanson plötzlich aus. »Wenn Sie nur ein paar Minuten früher gekommen wären ...« Plötzlich scheint ihr etwas einzufallen. Sie dreht sich um und kommt kurz darauf mit einem Handtuch wieder, das sie ihr in die Hand drückt. »Trocknen Sie sich erst einmal die Haare ab, und dann zeige ich Ihnen das Badezimmer, damit Sie sich föhnen können.«
»Das ist doch nicht notwendig.« Emma hat keine Ahnung, woher die Antwort kommt, denn ihr Hirn ist wie leer gefegt. Ihr Blick ist immer noch mit dem des Mannes verbunden, der sie genauso unverwandt anstarrt wie sie ihn. Bis ein Windstoß durch die nach wie vor offen stehende Tür weht. Nikolas Hanson blinzelt. Er wendet den Kopf, um nach draußen zu sehen.
»Ich fahre Ihren Wagen in die Garage, damit er trocknen kann.« Seine dunkle Stimme dringt zu ihr durch.
»Trocknen?«
»Die Tür steht offen.«
Irritiert schaut sie nach draußen. »Mein Parka!«, sagt sie mit einem Blick auf das dunkle Stoffbündel, das neben dem Dodge liegt.
»Den bringe ich rein und wir geben ihn in den Trockner. Steckt der Schlüssel?«
Ein Mann, der von einem Wäschetrockner spricht, als ob er ihn täglich nutzen würde, ist ihr noch nie untergekommen. Überhaupt ...
»Der Schlüssel?« Als er sie an ihrem Arm berührt, zuckt sie zusammen – und er zieht seine Hand zurück, als ob er sich verbrannt hätte.
»Steckt«, flüstert Emma.
Die nachfolgende Viertelstunde fehlt ihr einfach.
Ihr Körper scheint wie ein Automat Dinge verrichtet zu haben, an die sie sich nicht erinnert. Das wird ihr bewusst, als sie in einem trockenen Pulli und einer Jeans von Aki Hanson am Esstisch in der in hellem Holz gehaltenen Wohnküche sitzt und Honig in dem aromatisch duftenden heißen Tee verrührt. Ungläubig schaut sie in das Gesicht der Frau mit den ausgeprägten indianischen Gesichtszügen und der milchkaffeefarbenen Haut, die ihr freundlich zulächelt – bis ein Geräusch sie beide den Blick abwenden lässt.
Emma dreht den Kopf und sieht Nikolas Hanson, der aus dem Flur durch den Rundbogen kommt. Seine Hände umfassen die Armgriffe eines Rollstuhls, in dem ein Mädchen sitzt.
Sie hat die grünen Augen ihrer Mutter und die blonden Haare ihres Vaters, die ihr Gesicht lockig umrahmen. Ihre Haut ist sehr hell und der Körper mager. Die Armgelenke und die Hände, die auf einer Decke liegen, die ihre Beine bedeckt, sind schmal – und sie ist von überirdischer Schönheit. Wie ein Engel, denkt Emma. Auf dem Gesicht der Kleinen liegt ein bezauberndes Lächeln, als sie nun aus eigener Kraft den Stuhl mit einem Finger auf einem Mousepad bewegt und auf Emma zukommt.
»Ich bin Annie Hanson. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe, aber es fällt mir im Moment schwer, den Arm anzuheben, weil ich SMA habe.«
Sie hat keine Ahnung, was diese SMA ist, aber ihr Herz fliegt dem offenbar gelähmten Mädchen augenblicklich zu. Die Kleine spricht wie eine Erwachsene. Wie von selbst sinkt Emma auf die Knie und bedeckt Annies Hände mit ihren. Bei der Berührung der seidenweichen Haut spürt sie eine unerklärliche Verbindung mit dem Kind, und ein Strahl Wärme breitet sich in ihrer Brust aus.
»Ich bin Emma White und freue mich, dich kennenzulernen.«
»Ganz meinerseits«, erwidert das Mädchen ernsthaft.
»Nenn mich bitte Emma.«
Annie studiert sie mit leicht seitlich geneigtem Kopf nachdenklich. Dann öffnet sie den Mund, und stellt ihr eine Frage, die sie komplett aus der Bahn wirft.
»Sagst du mir bitte deinen richtigen Namen? Ich will dich nicht mit einem ansprechen, der nicht zu dir passt.«
Emmas Mundwinkel zucken und ihre Lippen beben leicht. Und dann spricht sie ihn aus: ihren Namen, den sie vor sieben Jahren mitsamt ihrer Vergangenheit in Cass Lake zurückgelassen hat.
»Snow. Ich heiße Snow White.«
»Schneeweißchen, wie die Schwester von Rosenrot?«
Emma schüttelt den Kopf. »Meine Mutter dachte an Schneewittchen, als sie mir meinen Namen gab, hat mir mein Vater erzählt.«
Annie nickt entschieden. »Du siehst genau so aus, wie Snow White im Märchen beschrieben wird. Deine Haut ist hell, die Haare sind dunkel und deine Wangen sind rot. Deine Mutter war eine kluge Frau, Snow.«
Kapitel 4
Nik folgt fassungslos dem Wortwechsel zwischen Annie und dieser Frau, die ihn in ihren Bann gezogen hat, seit sie aus dem Wagen stieg. Der Fahrer des Transporters, der mit der letzten Ladung vor Weihnachten wenige Minuten zuvor abgefahren ist, hat ihn angefunkt und ihm ihre Ankunft mitgeteilt. Kurz zuvor hatten sie gemeinsam besorgt die dunklen Wolken betrachtet, die sich im Himmel zu Türmen aufbauten, dann unter der Gewalt des Windes in sich zusammenbrachen und weiterzogen, um anderen Platz zu machen. Jede Formation wirkte noch bedrohlicher als die vorangegangene, und der plötzlich aufgekommene Wind verstärkte sich zusehends. Er hatte sich an das Fenster neben der Eingangstür gestellt, und nach draußen gesehen, bis der Dodge Durango, dessen weiße Lackierung unter einer schmutzignassen Schicht nur noch zu erahnen war, gehalten hatte. Und dann war die Fahrertür aufgeschwungen.
Er kann sich nicht erinnern, jemals eine Frau von derartiger Anmut gesehen zu haben – trotz der gefütterten Stiefel mit dem Pelzbesatz, in denen ihre engen Jeans steckten. Solche, die ihre schlanken Beine umschlossen wie eine zweite Haut, was er mehr vermutete als sehen konnte, da der weite Pulli sie bis zum halben Oberschenkel bedeckte. Immer noch war er bewegungslos in die Betrachtung der Frau vertieft, als der Himmel unerwartet mit Donner und Blitz seine Schleusen öffnete und walnussgroße Hagelkörner zur Erde schickte. Nik hat instinktiv reagiert, die Eingangstür aufgerissen und war auf sie zugelaufen, um sie in Sicherheit zu bringen. Dass er sie nicht in die Arme genommen hat, war nur der Tatsache zu verdanken, dass er in all den Jahren hier heroben in der Wildnis den physischen Kontakt zu anderen Menschen verlernt hat. Bis auf Aki und Annie berührt er nie jemanden – schon gar keine Frauen. Ein Handschlag zwischen Männern, um ein Geschäft abzuschließen oder einem Mitarbeiter zu danken, ist das höchste aller Gefühle.
Doch jetzt ertappt er sich dabei, dass er sich am liebsten neben diese atemberaubend nach Winter und Honig duftende Frau auf den Boden knien will. Annie, die mit nur fünf Jahren den plötzlichen Tod ihres Vaters zu verkraften hatte, nachdem ein knappes Jahr zuvor die ersten Symptome ihrer Krankheit aufgetreten waren, scheint Emma Snow White genauso anziehend zu finden wie er selbst. Und Aki ... Er spürt ihren Blick auf sich und dreht den Kopf. Ihre Gesichtszüge wirken wie immer, wenn ihre Tochter in der Nähe ist: entspannt und zuversichtlich. Doch jetzt liegt in ihren Augen noch etwas, was er unschwer deuten kann: Erstaunen. Sie zeigt ihm das, was er fühlt – für diese Frau, die immer noch am Boden kniet und Annies Hände hält und sie fragend ansieht.
»Kannst du mir erklären, was SMA ist? Ich habe noch nie davon gehört.«
Annie runzelt die Stirn, was etwas ist, was sie noch kann. Dann seufzt sie.
»Mach dir keine Sorgen, Snow. Der Chefarzt in Minneapolis, wo ich in Behandlung bin, sagt immer, dass es so viele Krankheiten gibt, dass nicht einmal Mediziner alle kennen. Die spinale Muskelatrophie ist relativ selten und es gibt mehrere Formen. Meine ist vom Typ II und heißt chronische infantile SMA. Deshalb kann ich auch weder stehen noch gehen, obwohl ich schon acht Jahre alt bin. Aber meine Arme kann ich bewegen, nur manchmal geht es eben besser und dann wieder schlechter.«
Emma drückt fest die Hände des Mädchens, als Aki hinter den Rollstuhl tritt und ihre Hände auf die Schultern ihrer Tochter legt.
»Was hältst du von Mittagessen, Annie?« Sie zieht den Rollstuhl zurück, und Emma sieht zu Mrs Hanson auf. »Ich hoffe, Sie sind nicht Vegetarierin, Miss White, denn heute gibt es Hackbraten«, fährt Aki fort.
Nik weiß nicht warum, aber als die Frau lachend verneint, seufzt er erleichtert auf – und kurz darauf zuckt er zusammen.
»Es tut mir leid, aber ich kann nicht bleiben.« Sie steht auf und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich muss so rasch wie möglich zurück nach Saint Cloud.«
Ihre Worte sind eindeutig. Natürlich muss sie nach Hause. Wie kann er auch nur denken, dass eine Frau wie sie drei Tage vor Weihnachten nichts Besseres zu tun hat, als mit ihnen zu essen? Sicher wartet ein Mann auf sie, wahrscheinlich hat sie auch Kinder. In drei Tagen ist Weihnachten. Mr Thatcher, der Besitzer von Cuddly Toys, hat ihm am Telefon von den Problemen mit den beiden im Schneechaos verunglückten Lieferwagen erzählt und ihm gesagt, dass er eine Innendienstmitarbeiterin mit den Stofftieren schickt, um seinem Versprechen gerecht zu werden.
»Sie können jetzt nicht weg«, sagt Nik eindringlich.
Irritiert, als ob sie seine Anwesenheit komplett vergessen hätte, wendet Emma sich auf seine Aussage hin ihm zu.
»Warum nicht, Mr Hanson?«
»Mein Name ist Nikolas«, murmelt er und deutet aus dem Fenster.
Ihr Blick folgt seinem ausgestreckten Zeigefinger.
Große Schneeflocken haben die Hagelkörner ersetzt und fallen dicht an dicht vom Himmel. Vom Wind getrieben treffen sie schräg auf die Glasscheiben und bilden sofort Eiskristalle. Wenn man herinnen sitzt, wo die Wärme der Fußbodenheizung aufsteigt und Feuer im Kamin prasselt, merkt man nichts von dem Unwetter. Zudem sind die Fenster dreifach isoliert, und das Pfeifen des Windes ist nur zu hören, wenn niemand spricht.
»Der Wagen meines Chefs hat Allradantrieb, Winterbereifung und einen starken Motor. Je eher ich fahre, umso rascher bin ich wieder auf den Straßen, die regelmäßig geräumt werden.«
Sturkopf, denkt er, als sie ihn aus diesen eisblauen Augen anblitzt, und stellt zugleich fest, dass Snow viel besser zu ihr passt als Emma.