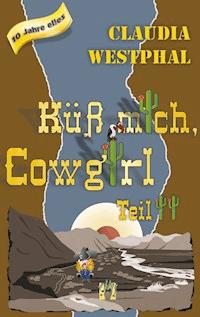Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Küss mich, Cowgirl
- Sprache: Deutsch
Miranda Miles, Inhaberin einer Zeitung im Städtchen "Miles' Creek", scheint die einzige zu sein, die sich gegen ihren tyrannischen Vater und ihre bösartige Schwester Callie zu wehren sucht. Als BJ, eine scheinbar kaltherzige Auftragskillerin, nach Miles' Creek kommt, wendet sich Mirandas Leben. In Notwehr erschießt sie einen Mann, der BJ nach dem Leben trachtet, und gewährt der Fremden Unterschlupf. Dabei fühlen sich die beiden gegensätzlichen Frauen sehr schnell zueinander hingezogen. BJ wird schließlich gefasst und soll dem Henker vorgeführt werden. Miranda versucht alles, um das Leben ihrer neuen Freundin zu retten. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden Frauen noch nicht, dass sie etwas ganz Besonderes verbindet ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Westphal
KÜSS MICH, COWGIRL
Teil 1
Originalausgabe: © 2006 ePUB-Edition: © 2013édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Der große, dunkelblonde Mann, dessen blaue Augen irgendwann einmal strahlend gewesen waren, belud seinen Planwagen. Er sah müde und ausgezehrt aus, und er trug noch immer den schwarzen Anzug, in dem er vor Stunden seine Frau beerdigt hatte.
Er hatte geweint. Tränenspuren zeichneten sich auf seinem Gesicht ab, doch sie zeugten nicht einmal annähernd von dem Verlust, den er erlitten hatte. Den er von nun an jeden Tag wieder erleiden würde, wenn er am Morgen aufwachte und Lucinda nicht bei ihm sein würde.
Allein der Gedanke daran machte ihn traurig, doch er wusste, dass es noch unerträglicher werden würde, wenn er blieb, wo ihn alles an sie erinnerte.
Der Schaukelstuhl der Verstorbenen war das letzte, das er auf seinem Wagen befestigte, bevor er sich nach dem Wichtigsten umsah: seiner Tochter Billie-Jean.
Er hatte sie schon eine Weile nicht gesehen. Sie hatte der Beerdigung aus einiger Entfernung beigewohnt, mit ernstem Gesicht und geröteten Augen. Seither war sie verschwunden.
Es war schwer für sie, vielleicht noch schwerer als für ihren Vater. Sie hatte ihre Mutter verloren, jetzt verlor sie ihr Zuhause und ihre Freunde.
Auch er würde das einstöckige kleine Haus, das an dem Fluss stand, der die Canahami durchzog, vermissen, aber er hatte seiner Frau auf dem Sterbebett versprechen müssen, dass er das alles hinter sich lassen würde. Und William Jackson, von allen nur Billy genannt, war ein Mann, der seine Versprechen hielt.
Genau wie seine achtjährige Tochter.
Er war sich sicher, dass sie auftauchen würde, weil sie ihrer Mutter versprochen hatte, auf ihren Vater aufzupassen, und so sehr sie den Gedanken auch hasste, die große Ranch verlassen zu müssen, sie würde mit ihm überallhin gehen. Sie hatte es versprochen.
Doch im Moment saß sie noch einmal – wahrscheinlich zum letzten Mal – auf ihrem Lieblingsbaum hinter dem Haupthaus und starrte vor sich hin. Die Mundharmonika, die ihr Vater ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, hielt sie fest in ihren kleinen Händen, und ihre blauen Augen blickten traurig über das Land, das sie liebte und verlassen musste. Und sie blickten traurig auf das kleine blonde Mädchen, das unter dem Baum spielte.
Randy wusste nicht, dass ihre beste Freundin weggehen würde. Ihre kleinen Finger umfassten die Holzklötze, die sie aufeinanderstapelte und dann umstieß, bevor sie in euphorisches Gelächter ausbrach. Sie blickte zu BJ auf, und die lächelte auf sie hinunter, doch nicht wie sonst, nicht so fröhlich . . .
Tief im Inneren wusste wohl auch die noch nicht einmal dreijährige Randy, dass sich etwas verändern würde, doch sie verstand es nicht. Sie war noch zu klein, um zu verstehen, dass man seine Versprechen halten musste.
BJ sprang vom Baum und setzte sich zu ihrer kleinen Freundin, deren grüne Augen sie glücklich anstrahlten. BJ wischte sich die Tränen, die schon den ganzen Morgen über ihr hübsches Gesicht liefen, mit dem Ärmel ihres dunkelblauen Hemdes weg.
»Bist du traurig, dass deine Mama nicht mehr da ist?« fragte das kleine Mädchen und legte den Kopf etwas schief, damit sie BJ in die Augen sehen konnte.
»Ja.« BJ putzte sich erneut mit ihrem Hemdsärmel über die Nase. Es war, als mache sie dies nur, damit ihre Mutter sich darüber ärgerte, wie sie es früher immer getan hatte. Aber diesmal würde sie ihre Tochter deswegen nicht ausschimpfen können; BJs Mutter war tot.
Randy ließ ihr Spielzeug liegen und stapfte auf ihren kräftigen kleinen Beinen zu BJ hinüber. Sie legte ihre kurzen Arme um ihre Freundin. »Sei nicht traurig. Ich bin doch da.« Sie wusste nicht, dass sie BJ die Mutter niemals würde ersetzen können. Das konnte niemand, auch wenn ihr Vater es versuchen würde, dennoch war es eine tröstende Geste.
BJ drückte den kleinen Körper des Mädchens ganz fest an sich. »Ich hab dich lieb, Randy.«
Das kleine Mädchen machte sich los und strahlte ihr Gegenüber an.
»Ich hab dich auch lieb, BJ.«
Das dunkelhaarige Mädchen lächelte ein wenig. Es brach ihr das Herz, dass sie die Ranch verlassen musste, dass sie Randy verlassen musste. Sie hatte niemanden auf der Welt lieber, von ihrem Vater und ihrer Mutter abgesehen, und sie hätte sie am liebsten mitgenommen. Aber natürlich hatte Randy ihre eigene Familie. Es war die Familie, die auf der großen Ranch wohnte, die Familie, der hier alles gehörte.
»Komm mit.« BJ stand auf und wartete, dass Randy ihr folgte. Die Kleine lief hinter ihr her, als sie das Haupthaus umrundete.
Elizabeth Miles bemerkte die beiden von ihrem Platz auf der Veranda aus und hielt in ihrer Stickarbeit inne. Randys Mutter hatte bestimmt schon tausendmal gesehen, wie ihre Jüngste hinter ihrer großen Freundin hertrottete, aber in diesem Augenblick wusste sie, dass es definitiv das letzte Mal sein würde, und es machte sie traurig. Sie hatte nie verstanden, weshalb die beiden so eng zusammenhingen, weshalb sie einander so zugetan waren, aber so war es, und ihre Tochter würde heute einen für sie wichtigen Menschen verlieren. Elizabeth wusste, dass Miranda BJ bald vergessen haben würde, wenn sie nicht mehr jeden Tag da war, und ihrer Meinung nach war das ein Segen, dann würde sie nicht so sehr unter der Trennung leiden.
Sie selbst würde diesen Wildfang ein bisschen vermissen, und auch ihren Vater, aber vor allem vermisste sie Lucinda, BJs Mutter, die ihr all die Jahre auf der großen Ranch eine gute Freundin gewesen war.
Natürlich war es nicht immer leicht gewesen. Am Anfang hatte sie nicht gewusst, wie sie der Frau begegnen sollte, in die ihr eigener Ehemann verliebt war, oder den Geschichten über James’ frühere Ehefrauen. Doch sie hatte sich arrangiert, zuerst mit den beiden Töchtern James Miles’, dann mit allem anderen, und letztlich auch mit Lucinda.
Inzwischen schien ihr die größte Bürde die Wahl ihres Ehemannes zu sein, der in diesem Moment vom oberen Stockwerk die Abreise seines größten Konkurrenten beobachtete.
Doch wie könnte sie ihn verlassen? Sie würde nicht nur ihr Leben aufgeben, sie würde ihre Kinder aufgeben. Und das war keine Option für die kleine rotblonde Frau.
Der Planwagen fuhr vor das Haupthaus, und Billy sah seine Tochter an. »Es wird Zeit«, sagte er, als er vom Bock stieg.
Millie kam in diesem Moment aus dem Gebäude, und er ging zu ihr und umarmte sie. BJ kniete sich zur gleichen Zeit in den Sand vor Randy hin.
»Fahrt ihr in die Stadt? Darf ich mitkommen?«
BJ schüttelte traurig den Kopf. »Nein, du kannst nicht mitfahren. Wir . . .« BJ seufzte. »Ich bring dir was mit.« Sie umarmte Randy ein letztes Mal. Das kleine Mädchen sah sie aus großen grünen Augen an, und BJ musste den Blick senken. Sie konnte Randy nicht anlügen, aber sie konnte ihr auch nicht sagen, dass sie für immer weggehen würde. Sie sah zu ihrem Vater und zu Millie, die leise zu weinen angefangen hatte, hinüber.
Randy schien beunruhigt durch die Tränen und die Aufbruchstimmung. »Ich will aber mitkommen«, sagte sie trotzig.
»Das geht nicht.« BJ stand auf und kletterte hinten in den Wagen.
»Will mitkommen!!!« kreischte ihre kleine Freundin.
Elizabeth lief zu ihr und nahm sie hoch.
Randy streckte ihre kurzen Arme nach BJ aus, während ihre Mutter versuchte, sie zu beruhigen.
Billy war inzwischen auf den Bock geklettert, und der Wagen setzte sich in Bewegung, als er den Pferden das Zeichen gab.
Randy weinte und quäkte inzwischen. Auch BJ liefen Tränen die Wangen hinab, da fiel ihr die Mundharmonika ein, die sie in die Hosentasche gesteckt hatte. Sie machte einen Satz aus dem Wagen und lief zu ihrer Freundin zurück.
Sie kramte ihr Musikinstrument aus der Tasche und gab es dem kleinen Mädchen, das sofort aufhörte, zu schreien.
»Bewahr sie für mich auf, okay?« BJ stellte sich auf die Zehenspitzen und gab Randy einen Kuss auf die Stirn. Dann drehte sie sich um und lief hinter dem Wagen her, der sie in ein neues Leben bringen würde. Sie kletterte wieder hinten auf und winkte ihrer kleiner werdenden Freundin zu.
BJ blieb lange dort sitzen und starrte auf den Punkt, an dem Randy verschwunden war, dann kletterte sie zu ihrem Vater auf den Bock. Sie sah traurig auf die staubige Straße, die sich vor ihnen erstreckte. Billy legte einen Arm um die schmalen Schultern seiner Tochter.
»Meinst du, ich werde Miranda wiedersehen?« fragte sie ihn traurig.
»Wer weiß, vielleicht eines Tages«, antwortete er. Aber er glaubte es nicht.
Teil 1
1858, Miles’ Creek, Texas
Sie sah auf die große Wanduhr, die neben der Tür stand. 6:55 Uhr. Sie stürzte den Whiskey hinunter, den sie seit mehreren Minuten unruhig zwischen den Händen drehte. Dann wandte sie sich zum Ausgang.
»Hey Lady, der Whiskey bezahlt sich nicht selbst!«
Sie drehte sich um und sah den Wirt an. »Ich bezahle, wenn ich wiederkomme.«
»Und wenn du nicht wiederkommst?«
»Ich komme wieder.« Sie zog ihren Colt aus dem linken Halfter an ihrer Hüfte, und die Hände des Wirts verschwanden sofort unter der Theke, an den Abzug einer Smith & Wesson.
Doch die Frau in Schwarz legte ihren Colt auf die Bar. »Wenn ich nicht wiederkomme, gehört er dir.« Sie schob ihren Hut aus den Augen. Der eiskalte Blick ließ den Wirt verstummen, und die Frau verschwand durch die Schwingtür nach draußen.
Staub wehte ihr in die Augen, und sie zog ihren Hut wieder tiefer ins Gesicht. Wie sie erwartete hatte, stand ihr übereifriger Gegner bereits mitten auf der Straße und wartete auf sie. Sie rieb sich über die Narbe, die ihren gesamten rechten Handrücken zierte.
Der kräftige Wind, der von Norden die Hauptstraße hinaufwehte, erhöhte seine Chancen, wie er glaubte, erheblich, denn der Wind wirbelte eine Menge Staub auf, den die Dunkle ins Gesicht bekam. Der stämmige Mann lächelte sein zahnloses Lächeln: Sie hatte keine Chance. Selbst, wenn die Umstände anders gewesen wären – sie war eine Frau. Was konnte ihm schon groß passieren?
Schaulustige standen bereits auf dem hölzernen Gehsteig und beobachteten, wie die große Frau sich ihrem Gegner in einiger Entfernung gegenüberstellte. Dann wanderten die Blicke zur Uhr am Rathaus, bevor sie sich wieder den Duellanten auf der Straße widmeten. Keiner glaubte, dass die Frau in Schwarz eine Chance hatte. Alle kannten Buzz, keiner kannte die Fremde. Er war für seine Schnelligkeit bekannt, sie würde nur die Lebensmüde der Woche sein, die sich dummerweise mit dem schnellsten Schützen der Stadt angelegt hatte.
Der Wirt, der von seiner Schwingtür aus zusah, rieb sich die Hände. Der edle Colt, den die Fremde ihm überlassen hatte, war wesentlich mehr wert als der verwässerte Whiskey.
Noch eine Minute.
Die Spannung auf der Straße war zum Zerreißen gespannt, als sich plötzlich quietschend eine Tür öffnete. Beide Schützen starrten die junge blonde Frau an, die einem Bekannten auf der anderen Straßenseite zurief:
»Hey, Peter, ich . . .« Die junge Frau ließ ihre winkende Hand sinken. Blaue Augen starrten in grüne.
Ein Klicken, ein Glockenschlag, dann ein Schuss.
Buzz’ Augen weiteten sich ungläubig. Er hatte noch nicht einmal Zeit zum Ziehen gehabt. Er fiel tot auf die Straße; aus einer Wunde über seinem Herzen sickerte Blut.
Die Zuschauer rieben sich verstört die Augen und starrten auf den Leichnam auf der Straße. Niemand bemerkte, dass die Schützin sich, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen, wieder auf den Weg in den Saloon gemacht hatte – bis auf den Wirt, der sein Pfand wieder rausrücken musste. Er war so geschockt, dass er sogar vergaß, die Dunkle an den Dollar für den Whiskey zu erinnern.
Sie war schon auf dem Weg ins obere Stockwerk in ihr Zimmer – sie wollte nur ihre Sachen packen und dann verschwinden –, da flog plötzlich die Saloontür auf, und sie fuhr herum.
Grüne Augen starrten in blaue.
»Sie haben ihn erschossen!« Die Stimme der kleinen Frau klang fassungslos, aber es schwang noch etwas anderes darin mit.
Erleichterung?, mutmaßte die Fremde. »Natürlich, sonst hätte er mich umgebracht.« Ihre Stimme war emotionslos, ihre blauen Augen blickten kalt. Sie wandte sich wieder ab und stieg die Treppen hoch. Da hörte sie schnelle Schritte hinter sich. Die Blonde folgte ihr offensichtlich.
Die Dunkle drehte sich so plötzlich wieder um, dass die jüngere Frau fast in sie hineingerannt wäre.
»Hör zu! Wenn der Typ dein Mann war, dann tut es mir leid für dich. Ich habe mich . . .«
»Das ist es nicht«, sagte die Blondine.
Die größere Frau sah die kleinere fragend an.
»Ich bin Miranda Lewis.« Die Blondine streckte der Fremden enthusiastisch ihre Hand entgegen, die jedoch unbeachtet in der Luft hängenblieb. »Ich führe die Zeitung hier.«
Auch das beeindruckte nicht.
»Ich möchte Ihnen ein Angebot machen.«
Eine zuckende Augenbraue war die einzige Antwort, doch mehr schien Miranda nicht zu brauchen. »Können wir irgendwo ungestört reden?«
Die Fremde trat einen Schritt beiseite und deutete der jüngeren Frau, vorauszugehen. Ein Lächeln fuhr über Mirandas Gesicht. Sie ging an der attraktiven Dunklen vorbei und die Treppe hinauf.
Blaue Augen fuhren über den Körper vor ihnen, suchten nach einem Anzeichen für eine Waffe, konnten aber bei dem vielen Stoff von Mirandas Röcken keinen Colt ausmachen.
Die Fremde ließ ihre Hand über den Revolver an ihrer rechten Hüfte gleiten und zog langsam den Hahn mit dem Daumen zurück.
Am Treppenabsatz angekommen, sah Miranda sich um.
»Welches?« schien ihr Blick zu fragen, und die Fremde deutete auf die Tür am Ende des Ganges. Sie stieß sie auf, und Miranda trat ins Innere eines stickigen Raumes, der gerade genug Platz für ein Bett und einen Waschtisch bot. Zwei Satteltaschen lagen auf dem Bett, ansonsten wirkte das Zimmer unbewohnt, die Fremde reiste mit wenig Gepäck.
Als sie die Tür schloss, begann Miranda, sich leicht unbehaglich zu fühlen. Ihr Blick fuhr zu den Waffen an der Hüfte der Dunklen, und sie sah, dass einer der Revolver gespannt war. Sie vermied es, eine schnelle Bewegung zu machen.
»Ist das nötig?« fragte sie und deutete vorsichtig auf die Waffe. Die Fremde zog den Colt, der sich wunderbar in ihre Hand schmiegte. Miranda wich zurück, als der Waffenlauf plötzlich auf sie zeigte. Angst schlich sich in ihre Augen, doch dann trat sie beherzt einen Schritt auf die größere Frau zu.
»Nimm sie runter!« Wut ließ Mirandas Stimme erzittern.
»Eine Vorsichtsmaßnahme. Wer sagt mir, dass du unbewaffnet bist?« Die Fremde glaubte nicht, dass jemand ohne Waffe ihr derartig entgegentreten würde.
Mirandas Gesichtszüge verhärteten sich, ihre grünen Augen funkelten. »Ich führe eine Zeitung, keine Bar.«
Die Fremde steckte den Revolver wieder ins Halfter, entsicherte ihn aber nicht und trat um die kleinere Frau herum. »Ich will nur sichergehen.«
Die tiefe Stimme dicht an ihrem Ohr verursachte Miranda eine Gänsehaut. Sie konnte nicht sehen, was die Fremde vorhatte, und das machte ihr mehr angst als der Revolver. Starke Hände legten sich auf ihre Hüften und fuhren dann hinab bis zu ihren Knöcheln. Dieselben Hände überprüften den Rocksaum, und plötzlich spürte Miranda eine von ihnen an der Innenseite ihrer Wade hinaufgleiten. Sie machte einen Satz und fuhr herum.
»Das reicht jetzt!« schrie sie und sah erneut in die Mündung eines Revolvers, dann in die blauen Augen dahinter. Etwas Anzügliches lag darin, ebenso wie in dem Lächeln, das um die Mundwinkel der Fremden spielte. Miranda spürte, wie das Blut in ihren Kopf schoss, und das machte sie noch wütender.
»Was wollen Sie von mir?« fragte die Fremde ruhig; das Lächeln war verschwunden. Der Colt ebenfalls, wie Miranda erleichtert feststellte.
»Sie sagten, Sie hätten mir ein Angebot zu machen«, erinnerte die große Frau und zog ein silbernes Zigarettenetui hervor. Sie nahm sich einen der dunklen Zigarillos, dann erinnerte sie sich ihrer wenigen Manieren und bot Miranda ebenfalls einen an.
Miranda schüttelte den Kopf. Das Zigarettenetui verschwand wieder, und lange dunkle Finger fischten ein Streichholz aus der linken Brusttasche des schwarzen Hemdes. Dabei konnte Miranda einen kurzen Blick auf die Narbe werfen, die auf der braungebrannten Hand weiß hervortrat.
Eine schnelle Bewegung in Richtung Toilettentisch, ein Zischen, eine kleine Flamme, an der die Fremde ihren Zigarillo entzündete. Sie nahm einen tiefen Zug und pustete Miranda den Rauch ins Gesicht. »Also?«
Miranda riss sich zusammen und endlich von den durchdringenden blauen Augen los. »Wissen Sie, wen Sie da umgebracht haben? Das war Buzz Roberts. Einer von James Miles’ Leuten.«
»Er war ein mieser kleiner Bastard. Das war alles, was ich wissen musste.«
»James Miles ist der wichtigste Mann hier. Ihm gehört die Stadt. Wenn er hört, dass Sie Buzz getötet haben, wird er Sie töten. Einfach so.« Miranda schnippte mit den Fingern, um ihren Standpunkt zu untermauern. Eine Eigenart, die Luke Meyers ihr beigebracht hatte.
Die Fremde wartete einen Moment, doch die kleine Blonde schien ihre Rede beendet zu haben. »War das alles? Ich hätte noch etliche Dinge zu erledigen.«
Grüne Augen starrten ihr Gegenüber ungläubig an. Entweder, diese Frau war so eiskalt, wie sie tat, oder sie war verdammt dumm. Miranda war sich nicht sicher, was eher zutraf.
»Haben Sie nicht verstanden? Er wird Sie töten, wenn Sie den Saloon verlassen. Er ist wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher.«
»Gut.«
»Gut, aber . . .«
»Sie sagten etwas von einem Angebot. Rücken Sie jetzt raus damit, oder nicht? Wie gesagt, ich habe noch einiges zu erledigen«, unterbrach die Fremde Miranda. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass die Blonde, wenn sie erst mal anfing zu reden, nicht mehr leicht zu stoppen war, und ihre eigene Geduld war sehr begrenzt.
»Ich kann Sie vor Miles verstecken.«
Die Fremde lachte trocken. »Wieso sollten Sie das tun? Und wieso sollte ich das wollen?«
»Ich nehme an, dass Sie noch ein bisschen weiterleben wollen, und wenn ich Ihnen helfe, schulden Sie mir etwas.«
Eine Augenbraue zog sich nach oben. »Und Sie haben bestimmt schon eine Idee, was das sein könnte.«
»James Miles’ Kopf auf einem Silbertablett.«
Nun schoss auch die zweite Augenbraue in die Höhe. »Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Vielen Dank. Sie sollten jetzt lieber gehen, bevor ich Sie noch übers Knie lege.« Dann drehte sie Miranda ihren Rücken zu, damit diese ihr Lächeln nicht sah. Doch beim Blick aus dem Fenster erstarb das Lächeln auf ihrem Gesicht, und ihre Pupillen weiteten sich vor Schreck.
»Runter!« schrie sie, fuhr herum und warf sich über die junge Frau. Ein Schuss fiel, Glas splitterte, als die Fremde Miranda zu Boden riss.
»Was . . .?!«
Der Körper der großen Frau rollte sich von dem kleineren. Geschockt sah Miranda auf den Blutfleck, der sich auf ihrer grünen Bluse ausbreitete. Doch sie fühlte keine Schmerzen. Ihr Blick fiel auf die Person neben sich, die sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter hielt.
Die Verletzte fühlte noch, wie ihr das warme Blut über die Hand rann, dann wurde der Schmerz übermächtig, und sie verlor das Bewusstsein.
Miranda richtete sich auf. Wieder fiel ein Schuss, der knapp über ihrem Kopf durch die Tür schlug. Miranda duckte sich wieder und ging hinter dem Bett in Deckung. Sie zog auch die Verwundete aus der Schusslinie. Ein kurzer Blick in den Spiegel über dem Toilettentisch genügte, um den Schützen zu entdecken, der auf dem Dach gegenüber Stellung bezogen hatte.
Miranda wusste, dass die Revolver der Fremden keine ausreichende Reichweite hatten, um den Mann gegenüber zu treffen. Sie sah sich nach einem Gewehr um, konnte aber keines entdecken. Suchend fuhren ihre Hände unters Bett und stießen gegen etwas, das sie gleich darauf in beiden Händen hielt.
Das Gewehr war ungewöhnlich leicht. Es hatte wunderschöne Insignien am Griff, und Miranda erlaubte sich einen Moment, um darüberzustreichen.
Ein Schuss fiel, und ein paar Federn wirbelten auf. Miranda duckte sich noch tiefer. Sie überprüfte, ob das Gewehr geladen war – was es natürlich war –, dann spannte sie den Hahn. Sie wusste, dass sie nur einen Schuss hatte, und überprüfte die Stellung ihres Gegners ein weiteres Mal im Spiegel.
Sie zählte bis drei, dann tauchte sie hinter dem Bett auf und lehnte sich auf die alte Matratze. Eine Kugel schlug neben ihrem Ellenbogen ein, sie zielte, sie schoss. Der Mann gegenüber taumelte rückwärts, stieß gegen etwas und fiel vom Dach. Miranda meinte, den Aufschlag seines Körpers in der Seitengasse zu hören. Sie starrte für einen Moment aus dem Fenster. Jetzt war alles wieder friedlich.
Die Fremde lag bewußtlos neben Miranda. Diese zögerte nicht und schlug die große Frau hart ins Gesicht. Als die Fremde wieder zu sich kam, griff sie sofort nach ihrem Revolver, doch der Schmerz in ihrer Schulter verhinderte ein schnelles Ziehen, und Miranda kam zuerst an die Waffe, zog sie geschickt aus dem Holster und entsicherte sie.
»Was . . .?«
Die Fremde hielt sich wieder die Schulter und erinnerte sich langsam. Sie lugte über die Bettkante. »Wo ist er hin?«
»Ich habe mich um ihn gekümmert. Kommen Sie, hier können wir nicht bleiben.« Miranda steckte den Revolver zurück an seinen Platz, nahm das Gewehr und wollte der Fremden aufhelfen. Ein abweisender Blick aus eiskalten blauen Augen ließ sie es sich anders überlegen. Die Fremde kam ohne Hilfe und vor Schmerz aufstöhnend auf die Füße. »Verdammt!«
Miranda sah an sich hinunter. Der Blutfleck prangte auf ihrer Bluse. Sie sah sich um und entdeckte den langen schwarzen Mantel, der an der Tür hing. Sie nahm ihn vom Haken und zog ihn über. Der schwere Geruch von Zigarillos und Schweiß strömte ihr in die Nase und sie verzog angewidert das Gesicht.
»Haben Sie schon mal daran gedacht, das Ding zu waschen?«
Die Fremde durchbohrte Miranda mit ihrem Blick, doch die kleinere Frau ignorierte es und öffnete vorsichtig die Tür. Noch war alles ruhig.
Miranda deutete der Fremden, ihr zu folgen. Sie schlichen den Gang entlang auf die Hintertür zu. Als sie diese fast erreicht hatten, konnten sie aufgeregte Stimmen aus der Bar hören: »Wo ist sie?«
Der Sheriff, dachte Miranda. Sie öffnete die Hintertür, und sie schlüpften hindurch. Eng an die Wand gedrückt liefen sie über den Hinterhof, bis Miranda vor einer Tür stehenblieb. Sie fingerte einen Schlüssel aus ihrer Rocktasche und schloss auf.
Die Fremde sah sich nach allen Seiten um, doch sie konnte niemanden entdecken. Mit einem Blick vergewisserte sie sich, keine Blutspur hinterlassen zu haben. Dann schlüpfte sie hinter Miranda in einen sehr dunklen Raum.
»Wo sind wir?« Sie versuchte zu erkennen, was die kleine Blonde tat, aber ihre Augen hatten sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Also lauschte sie angestrengt in das farblose Nichts vor sich. Eine Hand legte sich um ihr Handgelenk.
»Hier entlang.« Miranda zog die große Fremde in einen angrenzenden Raum. Hier war es sehr eng und immer noch stockdunkel. Miranda schloss die Tür. Dann erst entzündete sie eine Lampe.
»Wo sind wir?« wiederholte die Fremde ihre Frage.
»In einer Abstellkammer.« Das hatte die Dunkle aber selbst schon herausgefunden. Sie durchbohrte Miranda wieder mit diesen strahlend blauen Augen.
Miranda bevorzugte es, diesen Blick erneut zu ignorieren, und lehnte sich etwas atemlos gegen ein großes Regal hinter sich. Sie atmete ein paarmal tief durch, doch für die Analyse dieser bizarren Situation hatten sie jetzt keine Zeit. Statt dessen sagte sie: »Wir müssen weiter.«
Die Fremde wollte gerade wieder die Tür öffnen, die sie in den Raum geführt hatte, doch Miranda drehte sich zum Regal um.
»Hier entlang«, sagte sie und stemmte sich gegen das hölzerne Ungetüm, das ächzend nachgab. Sie nahm die Lampe und ging voran. Die große Frau folgte ihr zögernd eine steile Treppe hinab, dann einen langen Gang entlang, bis sie wieder vor einer Tür standen, die in einen größeren Raum führte. Hier unten gab es ein Feldbett, ein Fass, das als Tisch für eine weitere Lampe diente, und eine Kiste mit ein paar Lebensmitteln.
»Haben Sie mich erwartet?« fragte die Fremde überrascht.
»Ich habe jemanden wie Sie erwartet. Aber dieser Jemand ist hier nie angekommen. Ich nehme an, Mr. Miles hat sich um ihn gekümmert, oder aber einer seiner Leute.« Mirandas Augen suchten einen Punkt auf dem Fußboden, doch ihr Gegenüber hatte zuvor noch einen kurzen Blick auf das wütende Funkeln darin werfen können.
Das war nicht einfach ein Disput zwischen Nachbarn, es war Krieg, und obwohl sie nicht wusste, worum es ging . . . Nein! Es würde überhaupt nichts bringen, jetzt Partei für die junge Frau zu ergreifen. Sie würde ihr nicht helfen können, denn sie würde morgen früh nicht mehr hier sein, das zumindest glaubte die Dunkle.
»Und jetzt soll ich seinen Job übernehmen? Danke, aber nein danke. Das ist nichts für mich.« Sie nahm ihr Gewehr, das Miranda an die Wand gelehnt hatte, und wandte sich zum Gehen.
»Warten Sie. Sie können da jetzt nicht rausgehen. Die ganze Stadt sucht wahrscheinlich schon nach Ihnen.« Dann fiel Miranda etwas ein. »Wen habe ich . . . wer hat da überhaupt auf uns geschossen? Ich kenne Miles’ Leute, und das war keiner von ihnen.«
»Nur ein alter Bekannter.« Die große Frau sah sich um. »Kann nichts schaden, ein paar Stunden hierzubleiben. Nur bis sich der Sturm gelegt hat. Dann bin ich weg!«
Ihre Stimme war unmissverständlich, aber Miranda Lewis wäre nicht Miranda Lewis, wenn sie sich so leicht hätte abwimmeln lassen. »Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Sie schulden mir etwas«, protestierte sie.
»Falsch. Ihre Aktion auf der Straße hätte mich fast das Leben gekostet. Und ich habe mir gerade für Sie eine Kugel eingefangen. Sie schulden mir etwas.«
»Die Kugel war für Sie bestimmt«, argumentierte Miranda weiter. »Außerdem . . . Miles wird Sie hier ohnehin nicht weglassen. Roberts war ein alter Freund von ihm. Er wird nicht eher ruhen, bis Sie tot sind. Sie können sich ihm ebensogut stellen.«
Funken sprühten zwischen den beiden Frauen, doch Miranda gab dem einschüchternden Blick ihres »Gastes« nicht nach.
»Ich hole Verbandszeug für Ihre Wunde.« Sie wandte sich um und ging.
Die große Frau setzte sich auf das Feldbett und riss ihr Hemd über der Schulter auf. Sie stöhnte vor Schmerz. Zumindest war es ein Durchschuss. Sie stand auf und ging zu der Kiste mit Lebensmitteln. »Ah.« Sie griff nach der Flasche Whiskey und zog den Korken mit den Zähnen heraus. Dann kippte sie ein paar Schluck in ihre Kehle. Sofort breitete sich eine angenehme Wärme in ihr aus. Sie riss ihren rechten Hemdsärmel ganz ab und tränkte ihn mit der rotbraunen Flüssigkeit. Als sie den feuchten Stoff auf die Wunde drückte, raubte ihr der Schmerz das Bewusstsein.
Der junge Mann ritt wie der Teufel durch das große Tor, an dem das Schild mit dem Namen der Ranch prangte. Er ritt so schnell, dass er den Namen nicht hätte lesen können, selbst wenn er es versucht hätte. Doch er kannte den Namen, er kannte die Menschen, die dort lebten, und er hätte gern zu ihnen gehört.
Vor dem großen Haupthaus zügelte er sein Pferd und sprang ab. Mit langen Schritten nahm er die Stufen zur Veranda und stürmte ohne zu klopfen ins Haus. Er bog rechts ab, durchquerte den Salon und stand schließlich im großen Esszimmer, wo sein Boss James Miles mit seiner ältesten Tochter Callie beim Frühstück saß.
». . . Ich schwör dir, der Typ wusste gar nicht . . .«
»Mr. Thomson«, unterbrach Miles seine Tochter, und sie sah zu dem jungen Mann hinüber, der schweratmend am Türpfosten zum Esszimmer lehnte.
Callies dunkelbraune Augen funkelten böse. Sie hasste es, unterbrochen zu werden, besonders, wenn sie ihrem Vater etwas erzählte. »Haben Sie keine Manieren?« zischte sie Zack Thomson an. »Sie haben vergessen, zu klopfen.«
»Entschuldigung«, brachte Zack schließlich hervor. »Es geht um Buzz. Er ist . . . tot.«
Miles starrte den jungen Mann mit dem Sheriffstern über der linken Brust ungläubig an. Callie sah zu ihrem Vater.
»Wer . . .?« Miles brach ab. Er konnte das Bild des Hünen, der am Abend zuvor die Ranch in Richtung Stadt verlassen hatte, um Poker zu spielen, nicht mit seinem jetzigen Zustand in Verbindung bringen.
»Wer hat ihn umgebracht?« fuhr Callie den Sheriff an. Dass es ein Unfall gewesen sein könnte, daran glaubten weder sie noch ihr Vater.
»Es war eine Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie ist groß, dunkelhaarig, und sie hat eine Narbe auf der rechten Hand.«
Beide Miles waren überrascht, dass es eine Frau gewesen war, aber als Thomson noch hinzufügte: »Ach ja, und sie hat diese unglaublich blauen Augen«, da schienen Miles die eigenen fast herauszufallen vor Überraschung. Er stand vom Tisch auf und ging in sein Arbeitszimmer. Gleich darauf kehrte er mit einem Foto zurück. Er zeigte es Zack. »Hat sie so ausgesehen?«
Zack nickte. »Bis auf die Augen. Wie gesagt, sie waren blau.« Das Bild betrachtend, fragte er: »Wer ist das?«
Miles starrte auf das Foto, das die Frau zeigte, die er einmal geliebt hatte. Callie stand jetzt ebenfalls auf, um sich das Bild anzusehen. Während Zack seine Augen nicht von ihrem geschmeidigen Körper wenden konnte, gesellte sich Callie zu ihrem Vater und starrte auf das Bild. Die Frau kam ihr bekannt vor, allerdings wusste sie nicht genau, woher, und das Foto hatte sie noch nie bei ihrem Vater gesehen.
»Lucinda Brown.« James löste seinen Blick von dem Bild, nur um gleich darauf aus dem Fenster zu starren, als würde sie noch immer da draußen herumlaufen.
Callie kämpfte gegen die Eifersucht, die jetzt in ihr hochstieg. Lucinda Jackson, geborene Brown, war die beste Freundin ihrer Mutter gewesen, und ihr Vater hatte sie geliebt.
»Sie ist tot«, sagte sie, um sich selbst und ihren Vater daran zu erinnern.
»Ja, aber ihre Tochter ist es nicht.«
»BJ!« Es war fast ein Fauchen, als Callie den Namen nach all diesen Jahren wieder aussprach. Sie erinnerte sich zu gut an das Mädchen mit den durchdringenden blauen Augen, und sie erinnerte sich an die Demütigungen, die sie ihr zugefügt hatte.
»Dieses Miststück.« Callie konnte die Wut kaum unterdrücken, die sie nach all diesen Jahren noch immer empfand.
Miles wandte sich an Zack: »Reiten Sie wieder in die Stadt. Ich will, dass Sie sie festnehmen und zur Ruine bringen.«
Zack nickte. Er warf Callie ein verschmitztes Lächeln zu, das mit einem bohrenden Blick erwidert wurde, und machte sich wieder auf den Weg nach Miles’ Creek.
Miles schenkte sich einen Whiskey ein und setzte sich dann mit dem Foto an den Frühstückstisch. Callie überlegte, ob sie es ihm nachtun oder sich zurückziehen sollte. Die Art, wie ihr Vater das Bild dieser Hure anstarrte, machte sie wütend. Einen Moment stand sie unschlüssig da. Die Stimme ihres Vaters holte sie aus ihrer Unentschlossenheit. »Hilf ihm besser, und dann kümmere dich um BJ«, war alles, was er sagte.
Callie lächelte und machte sich auf den Weg zum Stall. Sie würde BJ Jackson töten, nach all diesen Jahren, all diesen Leben? Der Gedanke gefiel Callie. Ebenso wie die Vorfreude, die sich als Kribbeln in ihrem Bauch manifestierte, als sie die Ranch ihres Vaters in Richtung Miles’ Creek verließ.
BJ Jackson! Wer hätte gedacht, dass er sie je wieder sehen würde! Und dann auch noch in Gestalt ihrer Mutter.
Das Leben barg für James Miles eine gewisse Ironie. Es schien über sich selbst lachen zu können. Was er aber nicht konnte. Und er fand es auch keinesfalls witzig, dass die Tochter seines Erzfeindes in seine Stadt kam und einen seiner besten Männer tötete. Einfach so. Er hatte nichts dagegen tun können, und natürlich würde auf der nächsten Bürgerversammlung das Thema »Sicherheit« aufkommen.
Er musste sie fassen und auslöschen. Und er würde es genießen. Er würde nach all den Jahren doch noch Gerechtigkeit üben. Billies Tochter würde für all das bestraft werden, was er James angetan hatte. Ironisch mochte das Leben sein, doch es war in gewisser Weise auch gerecht: BJs Tod würde Billy viel mehr treffen als sein eigener.
James Miles lächelte. Doch nur so lange, bis er wieder auf das Bild in seinen Händen sah.
Lucinda war nicht nur schön gewesen. Sie war auch stark gewesen. Willensstark. Seine Frau hatte Millie erzählt, wie hart sie in den letzten Stunden ihres Lebens gekämpft hatte. Sie hatte überleben wollen, doch sie hatte verloren. Auch BJ würde kämpfen, doch das würde seinen eigenen Triumph nur vergrößern, wenn sie am Ende unterlag.
James Miles blickte aus dem Fenster auf sein Land, ein Beweis dafür, dass ihm bisher alle unterlegen waren. Er hatte die Ranch Stück für Stück erweitert, bis nur noch Meyers’ Farm übriggeblieben war. Doch auch die würde er bekommen, sobald Miranda ihr Interesse an dem Stück Land verlieren würde, was sicherlich bald der Fall war. Miranda interessierte sich nur für Dinge, die er selbst auch haben wollte. Wenn er Desinteresse heuchelte, würde sie bald aufgeben, Meyers zu unterstützen, und dann hatte er sie.
Er war ein Taktiker. Er kannte seine Leute, seine Familie, seine Stadt. Er hatte alles unter Kontrolle. Und auch, wenn Miranda jetzt noch glaubte, sich ihm widersetzen zu können, so beherrschte er sie doch.
Das waren die Gedanken des Tyrannen auf der Ranch. Er ließ sie schweifen, fing sie wieder ein, sinnierte, kalkulierte.
Er hegte keinen Zweifel an seiner Macht. Er hegte keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Alles war zu lange zu gut für ihn gelaufen. Wer sollte dem jetzt ein Ende machen?
Miranda ging den dunklen Gang entlang. Ihre Schläfen pochten unangenehm.
Es war nicht das erste Mal gewesen, dass sie mit einem Gewehr auf jemanden geschossen hatte. Sie hatte auf Viehdiebe geschossen, aber mehr, um sie zu verjagen, als sie tatsächlich zu verletzen. Jetzt hatte sie jemanden umgebracht. Einen Fremden, der es nicht einmal auf sie abgesehen hatte.
»Es war Notwehr«, sagte sie zu sich selbst, als würde der Klang ihrer Stimme sie davon überzeugen. Miranda fröstelte, und sie schlang ihre Arme um ihren Oberkörper. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie noch immer den muffigen Mantel der Fremden trug. Sie hatte sich an den scheußlichen Geruch gewöhnt und empfand den schweren Stoff nun als angenehm warm und schützend. Die Ärmel hatte sie ein ganzes Stück hochschieben müssen, um ihre Hände benutzen zu können. Der Mantel reichte auch fast bis auf den Boden, aber sie fühlte sich sicher in dem Ding. Sie stieg vorsichtig die steile Treppe hinauf und schloss die Geheimtür hinter sich. Dann trat sie wieder in den großen dunklen Raum auf der Rückseite ihrer Zeitung. Sie schob die schwarzen Vorhänge beiseite und löschte die Lampe. Dann fing sie an, nach dem Verbandskasten zu kramen. Ein Klopfen an der Hintertür schreckte sie hoch.
»Miranda? Bist du da?« Die Stimme gehörte dem Hilfssheriff Zack Thomson.
»Ja, ich komme.« Miranda schloss ein paar Knöpfe des Mantels, um den roten Fleck auf ihrer Bluse ganz zu bedecken, und öffnete die Hintertür.
Zack nahm seinen Hut ab und trat ein. »Hallo, Miranda. Wie geht es dir?«
»Ich habe viel zu tun. Was ist denn da draußen los?« Miranda hatte keine Zeit für ein belangloses Gespräch. In ihrem Keller verblutete vielleicht gerade jemand.
»Ich dachte, du könntest mir das sagen.«
Der junge Mann sah verschwitzt aus und roch nach Pferd. Doch Miranda achtete kaum darauf, sie hatte genug eigene Sorgen.
»Ich . . .?« Sie sah den Hilfssheriff überrascht an, doch hinter der Fassade zitterte sie vor Angst, dass sie beobachtet worden war, als sie den Mann erschossen hatte.
»Lou sagt, du wärst bei der Frau gewesen, die Buzz erschossen hat. Hat das mit deinem Va. . .«
»Nein!« unterbrach Miranda ihn wütend, fuhr dann aber ruhiger fort: »Ich wollte nur einen Bericht für meine Zeitung. Sie war allerdings wenig kooperativ, also bin ich wieder gegangen.«
»Durch die Hintertür?«
»Das ist näher.«
Er nickte.
»Wieso fragst du? Habe ich etwas Unrechtes getan?« Mirandas grüne Augen starrten ihn herausfordernd an. Sie war angespannt und hoffte, dass er es nicht bemerken würde.
»Nein, es sieht nur so aus, als hätte diese schießwütige Lady von heute morgen schon wieder jemanden umgebracht. Ich wollte nur sichergehen, dass es dir gutgeht.«
»Mir fehlt nichts. Wer . . .« Miranda sah auf ihre Hand, die den Türknauf fest umklammert hielt und nun zu zittern begann. Sie ließ den Knauf los und versteckte ihre Hände in den langen Ärmeln des Mantels. Sie starrte zu Boden, als sie fragte: »Wisst ihr schon, wer der Tote war?«
Zack nickte. »Ein Sheriff aus Loredo. Coleman oder so ähnlich.«
Miranda wurde blass. Sie starrte ihr Gegenüber ungläubig an. »Oh Gott, wie furchtbar!«
»Es scheint, dass er diese Frau schon eine ganze Weile verfolgt hat. Hier . . .« Er reichte Miranda einen Steckbrief. Die farblosen Augen der Fremden starrten sie von dem Papier an. 2000 Dollar Belohnung waren auf ihren Kopf ausgesetzt. »Tot oder lebendig« stand in großen braunen Lettern unter der Summe. Ein roter Halbmond hatte sich am linken Rand des Papiers gebildet. Miranda starrte ihn an. Es war das Blut, das sie vergossen hatte. Sie ließ das Blatt fallen.
»Alles in Ordnung?« Zack hob den Steckbrief wieder auf und steckte ihn in sein Hemd zurück.
Miranda nickte langsam.
»Keine Angst, wir haben sie sicher bald geschnappt. Sie kann nicht weit gekommen sein, sie ist verletzt. Du solltest trotzdem hinter mir abschließen, falls sie hier noch irgendwo herumschleicht.« Er legte eine Hand auf ihren Oberarm und drückte ihn kurz. Erst jetzt fiel ihm ihr seltsames Gewand auf.
»Was ist denn das Abscheuliches?« Er wies auf den Mantel.
»Hm?« Miranda sah an sich hinunter. »Oh, den habe ich . . . auf dem Dachboden gefunden.«
»Stinkt ja furchtbar.« Zack verzog die Nase, wie sie selbst es vor kurzem erst getan hatte.
»Ja, ich weiß. Aber er ist schön warm. Vielleicht behalte ich ihn.« Ihre Hände fuhren gedankenverloren über den groben Stoff.
»Du solltest ihn verbrennen.«
Miranda brachte ein kleines Lächeln zustande.
Zack öffnete die Tür und trat wieder hinaus in den Schatten hinterm Haus. »Schließ ab!«
»Ja, mach’ ich. Danke, Zack, dass du vorbeigeschaut hast.«
»Gern geschehen.«
Er blieb vor der Tür stehen, bis er den Schlüssel im Schloss drehen hörte, und machte sich dann auf die Suche nach dem Sheriff.
Er fand ihn bei Lou an der Bar. Sheriff Ryan befragte den Barkeeper. Als er Zack an der Tür bemerkte, bedankte er sich bei dem Mann mit den schütteren Haaren und ging zu seinem Kollegen. »Hat Mrs. Lewis irgend etwas gesehen?«
»Sie sagt, nein. Sie wollte ein Interview, das die Fremde nicht geben wollte, und ist zur Hintertür raus.«
Sie verließen gemeinsam den Saloon und gingen hinüber zum Büro des Sheriffs.
»Ich glaube, dass sie etwas verbirgt«, deutete Zack an.
Der Sheriff sah ihn prüfend an. »Miranda Lewis ist ein kluges Mädchen. Wenn sie in Gefahr gewesen wäre, hätte sie Ihnen ein Zeichen gegeben.«
»Und wenn sie das gar nicht wollte?« Zack hatte ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. BJ Jackson war den Miles’ bekannt, also wahrscheinlich auch Miranda. Sie hatte ihm erzählt, dass sie jemanden engagiert hatte, um ihren Vater zu überprüfen. Miles hatte zwar gesagt, dass er sich um den Mann gekümmert hätte, aber was, wenn Miranda BJ ein ähnliches Angebot gemacht hatte und sie jetzt versteckte?
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Nichts.«
Die beiden Männer sahen einander an. Es war kein freundlicher Blick. Ryan wusste, dass Thomson für Miles arbeitete und dass er selbst ebenfalls überwacht wurde. Nicht, dass Miles jemals Probleme mit Ryan gehabt hätte, aber der letzte Sheriff war ein Problem geworden, und Miles wollte diesmal sichergehen.
»Ich werde die Zeitung auf jeden Fall im Auge behalten.« Zack machte sich auf den Weg die Straße hinunter.
Ryan ging in sein Büro. Er hatte sich den Tatort, das Zimmer, das die Verdächtige bewohnt hatte, angesehen. Ihm waren einige Dinge aufgefallen: Da war der Blutfleck vor dem Bett. Die Fremde war also verletzt, hatte viel Blut verloren. Es war schon erstaunlich, dass sie dennoch ihren Gegner mit einem einzigen Schuss niederstrecken konnte. Einem Schuss ins Herz. Außerdem war da die Frage, wo sie sich versteckt hielt. Sie selbst war spurlos verschwunden, aber ihr Pferd hatte angebunden vor dem Saloon gestanden. Es war kaum denkbar, dass sie die Stadt zu Fuß verlassen hatte. Ryan hatte schon vor Zacks Andeutung an Miranda gedacht, konnte sich aber nicht vorstellen, was für einen Vorteil die kleine Lewis sich dadurch versprach. Eine Story? Die hatte sie auch so. Das Interview? Nein, da musste mehr dahinterstecken. Und wenn die Fremde Miranda tatsächlich gezwungen hatte, sie zu verstecken? Aber dann hätte sie nicht mit Zack sprechen können. Das alles war mehr als seltsam. Ryan machte sich seine eigenen Gedanken dazu, ohne den Hilfssheriff einzuweihen. Er hatte schon früh erkannt, dass man in dieser Stadt länger lebte, wenn man einfach den Mund hielt.
Miles würde sich dieser Sache annehmen, und der Sheriff war ganz gewiss nicht der Mann, der ihn davon abhalten würde.
Nachdem Zack gegangen war, sank Miranda auf die Knie. Sie hatte einen Sheriff getötet, einen Mann des Gesetzes. Was sollte sie jetzt tun?
Miranda schaute auf die Tür, die in die Abstellkammer führte. Es hatte nicht auf dem Steckbrief gestanden, weshalb die Dunkle gesucht wurde, aber wenn man von der Höhe der Belohnung ausging, konnte es sich nur um Mord handeln.
»Oh Gott, sie hat ihre Waffen noch. Was, wenn sie mich auch tötet?«
Das würde sie nie tun! Sie war sich nicht sicher, woher diese überzeugende innere Stimme kam, aber sie vertraute ihr. Ihre Instinkte hatten sie noch nie betrogen.
Miranda kämpfte gegen den Schock an, stand auf und machte sich wieder auf die Suche nach dem Verbandskasten. Sie fand ihn schließlich in der Abstellkammer unter ein paar Eimern Druckerfarbe. Mit Verbandskasten und Lampe machte sich Miranda wieder auf den Weg zu der Verletzten.
Sie fand sie auf dem Boden liegend vor, die Flasche Whiskey lag neben ihr, fast leer. Das meiste der dunkelbraunen Flüssigkeit hatte sich über den Lehmboden ergossen. Miranda zog den Mantel aus und kniete sich neben die große Frau. Sie stellte die Flasche auf das Fass und entzündete die zweite Lampe. Dann nahm sie die Hand und den Ärmelstoff von der Schusswunde der Fremden.
Wenigstens ist es ein Durchschuss. Dann muss ich nicht auch noch eine Kugel entfernen. Sie begann, das Hemd der Fremden aufzuknöpfen, um besseren Zugang zur Wunde zu bekommen. Sie war ein wenig erstaunt, als sie sah, dass die Fremde nichts unter dem Hemd trug. Kein Korsett, kein Mieder, rein gar nichts.
Miranda sog die Luft scharf ein. Im Licht der beiden Lampen konnte sie alte Narben auf der sonnengebräunten Haut der großen Frau erkennen.
»Scheint nicht die erste Kugel gewesen zu sein, die du abbekommen hast«, murmelte Miranda, während sie den Verbandskasten öffnete.