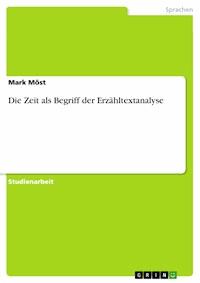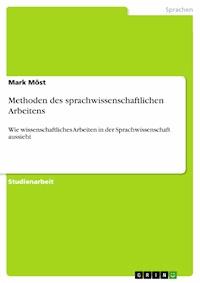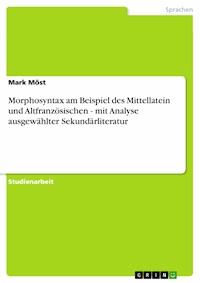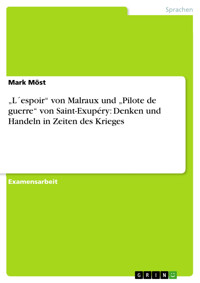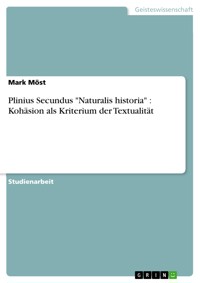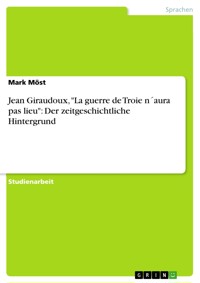29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Didaktik für das Fach Französisch - Landeskunde, Note: 1,0, Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und Sonderschulen) Heidelberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Bildungsplan ist für Französisch als 2. Fremdsprache im Verlauf der Klassen 9/10 die Behandlung einer frankophonen Region vorgesehen. In vielen Fällen läuft dies auf die Behandlung der kanadischen Provinz Québec hinaus, wofür es auch sowohl in Buchform als auch in elektronischer Form zahlreiche Materialien und Hilfen für die Umsetzung des Unterrichts gibt. Das Überseegebiet Französisch-Polynesien hingegen wird im Unterricht sehr selten behandelt, weswegen es weniger gut erschlossen ist als andere landeskundliche Themen und es dafür wenig Material gibt, welches didaktisch aufbereitet wäre; genau hier lag in der Vorbereitung der Unterrichtseinheit eine der größten Herausforderungen, auf die später noch eingegangen wird. Zugleich handelt es sich um eine Region, die auf die Bewohner Europas aufgrund ihrer Exotik eine große Faszination ausübt. Da für die Einheit nur 8 Stunden zur Verfügung stehen, ist die Beschränkung auf zentrale Themen wesentlich; so sollen die Bereiche Geschichte, Geographie, Gesellschaft und Sprache sowie Kultur behandelt werden. Durch die Einbeziehung der Geschichte, wo es um einen groben Überblick über die historische Entwicklung von der Besiedlung Polynesiens über die Eroberungen durch die Europäer bis hin zur Geschichte der Gegenwart geht, erhalten die Schüler Einblick in die Frage, wie sich das heutige Französisch-Polynesien als französisches Überseegebiet historisch in dieser Form herausgebildet hat. Es soll ferner aufgezeigt werden, wie die dortige Gesellschaft strukturiert ist und wie diese Gesellschaft sich kulturell und sprachlich in ihrer besonderen Ausprägung manifestiert. Gerade der letzte Punkt ist insofern von Bedeutung, als damit dem Fach Französisch als einem Fach Rechnung getragen wird, in dem Sprachbewusstsein und damit das Bewusstsein vom Nebeneinander mehrerer Sprachen in einem Gebiet entwickelt werden soll. Andere Bereiche wie z.B. Politik, Wirtschaft oder Verkehr können keine bzw. nur am Rande Berücksichtigung finden, auch literarische Texte werden aus zeitlichen Gründen nicht behandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Vorüberlegungen und Planung
1.1 Begründung der Themenwahl und der behandelten Inhalte
1.2 Wahl der Methoden
1.3 Verwendete Unterrichtsmaterialien
1.4 Beitrag der Unterrichtseinheit zum Kompetenzerwerb
1.5 Bemerkungen zur Klassen- und Unterrichtssituation
2. Durchführung der Unterrichtseinheit
2.1 Einführung: Französisch-Polynesien in Bildern (13.10.2011)
2.1.1 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.1.2 Geplanter Stundenverlauf
2.1.3 Reflexion zum Stundenverlauf
2.2 Allgemeine Informationen / Besondere Orte (14.10.2011)
2.2.1 Didaktisch-methodische Überlegungen
2.2.2 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.2.3 Geplanter Stundenverlauf
2.2.4 Reflexion zum Stundenverlauf
2.3 Geschichte (17.10.2011)
2.3.1 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.3.2 Geplanter Stundenverlauf
2.3.3 Reflexion zum Stundenverlauf
2.4 Gesellschaft und Sprache I (20.10.2011)
2.4.1 Didaktisch-methodische Überlegungen
2.4.2 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.4.3 Geplanter Stundenverlauf
2.4.4 Reflexion zum Stundenverlauf
2.5 Gesellschaft und Sprache II (21.10.2011)
2.5.1 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.5.2 Geplanter Stundenverlauf
2.5.3 Reflexion zum Stundenverlauf
2.6 Als Tourist in Französisch-Polynesien (24.10.2011)
2.6.1 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.6.2 Geplanter Stundenverlauf
2.6.3 Reflexion zum Stundenverlauf
2.7 Kultur und Lebensart (27.10.2011)
2.7.1 Didaktisch-methodische Überlegungen
2.7.2 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.7.3 Geplanter Stundenverlauf
2.7.4 Reflexion zum Stundenverlauf
2.8 Kultur und Lebensart (Abschluss) / Resümee (28.10.2011)
2.8.1 Beitrag zum Kompetenzerwerb
2.8.2 Geplanter Stundenverlauf
2.8.3 Reflexion zum Stundenverlauf
3. Abschließende Reflexion
4. Bibliographie
4.1 Fachdidaktische und pädagogische Literatur
4.2 Arbeitsmaterialien
5. Anhang
1. Vorüberlegungen und Planung
1.1 Begründung der Themenwahl und der behandelten Inhalte
Im Bildungsplan ist für Französisch als 2. Fremdsprache im Verlauf der Klassen 9/10 die Behandlung einer frankophonen Region vorgesehen[1]. In den meisten Fällen läuft dies auf die Behandlung der kanadischen Provinz Québec hinaus, wofür es auch sowohl in Buchform als auch in elektronischer Form zahlreiche Materialien und Hilfen für die Umsetzung des Unterrichts gibt. Das Überseegebiet Französisch-Polynesien hingegen wird im Unterricht sehr selten behandelt, weswegen es weniger gut erschlossen ist als andere landeskundliche Themen und es dafür wenig Material gibt, welches didaktisch aufbereitet wäre; genau hier lag in der Vorbereitung der Unterrichtseinheit eine der größten Herausforderungen, auf die später noch eingegangen wird. Zugleich handelt es sich um eine Region, die auf die Bewohner Europas aufgrund ihrer Exotik eine große Faszination ausübt.
Zweifellos gestaltet sich, wenn man von der Lebenswelt der Schüler[2] ausgeht, die Identifikation mit einer Inselgruppe im Pazifik schwieriger als mit Kanada, der Schweiz oder Belgien; doch gerade in der Begegnung mit etwas ausgesprochen Fremdem und Exotischem kann ein besonderer Reiz liegen, zumal wenn es sich dabei wie im vorliegenden Fall um ein außergewöhnliches Unterrichtsthema handelt. Außerdem fördert „ein kontrastives Vorgehen eine über den Fremdsprachenunterricht hinausweisende Haltung […], die Verschiedenheit toleriert und durch die Entdeckung des Fremden zu einem veränderten Blick auf die eigene Kultur führt.“[3] Der Kontrast verschärft sich noch einmal leicht durch die äußeren Rahmenbedingungen, da die Unterrichtseinheit im Oktober durchgeführt wird, wo die Temperaturen bereits zurückgehen, während in der gleichen Jahreszeit in Französisch-Polynesien die Durchschnittstemperatur noch immer sommerliche Werte erreicht.
Da für die Einheit nur 8 Stunden zur Verfügung stehen, ist die Beschränkung auf zentrale Themen wesentlich; so sollen die Bereiche Geschichte, Geographie, Gesellschaft und Sprache sowie Kultur behandelt werden. Durch die Einbeziehung der Geschichte, wo es um einen groben Überblick über die historische Entwicklung von der Besiedlung Polynesiens über die Eroberungen durch die Europäer bis hin zur Geschichte der Gegenwart geht, erhalten die Schüler Einblick in die Frage, wie sich das heutige Französisch-Polynesien als französisches Überseegebiet historisch in dieser Form herausgebildet hat. Es soll ferner aufgezeigt werden, wie die dortige Gesellschaft strukturiert ist und wie diese Gesellschaft sich kulturell und sprachlich in ihrer besonderen Ausprägung manifestiert. Gerade der letzte Punkt ist insofern von Bedeutung, als damit dem Fach Französisch als einem Fach Rechnung getragen wird, in dem Sprachbewusstsein und damit das Bewusstsein vom Nebeneinander mehrerer Sprachen in einem Gebiet entwickelt werden soll. Andere Bereiche wie z.B. Politik, Wirtschaft oder Verkehr können keine bzw. nur am Rande Berücksichtigung finden, auch literarische Texte werden aus zeitlichen Gründen nicht behandelt.
Insgesamt sind Themen und Inhalte der Unterrichtseinheit so angelegt, dass sie folgenden Kriterien genügen: sie leisten „stets einen Beitrag zur Ausbildung der Wissenskompetenz“ (z.B. Tabelle zur Landeskunde, Stunde 2), „fordern zu interkulturellem Lernen heraus“ und ermöglichen „eine[n] Vergleich der eigenen Identität bzw. der eigenen gesellschaftlichen Realität“ (z.B. Fotovergleich, Stunde 2; Tabelle zur Struktur der Gesellschaft, Stunde 4/5) und „stimulieren eine affektive Reaktion auf Lernerseite“[4] (z.B. Video zum Einstieg, Stunde 1).
1.2 Wahl der Methoden
Eines der Anliegen dieser Arbeit ist der Einsatz verschiedener Sozialformen – Unterricht im Plenum (Frontalunterricht), Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Einzelarbeit[5] –und die Beantwortung der Frage, inwieweit die jeweils gewählte Sozialform sich als geeignet für die erfolgreiche Bearbeitung der Themen und das Erreichen der Lernziele erweist und welche Vor- und Nachteile dabei besonders zu beobachten waren.
Den Auftakt macht eine Einführungsstunde im Unterrichtsgespräch, um mit den Schülern gemeinsam das neue Thema beginnen zu können und allen Schülern die Möglichkeit zu geben, zusammen die gleichen Lernerfahrungen zu machen.
Daneben tritt die Form der Partnerarbeit, die gewählt wurde bei Frage- und Aufgabenstellungen, welche eine deutlich kommunikative Komponente haben. Damit soll geleistet werden, dass die Schüler in den Zweiergruppen „sich wechselseitig informieren, befragen“ – also ein Informationsdefizit direkt ausgleichen – „und beim Lernen in jeder Hinsicht unterstützen“[6], indem sie beim Rollenspiel zur Bewältigung typischer Probleme eines Touristen eine sofortige Rückmeldung zu ihrer Sprachhandlung erhalten und notfalls um Formulierungshilfe bitten können, wenn ihnen die Versprachlichung eines Sachverhaltes nicht gelingt. Die Partnerarbeit wurde als Sozialform ebenfalls bei der Vervollständigung einer Tabelle gewählt, wo der Partner über die jeweils fehlenden Informationen verfügt; es wurde also eine Situation hervorgerufen, in der „die Lernenden entsprechend einem selbst empfundenen oder zumindest als sinnfällig eingeschätzten Mitteilungsbedürfnis […] ein erkanntes Informationsdefizit befriedigen können“[7], wozu die in Form eines Tandembogens[8] angelegte Tabelle anregt.
Wenn auch diese Form des Austauschs von großer Bedeutung ist, so sollen die Schüler im Gegensatz dazu auch in der Lage sein, sich mit Materialien unter bestimmten Gesichtspunkten selbstständig, d.h. ohne fremde Hilfe, auseinanderzusetzen, was in der Sozialform der Einzelarbeit geschieht; dabei „gilt [es], eigene Ressourcen zu entdecken und zu aktivieren“ – in diesem Falle: einen Text in seinen wesentlichen Punkten verstehen zu können, ohne jedes Wort zu verstehen – „und auch das Durchhaltevermögen zu schulen“[9].
Für eine komplexere, mehrteilige Aufgabe mit projektartigem Charakter (Wandplakat) schien in der Vorbereitung die Form der Gruppenarbeit angemessen, bei der die Schüler von der Vielzahl der zu erledigenden Aufgaben jeweils einen Teil übernehmen und diese erledigen, bevor die einzelnen Teile dann auf dem Wege von Aushandlungs- und Abstimmungsprozessen zusammengeführt und so zu einem Ganzen zusammengesetzt werden[10].
Ebenso wie bei der Wahl der Inhalte wurde auch bei der Wahl der Methoden auf einen kontinuierlichen Wechsel geachtet, um einer Monotonie entgegenzuwirken; so wird im Verlauf der Unterrichtseinheit auf bewährte Muster zugegriffen – die verschiedenen Sozialformen sind den Schülern ja auch aus dem sonstigen Unterricht vertraut –, und dennoch ist eine größtmögliche Abwechslung auch in methodischer Hinsicht gewährleistet.
Die verschiedenen Formen der Schüleraktivität decken ein möglichst großes Spektrum ab: Z.B. arbeiten die Schüler in unterschiedlichen Formen an Texten (fragengestütztes Zusammenfassen, Reduktion auf Stichwörter, Rekonstruktion) und nutzen diese als Schreibanlässe (persönliche Stellungnahme als Reaktion[11]), setzen sich daneben auch mit anderen Formen von Informationsquellen (Tabellen) auseinander und werten diese aus, versprachlichen Bildinhalte, präsentieren ihre Ergebnisse vor der Klasse und arbeiten an einem Produkt, das sie auch über die Einheit hinaus an ihre Beschäftigung mit Französisch-Polynesien erinnern wird. Was die Schulung der Teilfertigkeiten der Sprachkompetenz angeht, so dienen die methodischen Entscheidungen zur Förderung aller Teilfertigkeiten mit Ausnahme des Hörverstehens.
1.3 Verwendete Unterrichtsmaterialien
Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien sind so gewählt, dass sie ein gewisses Spektrum abdecken, um dem Schüler Abwechslung zu bieten; ein rein auf Informationstexten basierender Unterricht, in dem der Schüler nur Inhaltsfragen zu diesen Texten beantworten muss, wäre auf Dauer nicht motivationsfördernd. An die Seite von schriftlich vermittelten Informationen tritt aus diesem Grunde ein Videoclip, dessen Bilder in der Einstiegsphase der ersten Stunde die Schüler nochmals auf andere Weise als ein Text oder eine Statistik zu einer (verbalen wie nichtverbalen) Reaktion herausfordern: „Bildinformationen sind wesentlich dichter und einprägsamer als sprachliche Informationen“[12]. Dieser Effekt verstärkt sich noch, da im Clip selbst kaum sprachliche Informationen gegeben werden. Fotos regen in der darauffolgenden Stunde zum Vergleich der Lebenswelt Französisch-Polynesiens und Europas an.
Neben Informationstexten aus einem Reiseführer ist auch die Behandlung eines Interviews mit einer Tahitianerin vorgesehen, so dass die Schüler von einer unmittelbar Betroffenen Informationen gewissermaßen aus erster Hand erhalten. Bei der Auswertung einer tabellarischen Statistik zur Bevölkerung Deutschlands und Französisch-Polynesiens sind die Schüler mit einer nicht-textgebundenen, abstrakten Informationsquelle konfrontiert und müssen diese zu einem Text umgestalten.