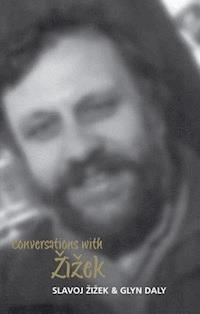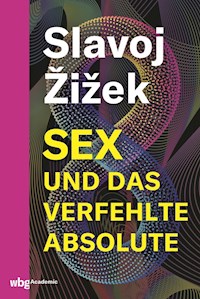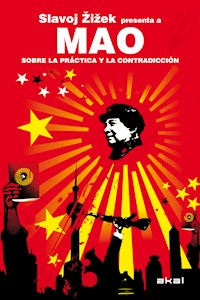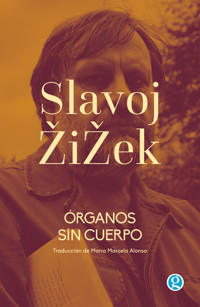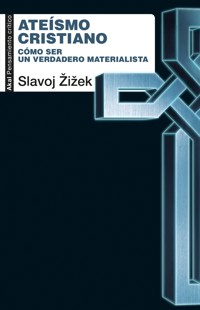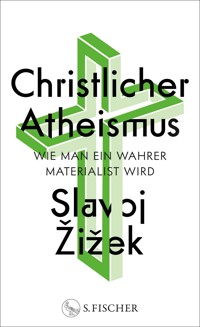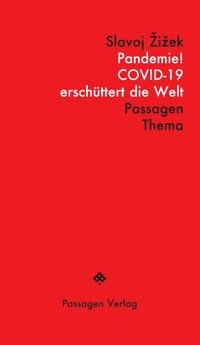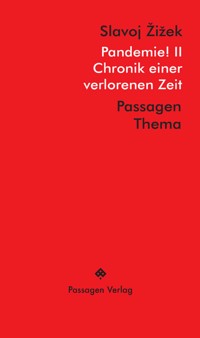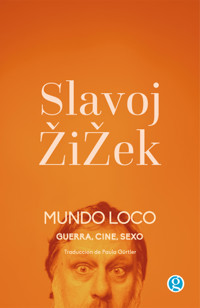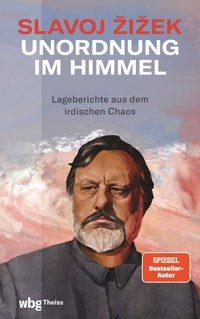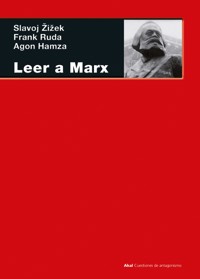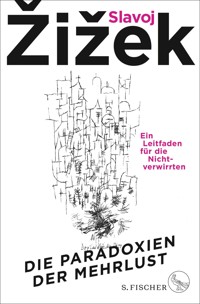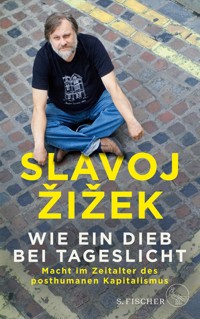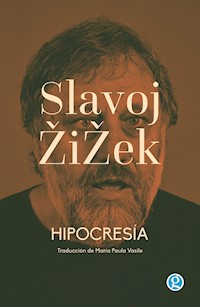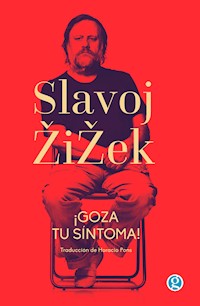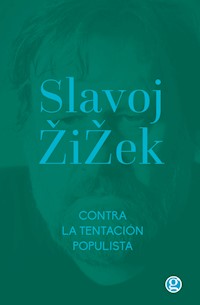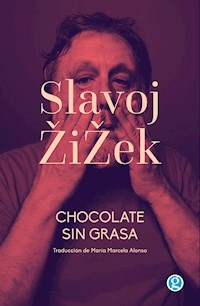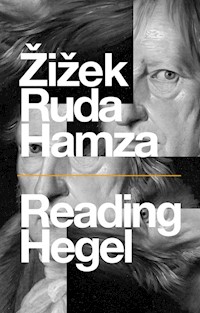9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Psychoanalytiker Jacques Lacan gilt als ein so einflussreicher wie schwieriger Denker. Der bekannte Kulturkritiker Slavoj Žižek hat sich daher die Aufgabe gestellt, Lacan einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dies gelingt ihm, indem er die zentralen Begriffe anschaulich und amüsant mit Hilfe von bekannten Hollywood-Filmen erklärt. Eine Zeittafel sowie eine kommentierte Bibliographie zur weiterführenden Lektüre runden den Band ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Slavoj Žižek
Lacan
Eine Einführung
Über dieses Buch
Der Psychoanalytiker Jacques Lacan gilt als ein so einflußreicher wie schwieriger Denker. Der bekannte Kulturkritiker Slavoj Žižek hat sich daher die Aufgabe gestellt, Lacan einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dies gelingt ihm, indem er die zentralen Begriffe anschaulich und amüsant mit Hilfe von bekannten Hollywood-Filmen erklärt. Eine Zeittafel sowie eine kommentierte Bibliographie zur weiterführenden Lektüre runden den Band ab.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Slavoj Žižek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt Philosophie an der Universität von Ljubljana in Slowenien und an der European Graduate School in Saas-Fee und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Im S.Fischer Verlag sind zuletzt erschienen ›Was ist ein Ereignis?‹ (2014) und ›Das Jahr der gefährlichen Träume‹ (2013).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »How To Read Lacan« im Verlag Granta Publications, England, Series Editor: Simon Critchley
© Slavoj Žižek, 2006
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2008 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Coverfoto: Picture-Alliance / akg-images / Georgette Chadourne
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490432-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung
1. Leere Gesten und Performative: Lacan begegnet dem CIA-Plot
2. Das interpassive Subjekt: Lacan dreht eine Gebetsmühle
3. Von Che vuoi? zur Phantasie: Lacan mit Eyes wide shut
4. Ärger mit dem Realen: Lacan als Zuschauer von Alien
5. Ich-Ideal und Über-Ich: Lacan als Zuschauer von Casablanca
6. »Gott ist tot, aber er weiß es nicht«: Lacan spielt mit Bobok
7. Das perverse Subjekt der Politik: Lacan als Leser von Mohammad Bouyeri
Anhang
Zeittafel
Hinweise für weitere Lektüre
Register
Für Tim,
den jüngsten dialektischen Materialisten der Welt!
Einleitung
»Versuchen wir doch, uns ein wenig diesen ganzen Lärm aus dem Hirn zu spülen.«[1]
Zum hundertsten Jahrestag der Veröffentlichung von Freuds Traumdeutung im Jahr 2000 wurde wieder einmal der Tod der Psychoanalyse triumphal gefeiert; mit dem Fortschritt der Hirnforschung habe sie nun endlich dort ihre Ruhestätte gefunden, wo sie schon immer hingehört hat: in die Rumpelkammer obskurer vorwissenschaftlicher Erforschung verborgener Bedeutungen, neben religiösen Eiferern und Traumdeutern. Wie Todd Dufresne es ausdrückt,[2] lag keine Gestalt in der Geschichte des menschlichen Denkens falscher in bezug auf ihre Grundannahmen – mit der Ausnahme von Marx, wie einige wohl hinzufügen würden. Es war zu erwarten, daß dem berüchtigten Schwarzbuch des Kommunismus,[3] das alle kommunistischen Verbrechen auflistet, im Jahr 2005 das Schwarzbuch der Psychoanalyse folgte,[4] das alle theoretischen Irrtümer und klinischen Täuschungen der Psychoanalyse zusammenträgt. In dieser Ablehnung wenigstens ist jetzt die tiefe Solidarität von Marxismus und Psychoanalyse für jedermann offensichtlich.
An dieser Grabrede ist etwas dran. Als Freud vor einem Jahrhundert seine Entdeckung des Unbewußten in der Geschichte des modernen Europas verorten wollte, entwickelte er die Idee von drei aufeinanderfolgenden Demütigungen des Menschen, den »Narzißtischen Kränkungen«, wie er sie nannte. Zuerst bewies Kopernikus, daß die Erde sich um die Sonne dreht, und vertrieb damit uns Menschen aus dem Zentrum des Universums. Dann bewies Darwin unsere Entstehung durch blinde Evolution und nahm uns dadurch den Ehrenplatz unter den Lebewesen. Als Freud schließlich die vorherrschende Rolle des Unbewußten im psychischen Prozeß enthüllte, zeigte sich, daß unser Ich nicht einmal Herr im eigenen Hause ist. Heute, ein Jahrhundert später, zeichnet sich ein öderes Bild ab: Die neuesten wissenschaftlichen Durchbrüche scheinen dem narzißtischen Bild des Menschen eine Reihe weiterer Demütigungen zuzufügen: unser Geist ist eine reine Rechenmaschine, die Daten prozessiert; unser Gefühl von Freiheit und Autonomie ist die Illusion des Nutzers dieser Maschine. Weit davon entfernt, subversiv zu sein, scheint die Psychoanalyse im Licht der heutigen Hirnforschung selbst dem traditionellen humanistischen Feld zuzugehören, das durch die jüngsten Demütigungen bedroht wird.
Ist die Psychoanalyse heute also wirklich ein Auslaufmodell? Auf drei miteinander verbundenen Ebenen scheint sie es zu sein: 1. auf der Ebene der wissenschaftlichen Erkenntnis, wo das kognitivistisch-neurobiologische Modell des menschlichen Geistes allem Anschein nach das freudianische Modell verdrängt; 2. auf der Ebene der Psychiatrie, wo die psychoanalytische Behandlung rapide an Boden gegenüber Pillen und Verhaltenstherapie verliert; und 3. im sozialen Kontext, wo das Freudsche Bild der Gesellschaft und der sozialen Normen, die die Sexualtriebe des Individuums unterdrücken, nicht mehr länger eine gültige Beschreibung der heutzutage vorherrschenden hedonistischen Freizügigkeit zu sein scheint.
Dennoch könnte sich im Fall der Psychoanalyse der Gedenkgottesdienst als etwas voreilig erweisen, für einen Patienten begangen, der noch ein langes Leben vor sich hat. Im Gegensatz zu den »evidenten« Wahrheiten der Freudkritiker ist es mein Ziel, zu zeigen, daß die Zeit der Psychoanalyse gerade erst gekommen ist. Denn durch die Augen Lacans, durch das, was er seine »Rückkehr zu Freud« genannt hat, erscheinen die wesentlichen Einsichten Freuds endlich in ihrer wahren Dimension. Lacan hat diese Rückkehr nicht als Rückkehr zu dem verstanden, was Freud gesagt hat, sondern als Rückkehr zum Kern der Freudschen Revolution, deren sich Freud selbst nicht voll bewußt war.
Lacan begann seine »Rückkehr zu Freud« mit der linguistischen Deutung des gesamten psychoanalytischen Gebäudes, was in seiner wohl bekanntesten Formel zusammengefaßt ist: »Das Unbewußte ist strukturiert wie eine Sprache.« Nach der vorherrschenden Auffassung ist das Unbewußte der Bereich der irrationalen Triebe, etwas, das dem rationalen bewußten Selbst entgegengesetzt ist. Für Lacan gehört dieser Begriff des Unbewußten zur romantischen Lebensphilosophie und hat nichts mit Freud zu tun. Das Freudsche Unbewußte hat nicht durch die Behauptung, das rationale Selbst sei dem viel größeren Bereich der irrationalen blinden Instinkte untergeordnet, einen solchen Skandal verursacht, sondern weil es deutlich gemacht hat, wie das Unbewußte selbst seiner eigenen Grammatik und Logik folgt: Das Unbewußte spricht und denkt. Das Unbewußte ist nicht das Reservat wilder Triebe, die vom Ich gezähmt werden müssen, sondern der Ort, an dem sich eine traumatische Wahrheit äußert. Darin besteht Lacans Version von Freuds Motto »Wo Es war, soll Ich werden«: nicht »das Ich soll das Es besiegen«, den Ort der unbewußten Triebe einnehmen, sondern »Ich muß es wagen, mich dem Ort meiner Wahrheit zu nähern«. Was mich »dort« erwartet, ist keine tiefe Wahrheit, mit der ich mich identifizieren muß, sondern eine unerträgliche Wahrheit, mit der zu leben ich lernen muß.
Wie unterscheiden sich nun Lacans Ideen von der Hauptströmung der psychoanalytischen Schulen und von Freud selbst? Im Hinblick auf andere Schulen springt zunächst die philosophische Grundhaltung der Lacanschen Theorie ins Auge. Für Lacan ist die Psychoanalyse auf ihrer grundlegendsten Ebene keine Theorie und Technik der Behandlung psychischer Störungen, sondern eine Theorie und Praxis, die die Individuen mit der radikalsten Dimension der menschlichen Existenz konfrontiert. Sie zeigt einem Individuum nicht den Weg, sich den Anforderungen der sozialen Realität anzupassen, sondern erklärt im Gegenteil, wie sich so etwas wie »Realität« zuallererst konstituiert. Sie befähigt einen Menschen nicht nur, die unterdrückte Wahrheit über sich zu akzeptieren, sie erklärt auch, wie sich die Dimension der Wahrheit in der menschlichen Realität zeigt. Aus Lacans Sicht haben pathologische Strukturen wie Neurosen, Psychosen oder Perversionen die Würde fundamentaler philosophischer Haltungen gegenüber der Realität. Wenn ich an einer Zwangsneurose leide, dann färbt diese »Krankheit« meine gesamte Beziehung zur Realität und bestimmt die allgemeine Struktur meiner Persönlichkeit. Lacans Hauptkritikpunkt an anderen psychoanalytischen Zugängen betrifft deren klinische Ausrichtung: Für Lacan besteht das Ziel der psychoanalytischen Behandlung nicht im Wohlbefinden, in einem erfolgreichen Sozialleben oder in persönlicher Erfüllung des Patienten, sondern darin, den Patienten dazu zu bringen, sich mit den elementaren Koordinaten und Blockaden seines Begehrens zu konfrontieren.
In bezug auf Freud fällt als erstes auf, daß der Schlüssel, den Lacan bei seiner »Rückkehr zu Freud« verwendet, von außerhalb des psychoanalytischen Feldes stammt: um den geheimen Schatz von Freud zu heben, nimmt Lacan eine bunte Mischung von Theorien in seinen Dienst, von der Linguistik Ferdinand de Saussures über Claude Lévi-Strauss’ strukturale Anthropologie zur mathematischen Mengenlehre und den Philosophien von Platon, Kant, Hegel und Heidegger. Daraus folgt, daß die meisten von Lacans Schlüsselbegriffen keine Entsprechung in Freuds eigener Theorie haben: Freud erwähnt niemals die Triade aus Imaginärem, Symbolischem und Realem, er redet nie vom »großen Anderen« als der symbolischen Ordnung, er spricht vom »Ich«, nicht vom »Subjekt«. Lacan benutzt diese Begriffe aus anderen Disziplinen als Werkzeuge, um Unterscheidungen zu treffen, die bei Freud schon implizit vorhanden sind, auch wenn er sich ihrer nicht bewußt gewesen ist. Wenn die Psychoanalyse zum Beispiel eine »Redekur« ist, wenn sie pathologische Störungen nur mit Worten behandelt, dann ist sie auf einen bestimmten Begriff von Rede angewiesen. Lacans These ist, daß Freud sich des Begriffs der Rede nicht bewußt war, der in seiner eigenen Theorie und Praxis impliziert ist, und daß wir diesen Begriff nur erschließen können, wenn wir uns auf die Saussuresche Linguistik, die Sprechakttheorie und die Hegelsche Dialektik der Anerkennung beziehen.
Lacans »Rückkehr zu Freud« stellte eine neue theoretische Begründung der Psychoanalyse bereit mit immensen Konsequenzen auch für die analytische Behandlung. Kontroversen, Krisen und sogar Skandale begleiteten Lacan in seiner gesamten Karriere. Er war 1953 nicht nur gezwungen, die Verbindung mit der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung aufzulösen (siehe Zeittafel), sondern verstörte mit seinen provokanten Ideen viele fortschrittliche Denker von kritischen Marxisten bis zu Feministinnen. Auch wenn er von der westlichen akademischen Welt für gewöhnlich als eine Art Postmoderner oder Dekonstruktivist wahrgenommen wird, ragt er weit aus dem Feld heraus, das diese Etiketten bezeichnen. Sein ganzes Leben lang entwuchs er den Etiketten, die seinem Namen angeheftet wurden: Phänomenologe, Hegelianer, Heideggerianer, Strukturalist, Poststrukturalist; kein Wunder, da das hervorstechendste Merkmal seiner Lehre permanente Selbstbefragung ist.
Lacan war ein unersättlicher Leser und Interpret; Psychoanalyse selbst war für ihn eine Methode, Texte zu lesen, seien sie mündlich (die Rede der Patienten) oder schriftlich. Welch besseren Weg gibt es also, Lacan zu lesen, als seine Art des Lesens zu praktizieren, andere Texte mit Lacan zu lesen. Daher wird jedes Kapitel dieses Buchs eine Passage von Lacan mit einem anderen Fragment konfrontieren (aus Philosophie, Kunst, Popkultur und Ideologie). Lacans Position wird durch das Lacansche Lesen anderer Texte erläutert. Ein weiteres Merkmal dieses Buches ist ein umfassender Ausschluß: Es ignoriert beinahe vollkommen Lacans Theorie über dasjenige, was in der psychoanalytischen Behandlung geschieht. Vor allem anderen war Lacan ein Kliniker, und klinische Belange durchziehen alles, was er schrieb und tat. Selbst wenn er Platon, Thomas von Aquin, Hegel oder Kierkegaard liest, versucht er immer ein präzises klinisches Problem zu erhellen. Diese Allgegenwart erlaubt uns aber auch, diesen Aspekt auszuschließen: gerade weil das Klinische überall ist, kann man den Prozeß umgehen und sich statt dessen auf seine Effekte konzentrieren, auf die Art und Weise, wie es alles färbt, was nicht klinisch erscheint – das ist der wahre Test seiner zentralen Stellung.
Anstatt Lacan durch seinen historischen und theoretischen Kontext zu erklären, wird dieses Buch auf Lacan selbst zurückgreifen, um unsere soziale und triebhafte Lage zu erklären. Anstatt objektive Urteile zu äußern, ist es einer parteiischen Lektüre verpflichtet – es ist Teil der Lacanschen Theorie, daß jede Wahrheit parteiisch ist. In seiner Freudlektüre veranschaulicht Lacan selbst die Kraft eines solchen parteiischen Ansatzes. In seinen Beiträgen zum Begriff der Kultur bemerkt T.S. Eliot, daß es Momente gibt, in denen die einzige Wahl die zwischen Sektierertum und Unglaube ist, daß es kritische Augenblicke gibt, in denen der einzige Weg, eine Religion am Leben zu erhalten, in einer sektiererischen Abspaltung vom Hauptkörper besteht. Durch seine sektiererische Abspaltung, indem er sich von dem verwesenden Leichnam der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung abschnitt, hielt Lacan die Freudsche Lehre lebendig. Fünfzig Jahre später ist es nun an uns, das gleiche mit Lacan zu tun.[5]
Fußnoten
[1]
Jacques Lacan, Die Ethik der Psychoanalyse, Das Seminar Buch VII, Weinheim/Berlin: Quadriga 1996, S. 301 [die englische Übersetzung dieses Fragments lautet: »Let’s try to practise a little brain-washing on ourselves«, Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, London: Routledge 1992, S. 307; A.d.Ü.]
[2]
Siehe Todd Dufresne, Killing Freud: 20th Century Culture and the Death of Psychoanalysis, London: Continuum books 2004.
[3]
Le livre noir du communisme, Paris: Robert Lafont 2000.
[4]
Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud, Paris: Athe`nes 2005.
[5]
Ein letzter Hinweis: Da dieses Buch eine Einführung in Lacan ist, die sich auf einige seiner grundlegenden Begriffe konzentriert, und da dieses Thema im Fokus meiner eigenen Arbeiten der letzten Dekade steht, gab es keine Möglichkeit, eine gewisse »Kannibalisierung« meiner bereits erschienenen Bücher zu vermeiden. Um dies zu kompensieren, habe ich großen Wert darauf gelegt, jeder dieser geliehenen Passagen hier eine neue Wendung zu geben.
1.Leere Gesten und Performative: Lacan begegnet dem CIA-Plot
Beginnt mit den Gaben [der Danaer] oder eher mit den Losungsformeln, die ihren heilsmächtigen Unsinn dazu tun, die Sprache als Gesetz? Diese rituellen Gaben nämlich sind bereits Symbole in dem Sinne, in dem ›Symbol‹ einen Vertrag bedeutet, und ferner, weil sie zunächst Signifikanten eines Vertrages sind, den sie als Signifikat begründen; denn es ist augenfällig, daß die Gegenstände des symbolischen Tauschs – Gefäße, die leer bleiben müssen, Schilde, die zum Tragen zu schwer sind, Garben, die vertrocknen, Lanzen, die man in den Boden steckt – nicht für den Gebrauch bestimmt und ihrer Fülle wegen sogar überflüssig sind.
Ist diese Neutralisierung des Signifikanten schon das ganze Wesen der Sprache? Wäre dem so, fände man einen Anhaltspunkt am Beispiel der Wasserschwalben in dem Fisch, den sie während ihres Zuges von Schnabel zu Schnabel wandern lassen. Wenn wir das in Übereinstimmung mit dem Ethologen als ein Instrument ansehen, die Gruppe wie bei einem Fest in eine reigenförmige Bewegung zu bringen, so könnte man darin mit voller Berechtigung ein Symbol erkennen.[6]
Mexikanische Seifenopern werden in einem so rasanten Tempo gedreht (jeden Tag läuft eine fünfundzwanzigminütige Folge), daß die Schauspieler nicht einmal mehr das Drehbuch bekommen, um ihren Text im voraus zu lernen; sie tragen kleine Empfänger im Ohr, die ihnen sagen, was zu tun ist, und sie lernen, das zu spielen, was sie hören (»jetzt gib ihm eine Ohrfeige, und sag ihm, daß du ihn haßt! Dann umarme ihn! …«). Dieses Verfahren stellt uns ein Bild für das zur Verfügung, was Lacan nach allgemeiner Auffassung mit dem »großen Anderen« meint. Die symbolische Ordnung, die ungeschriebene Verfassung der Gesellschaft, ist die zweite Natur von jedem sprechenden Wesen: Sie ist hier und leitet und kontrolliert meine Handlungen; sie ist das Meer, in dem ich schwimme, doch sie bleibt letzten Endes unzugänglich – ich kann sie nie vor mich hinstellen und zu fassen bekommen. Es ist, als würden wir, die Subjekte der Sprache, wie Puppen reden und interagieren, als würden unser Reden und unsere Gesten von einer namenlosen, alles durchdringenden Kraft bestimmt. Heißt das, daß wir menschlichen Individuen Lacan zufolge bloße Epiphänomene sind, Schattenwesen ohne eigene Macht, daß unsere Selbstwahrnehmung als autonom und frei Handelnde eine Art User-Illusion ist, die uns für die Tatsache blind macht, daß wir Werkzeuge in den Händen des großen Anderen sind, der sich hinter dem Bildschirm versteckt und die Strippen zieht?
Viele Eigenschaften des großen Anderen gehen indes in diesem vereinfachenden Begriff verloren. Für Lacan wird die Realität menschlicher Wesen durch drei miteinander verbundene Ebenen konstituiert: das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Diese Triade kann ganz hübsch durch das Schachspiel illustriert werden. Die Regeln, denen man folgen muß, um Schach zu spielen, sind seine symbolische Dimension: Vom rein symbolischen Standpunkt aus ist der »Springer« nur durch die Züge definiert, die diese Figur ausführen kann. Diese Ebene unterscheidet sich deutlich von der imaginären, nämlich der Art, in welcher die verschiedenen Figuren geformt sind und durch ihre Namen charakterisiert werden (König, Dame, Springer), und es ist leicht, sich ein Spiel mit den gleichen Regeln vorzustellen, aber mit einem anderen Imaginären, in welchem diese Figuren »Bote« oder »Spaziergänger« oder wie auch immer heißen. Schließlich ist die gesamte Anordnung von kontingenten Begleitumständen, welche den Verlauf des Spiels berühren, real: die Intelligenz der Spieler, die unvorhersehbaren Eingriffe, die einen Spieler aus der Fassung bringen oder das Spiel unmittelbar abbrechen können.
Der große Andere operiert auf einer symbolischen Ebene. Woraus ist dann diese symbolische Ordnung zusammengesetzt? Wenn wir sprechen (oder zuhören), interagieren wir nicht bloß mit anderen; unsere Redeaktivität gründet in unserem Akzeptieren von und Vertrauen in ein komplexes Netzwerk von Regeln und anderen Voraussetzungen. Zunächst gibt es die Regeln der Grammatik, die ich blind und spontan beherrschen muß: Wenn ich diese Regeln die ganze Zeit über in meinem Geist präsent halten müßte, würde mein Reden zusammenbrechen. Dann gibt es den Hintergrund einer gemeinsamen Lebenswelt, der mich und meinen Partner beim Gespräch dazu befähigt, uns zu verstehen. Die Regeln, denen ich folge, sind durch eine tiefe Kluft gekennzeichnet: Es gibt Regeln (und Bedeutungen), denen ich blind folge, aus Gewohnheit, die ich mir aber zumindest teilweise bewußtmachen kann, wenn ich über sie nachdenke (wie z.B. die gewöhnlichen Grammatikregeln). Und es gibt Regeln, denen ich folge, Bedeutungen, die mich – unwissentlich – umtreiben (wie z.B. unbewußte Verbote). Schließlich gibt es auch Regeln und Bedeutungen, von denen ich weiß, aber nicht zeigen darf, daß ich sie kenne – schmutzige oder obszöne Anzüglichkeiten, die man mit Schweigen übergeht, um den sauberen Schein zu wahren.
Dieser symbolische Raum ist wie ein Metermaß, mit Hilfe dessen ich mich vermessen kann. Daher kann der große Andere in einem einzigen Urheber personifiziert oder verdinglicht werden: als »Gott«, der vom Jenseits über mich und über alle Individuen wacht, oder als die Idee, der ich verbunden bin (Freiheit, Kommunismus, Nation) und für die ich mein Leben zu geben bereit bin. Wenn ich spreche, bin ich niemals ein bloßer »kleiner anderer« (Individuum), der mit anderen »kleinen anderen« interagiert: der große Andere muß immer dabeisein. Dieser inhärente Bezug auf den Anderen ist der Gegenstand eines billigen Witzes über einen armen Bauern, der Schiffbruch erlitten hat und sich auf einer Insel mit, sagen wir, Cindy Crawford ausgesetzt findet. Nachdem sie Sex gehabt haben, fragt sie ihn, wie es war; er antwortet »großartig«, aber er habe noch eine kleine Bitte, um seine Befriedigung vollkommen zu machen: ob sie sich wie sein bester Freund anziehen könne, mit Hosen und einem angemalten Schnurrbart im Gesicht? Er versichert ihr, daß er kein heimlicher Perverser sei, sie werde schon sehen, wenn sie die Bitte erfüllt. Als sie es tut, kommt er auf sie zu, verpaßt ihr einen Stoß in die Rippen und sagt mit der Anzüglichkeit männlicher Komplizenschaft: »Weißt du, was mir passiert ist? Ich hatte gerade Sex mit Cindy Crawford!« Dieser Dritte, der immer als Zeuge anwesend ist, straft die Möglichkeit unverdorbener, unschuldiger und geheimer Lust Lügen. Sex ist immer ein bißchen exhibitionistisch und beruht auf dem Blick eines anderen.
Trotz seiner fundamentalen Macht ist der große Andere fragil, substanzlos, regelrecht virtuell in dem Sinn, daß sein Status der einer subjektiven Unterstellung ist. Er existiert nur insoweit, als Subjekte so handeln, als ob es ihn gäbe. Sein Status ist dem eines ideologischen Beweggrunds wie Kommunismus oder Nation vergleichbar: Er ist die Substanz der Individuen, die sich in ihr erkennen, die Grundlage ihrer gesamten Existenz, der Bezugspunkt, der den äußersten Bedeutungshorizont bereitstellt, etwas, für das diese Individuen ihr Leben zu geben bereit sind; doch das einzige, das wirklich existiert, sind diese Individuen und ihre Aktivität, so daß diese Substanz nur in dem Sinn real ist, in dem diese Individuen an sie glauben und nach ihr handeln. Wegen dieses virtuellen Charakters des großen Anderen gelangt ein Brief immer an seinen Bestimmungsort, wie Lacan dies am Ende seines »Seminars über den entwendeten Brief« formuliert. Man kann sogar sagen, daß der einzige Brief, der vollständig und tatsächlich seinen Bestimmungsort erreicht, derjenige Brief ist, der nicht abgeschickt wird – sein wahrer Adressat ist nicht ein anderer aus Fleisch und Blut, sondern der große Andere selbst:
»Das Aufbewahren des nicht abgesandten Briefes ist seine einhalt-gebietende Eigenschaft. Weder das Schreiben noch das Senden ist bemerkenswert (wir fertigen oft Entwürfe von Briefen an und verwerfen sie), sondern die Geste des Einbehaltens der Botschaft, wenn wir nicht die Absicht haben, sie zu verschicken. Doch indem wir den Brief behalten, ›senden‹ wir ihn gewissermaßen trotzdem. Wir geben unsere Idee nicht preis oder geben sie als töricht oder unwürdig auf (wie wenn wir einen Brief zerreißen), wir geben ihr im Gegenteil ein besonderes Vertrauensvotum ab. Wir sagen in Wirklichkeit damit, daß unsere Idee zu wertvoll ist, um sie dem Blick des aktuellen Empfängers anzuvertrauen, der ihren Wert möglicherweise gar nicht erfaßt. Daher ›senden‹ wir ihn jemand entsprechendem in der Phantasie, auf dessen verständige und wertschätzende Lektüre wir unbedingt zählen können.«[7]
Ist es nicht mit dem Symptom im Freudschen Sinne genau das gleiche? Wenn ich nach Freud ein Symptom entwickle, dann produziere ich eine kodierte Botschaft über meine innersten Geheimnisse, meine unbewußten Begierden und Traumata. Der Adressat meines Symptoms ist nicht ein anderes menschliches Wesen: Bevor nicht ein Analytiker mein Symptom entziffert, gibt es niemanden, der seine Botschaft lesen kann. Wer ist dann aber der Adressat des Symptoms? Der einzig verbleibende Kandidat ist der virtuelle große Andere. Dieser virtuelle Charakter des großen Anderen bedeutet, daß die symbolische Ordnung nicht eine Art spirituelle Substanz ist, die unabhängig von den Individuen existiert, sondern daß sie etwas ist, das durch deren kontinuierliche Aktivität aufrechterhalten wird. Dennoch ist die Herkunft des großen Anderen immer noch unklar. Wie kommt es, daß wenn Individuen Symbole austauschen, sie nicht nur interagieren, sondern sich immer auch auf den virtuellen großen Anderen beziehen? Wenn ich über die Meinung anderer Leute rede, ist das niemals nur eine Angelegenheit dessen, was ich, Sie oder andere Individuen denken, sondern immer auch dessen, was das unpersönliche »man« denkt. Wenn ich eine bestimmte Anstandsregel verletze, dann tue ich nicht einfach etwas, das die Mehrheit der anderen nicht tut – ich tue etwas, das »man« nicht tut.
Das führt uns zu der dichten Passage zurück, mit der wir dieses Kapitel eröffnet haben: Dort schlägt Lacan nichts weniger als eine Darstellung der Entstehung des großen Anderen vor. Sprache ist für Lacan ein Geschenk, das für die Menschheit so gefährlich ist wie das Pferd für die Trojaner: Es bietet sich uns zur freien Verfügung an, aber haben wir es einmal angenommen, dann kolonisiert es uns. Die symbolische Ordnung entsteht aus einem Geschenk, einem Angebot, das seinen Inhalt als neutral ausweist, um ihn als Geschenk darzustellen: Wenn ein Geschenk angeboten wird, dann ist nicht sein Inhalt von Belang, sondern die Verbindung zwischen dem Schenkenden und dem Empfänger, die hergestellt wird, wenn der Empfänger das Geschenk annimmt. Lacan läßt sich hier sogar auf ein wenig Spekulation über das Verhalten von Tieren ein: die Seeschwalben, die einen erbeuteten Fisch von Schnabel zu Schnabel reichen (als ob sie klarmachen wollten, daß die Verbindung, die auf diese Weise hergestellt wird, viel wichtiger ist als die Frage, wer am Ende den Fisch behalten und essen wird), sind gewissermaßen an einer Art symbolischer Kommunikation beteiligt.
Jeder Verliebte kennt das: Wenn ein Geschenk für die geliebte Person meine Liebe symbolisieren soll, dann muß es nutzlos sein, überflüssig in seiner Fülle – nur auf diese Weise, wenn der Gebrauchswert aufgehoben ist, kann es meine Liebe symbolisieren. Die menschliche Kommunikation ist durch eine unreduzierbare Reflexivität gekennzeichnet: Jeder Akt der Kommunikation symbolisiert gleichzeitig die Tatsache der Kommunikation. Roman Jacobson hat dieses grundlegende Geheimnis der dem Menschen eigenen symbolischen Ordnung »phatische Kommunikation« genannt: Die menschliche Rede transportiert niemals nur eine Botschaft, sie bekräftigt immer auch auf selbstreflexive Weise den grundlegenden symbolischen Pakt zwischen den kommunizierenden Subjekten.
Die elementarste Ebene des symbolischen Austauschs ist eine sogenannte »leere Geste«, ein Angebot, das gedacht oder gemacht worden ist, damit es zurückgewiesen wird. Brecht hat das in seinem Stück Der Jasager prägnant zum Ausdruck gebracht, in dem ein Junge gebeten wird, aus freien Stücken in das einzuwilligen, was sowieso sein Schicksal sein wird (nämlich in das Tal geworfen zu werden); wie sein Lehrer erklärt, ist es üblich, das Opfer zu fragen, ob es in sein Schicksal einwilligt, aber es ist ebenfalls üblich, daß das Opfer ja dazu sagt. Zu einer Gesellschaft zu gehören schließt immer ein paradoxes Moment ein, an dem jeder von uns aufgefordert ist, aus freien Stücken als Ergebnis unserer Wahl anzunehmen, was uns sowieso auferlegt wird (wir müssen