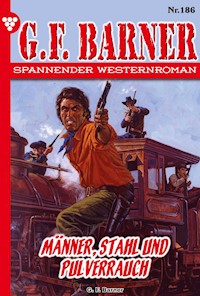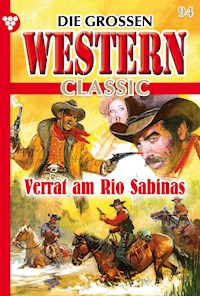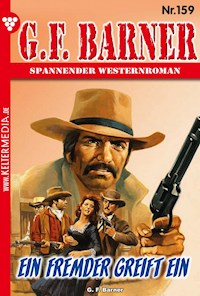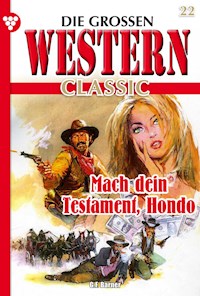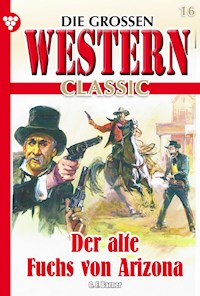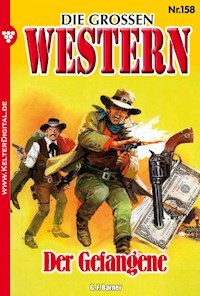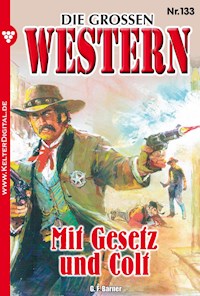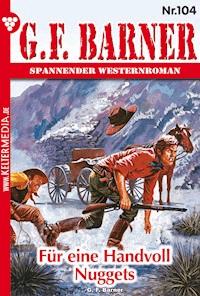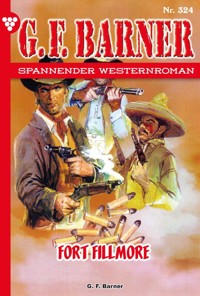Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Mitch Sheldon legt sich mit aller Gewalt auf den langen Hebelarm aus Holz und drückt das Stauwehrbrett mit Macht in die Höhe. Er beobachtet danach aus schmalen Augen das durch die Lücke in den starken und noch abgestützten Brettern schießende Wasser des Little Pleasant Baches. Sein Bruder Gregg hat den kleinen Bach, der in den südlichen Arm des Mokelumne-Flusses fließt, so getauft. Was bin ich doch für ein verrückter Kerl, denkt Mitch und starrt auf das murmelnde, gurgelnde Wasser. Ich sehe dem Wasser zu und habe doch genug mit der Kuh zu tun. Dieses gescheckte Rabenaas brüllt nun schon drei Tage und will verdammt nicht das Maverick bekommen. Ich werde mal hingehen und Gregg ablösen. Er schrickt zusammen, als sich Mary, die Frau seines Bruders, nähert und ihn anspricht. »Mitch, du sollst gleich mal zu Gregg kommen«, sagt sie hastig. »Es scheint, als ob die Gescheckte kalben will. Nun, vielleicht ist es wieder blinder Alarm, genau wie mit den Banditen.« Mitch muss den Schieber noch eine Weile offen lassen und hakt die Schieberstange in eine der Ösen der Kette ein. Jetzt kann das Wasser fließen und genau durch den Trog bis auf die Kuhweide rinnen. »Vielleicht war es kein blinder Alarm«, sagt er leise. »Sie könnten hier in der Gegend sein. Wenn sie wirklich von Heasts Schaf-Ranch dreißig Schafe gestohlen und den Schafhirten ermordet haben, dann könnten sie noch hier sein. »Hmmm«, macht Mitch und betrachtet sie lächelnd. »Mary, wenn sie zu uns kommen, dann stemmst du die Hände in die Hüften und redest mit ihnen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 115–
Land der Desperados
G.F. Barner
Mitch Sheldon legt sich mit aller Gewalt auf den langen Hebelarm aus Holz und drückt das Stauwehrbrett mit Macht in die Höhe. Er beobachtet danach aus schmalen Augen das durch die Lücke in den starken und noch abgestützten Brettern schießende Wasser des Little Pleasant Baches. Sein Bruder Gregg hat den kleinen Bach, der in den südlichen Arm des Mokelumne-Flusses fließt, so getauft.
Was bin ich doch für ein verrückter Kerl, denkt Mitch und starrt auf das murmelnde, gurgelnde Wasser. Ich sehe dem Wasser zu und habe doch genug mit der Kuh zu tun. Dieses gescheckte Rabenaas brüllt nun schon drei Tage und will verdammt nicht das Maverick bekommen. Ich werde mal hingehen und Gregg ablösen.
Er schrickt zusammen, als sich Mary, die Frau seines Bruders, nähert und ihn anspricht.
»Mitch, du sollst gleich mal zu Gregg kommen«, sagt sie hastig. »Es scheint, als ob die Gescheckte kalben will. Nun, vielleicht ist es wieder blinder Alarm, genau wie mit den Banditen.«
Mitch muss den Schieber noch eine Weile offen lassen und hakt die Schieberstange in eine der Ösen der Kette ein. Jetzt kann das Wasser fließen und genau durch den Trog bis auf die Kuhweide rinnen.
»Vielleicht war es kein blinder Alarm«, sagt er leise. »Sie könnten hier in der Gegend sein. Wenn sie wirklich von Heasts Schaf-Ranch dreißig Schafe gestohlen und den Schafhirten ermordet haben, dann könnten sie noch hier sein.
»Hmmm«, macht Mitch und betrachtet sie lächelnd. »Mary, wenn sie zu uns kommen, dann stemmst du die Hände in die Hüften und redest mit ihnen so, wie du manchmal mit Gregg sprichst. Wetten, dass sie dann Reißaus nehmen?«
»Mitch Sheldon«, erwidert sie und zwinkert heftig mit den Lidern. »Du bist ein schlimmer Mensch, denn du machst dich dauernd über mich lustig. Aber wir wohnen hier sehr einsam, es wäre der ideale Ort für einen Überfall.«
»Könnte sein, aber ich fürchte mich nicht vor ihnen. Sind die Kinder schon im Bett?«
»Aber sicher. Und weißt du, was sie heute gebetet haben?«
Mitch lächelt leise, denn seitdem der Geistliche von Mokelumne Hill selbst unter die Goldsucher gegangen ist, hilft Mitch manchmal ein bisschen aus.
»Nun, was haben sie gebetet?«
»Lieber Gott, beschütze und beschirme uns vor Feuer, Not und Hochwasser, vor Hunger und allen anderen Übeln. Und beschütze uns vor dem blutigen Joaquin Murieta!«
»Was?«, fragt Mitch verstört. »Wer hat ihnen das beigebracht?«
»Gregg, dein ehrenwerter Bruder! Er hat nach dem Abendbrot mit den Kindern gesprochen und dabei auch von Murieta geredet. Dein Neffe Mike wollte es ganz genau wissen. Und Gregg hat ihm gesagt, dass Murieta mit seinem Gesindel eine blutige, verkommene Gesellschaft wäre. Ich weiß nicht, aber Mike und Anne haben sich das sicher abgesprochen! Was sagst du dazu?«
»Gregg hat recht!«
»Aber deshalb muss er es doch nicht den Kindern sagen.«
»Je früher sie zwischen Gut und Böse unterscheiden lernen, desto besser wird es für sie sein. Sicher, er hätte vielleicht nicht diese Ausdrücke gebrauchen sollen.«
Sie sieht ängstlich auf die Biegung des Baches und das dichte Gestrüpp dort. Mary Sheldon ist eine etwas ängstliche Natur.
»Tatsächlich«, grinst Mitch Sheldon. »Drei finstere Murieta-Desperados, Messer zwischen den ellenlangen Zähnen und Augen so groß wie Mühlräder. He, wo willst du hin?«
Sie saust japsend davon, und Mitch ist sie los. An seiner Ruhe prallt selbst Marys gelegentliche Zanksüchtigkeit ab.
Mitch seufzt etwas, als er an Greggs Einstellung zu den Banditen denkt, die Gregg liebend gern alle aufhängen würde. Gregg redet nur von »verdammten, blutigen und dreckigen Desperados, die man vierteilen oder rädern sollte«. Er ist zu sehr ein Mann des Rechts, um auch nur einen einzigen Gedanken der Gnade an die Banditen zu verschwenden.
Mitch hingegen ist ein Mann, der in erster Linie den Menschen sieht und immer nach den Beweggründen für die Tat eines Mannes fragt. Gregg wiederum verurteilt alles pauschal, was nicht in den Rahmen des Gesetzes passt. Sie haben sich deshalb auch schon reichlich oft gestritten. Obwohl Gregg vier Jahre älter als Mitch ist, beugt er sich meist den Ansichten seines jüngeren Bruders.
Nachdenklich hockt sich Mitch auf das Stauwehr und starrt in das Wasser, das laut unter ihm durch den offenen Schieber gurgelt.
Das Geräusch ist so laut, dass er außer ihm nichts hört.
Er schrickt erst zusammen, als es links hinter ihm an den Büschen laut planscht.
Jetzt dreht er sich um, schrickt zum zweiten Mal an diesem Abend zusammen und sieht – er sitzt ja etwas tiefer auf dem Wehr – das Pferd groß und gewaltig hinter sich aufragen.
Mitch fühlt nur für den Bruchteil einer Sekunde den Schreck. Es ist seltsam, aber er erinnert sich in dieser Minute an den spaßhaft gemeinten Ausdruck, mit dem er Mary ins Haus jagte.
Hinter ihm, einige Schritte entfernt, steht das Pferd mitten im Bachlauf. Der Reiter ist zumindest genauso erschrocken wie Mitch, denn er ist aus den Büschen gekommen und hat Mitch mit Sicherheit nicht eher entdecken können.
Der Mann, ein dunkelhaariger totenbleicher Mensch mit übernatürlich geweiteten Augen, hat die linke Hand vor die rechte Brustseite gepresst. Der schwache Mondschein, der über dem Land liegt, zeigt mehr als deutlich das Blut an seiner Hand.
Der dunkle Schnurrbart des Mannes hebt sich gegen die Blässe des Gesichtes wie ein scharfer, leicht nach unten gekrümmter Strich ab.
Im gleichen Augenblick, Mitch steht langsam auf, nimmt der Mann die rechte Hand von den Zügeln fort und blitzschnell nach unten. Vielleicht fällt sie auch nur schlaff herab. In jedem Fall steht Mitch aufrecht vor dem Pferd und dem Mann, da kommt auch schon die Hand über dem Pferdehals hoch, und in der Hand liegt ein langläufiger, sechsschüssiger Wesson & Leavit-Revolver vom Kaliber achtundvierzig.
Ehe der Fremde aber den Revolver ganz auf Mitch gerichtet hat, verdreht er plötzlich die Augen, stößt einen erstickten Seufzer aus und sinkt nach vorn.
»So was«, sagt Mitch bestürzt. »Ist der Bursche verrückt? Ich habe ihm doch nichts getan, und doch will er auf mich schießen? Halt, Bursche, langsam, es sollen schon Leute in Pfützen ertrunken sein, und dieses ist ein Bach von drei Fuß Tiefe!«
Mitch, groß, hager und sehnig, ein Mann, der sehr schnell laufen kann, springt mit einem wilden Satz vorwärts und unter dem Hals des zurückweichenden Pferdes durch.
Genau über ihm neigt sich der Mann im nächsten Augenblick auch schon tief nach unten, seine beiden Arme tasten nach einem Halt, finden aber keinen. Er verliert den Revolver, der knapp vor Mitch ins Wasser klatscht. Mitch selbst steht auch bis an die Oberschenkel im Bach, streckt die Arme aus und fängt den Mann vorsichtig auf. Jetzt, als er ihn so unmittelbar vor sich hat, fallen ihm sofort einige Dinge auf.
Der Fremde trägt eine breite Schärpe statt eines Revolvergurtes. In der Schärpe steckt ein breites Bowieknife, neben dem noch eine doppelläufige Pistole mit einem Kolben, dessen Griffschalen aus purem Silber zu sein scheinen. Außerdem trägt der Mann eine jener ärmellosen offenen Westen, die dazu noch reich bestickt ist. Von der linken Schulter, unter der Weste durch, läuft ein breiter Patronengurt, der voller Patronen steckt.
»Donner, ist der Bursche leicht«, stellt Mitch Sheldon verwundert fest und hält den schlanken Mann sicher in den Armen. »Scheint ein Mexikaner zu sein, den eine ziemlich böse Verwundung erwischt hat.«
Er watet durch den Bach an das Ufer zurück, das Pferd folgt ihm bereitwillig und prustet neben ihm.
Mitch, nicht unerfahren genug, um dem Mann noch eine Waffe zu lassen und gewarnt durch den ersten Zusammenstoß mit ihm, zieht ihm Messer und Pistole aus der Schärpe und bettet den Mann dann neben dem Stauwehr im Gras.
Dann geht er – nun doch einmal nass – in den Bach zurück, bückt sich und fischt den Revolver auf Anhieb heraus.
Kaum aber ist er wieder bei dem Fremden, als der die Augen aufschlägt, heftig zusammenfährt und kehlig sagt: »Nicht schießen – nicht schießen! Ich sterbe, Heilige Maria, Hilfe, Hilfe!«
»Haben Sie keine Angst, Señor, es geschieht Ihnen nichts!«, sagt Mitch ruhig.
Der Mann starrt ihn aus großen Augen an. Dann hebt er matt die Hand und sagt im fließenden und nach dem San Diego-Streifen klingenden, singenden Amerikanisch: »Mister, du musst mir helfen, du musst mir helfen! Ich werde an der Wunde vielleicht sterben, aber dann werden sie mich trotzdem aufhängen, und der Capitan wird glauben, dass du mich ihnen ausgeliefert hast. Hier war eben eine Frau, ich habe sie gesehen. Sie werden euch umbringen, wenn ihr mich verratet. Sie werden euch die Hälse abschneiden, hast du verstanden?«
»Wer wird uns umbringen?«, fragt Mitch Sheldon ganz ruhig, als er die fürchterliche Erregung des Mannes bemerkt. »Und wer wird dich aufhängen?«
Der Mann starrt ihn brennend an. »Mein Schwager«, sagt er dann keuchend. »Mein Schwager wird dich und alle deine Leute töten, wenn du mich nicht versteckst. Sie suchen mich. Buchanan ist mit einem Aufgebot hinter mir her. Sie haben mich angeschossen, und sie hängen mich auf, wenn sie mich finden! Hilf mir, oder du wirst selber mit all deinen Leuten sterben!«
Mitch schüttelt leicht den Kopf und sagt trocken: »Sie hängen niemanden auf, so schnell nicht. Ich werde dich ins Haus schaffen und sehen, was ich für dich tun kann, mein Freund.«
Der Mann ist nicht in den Bach gefallen, trotzdem ist seine Stirn nass.
Im nächsten Augenblick aber sagt er auch schon – und es ist Mitch Sheldon, als wenn ihm jemand mit brutaler Gewalt einen Hammer mitten auf den Kopf schlägt: »Ich bin Reyes Feliz, der Schwager Joaquins! Rette mich, sonst wirst du sterben müssen. Verrätst du mich, dann martert Joaquin dich zu Tode! Hörst du nicht – hörst du, sie kommen ja schon!«
Mitch Sheldon schließt einen Moment die Augen, als wenn es einfach zu viel ist, was er sehen muss. Dieser Mann hier, hilflos, dem Tode nahe, ist Reyes Feliz, der Bruder von Rosita Feliz, der Geliebten Joaquin Murietas.
Dann aber hört er deutlich weiter hinten im Unterholz laute Rufe. Sie sind noch weit entfernt, das Unterholz ist dicht, und zwischen den Büschen herrscht tiefste Dunkelheit.
»Schnell, ich bitte dich«, sagt Feliz jetzt voller Furcht. »Hilf mir, es wird dein Schaden nicht sein, Mister. Hilf mir, sonst wirst du es büßen müssen. Bist du ein Christ, dann hilf mir!«
»Christ?«, fragt Mitch, der sich nun langsam von seinem Schock zu erholen beginnt. »Ein Christ? Bist du einer?«
»Bei der heiligen Mutter, hilf mir, Mister!«
»Das brauchtest ausgerechnet du nicht zu sagen«, erwidert Sheldon düster. »Ich helfe jedem Menschen, der in Not ist. Und du bist es, also sei ruhig und lass dich tragen. Du kannst nicht mehr schießen, selbst wenn du eine Waffe hättest, Feliz, sie hören es mit Sicherheit. Ich werde dich ins Haus bringen!«
»Nimm – nimm das Pferd mit, sie kommen und werden es sehen. Und dann …«
Er wendet den Kopf, die Rufe scheinen näher gekommen zu sein. Die Augen von Reyes Feliz weiten sich entsetzt, dann stößt er einen flachen Seufzer aus und rutscht haltlos zusammen.
Mitch Sheldon nimmt den ohnmächtigen Mann hoch und trägt ihn hastig zum Haus. Er ist noch nicht durch die Pforte, die den Garten vom Haus trennt, als er Mary aus dem Stall kommen sieht und mit einem Ruck stehen bleibt.
»Mein Gott«, sagt sie erschrocken. »Mitch, wer ist das?«
»Ein Mann, der in einer halben Stunde verblutet sein wird, wenn ihm niemand hilft. Mach die Haustür auf und sei leise, damit wir die Kinder nicht aufwecken, hörst du? Geh schon, der Mann hat eine Kugel durch die Brust bekommen und sehr viel Blut verloren!«
»Wer ist er?«
»Das ist unwichtig, Mary, mach die Tür auf!«
Sie macht hastig die Tür vor ihm auf, er geht schnell durch das Zimmer und sagt hart: »Ich lege ihn in dein Bett!«
»Bist du irr? Er ist ja ganz voller Blut. Wie entsetzlich, er verdreht ja die Augen!«
»Er wird gleich aus seiner Ohnmacht aufwachen. Was macht die Gescheckte?«
»Es zieht sich immer noch hin. Mitch, doch nicht auf mein Bett, doch nicht …«
»Sei still und werde nicht laut. Setze dich neben ihn und halte seine Hand oder presse ein Tuch auf seine Brustwunde. Herrgott, tue es, der Mann stirbt sonst! Ich muss noch einmal hinaus. Kümmere dich nicht um das, was draußen vorgeht und rufe auch nicht nach Gregg. Hast du verstanden?«
»Ja, ja, aber was soll das alles?«
»Fragen beantworte ich dir nachher.«
Er rennt hastig hinaus, holt das Pferd, stößt die Waffen in den langen und mit Wasser gefüllten Trog und bringt dann das Pferd über den Steinweg in den Stall. Kaum hat er den Stall hinter sich geschlossen, als er auch schon wieder zurückhastet und in Riesensätzen an das Wehr läuft. Sein linker Ärmel ist voller Blut, er steigt in den tiefen Trog, wäscht sich und feuert das Hemd, das er auszieht, in den Trog hinein, wo es vom Wasser davongetragen wird.
Keine Minute darauf hört er das wilde Schnauben von Pferden, die Rufe der Männer und beißt die Zähne zusammen. Er denkt jetzt nicht an den Mann, er denkt daran, dass er etwas tun muss, was er aus tiefster Seele verabscheut.
Mitch Sheldon muss lügen.
Und er weiß nicht einmal, ob der Mann, den diese Lüge retten soll, es verdient, dass ein ehrlicher Mann für ihn die Unwahrheit sagt.
»Er ist todsicher im Flussbett geritten, verdammter Greaser, todsicher. Wenn wir ihn erwischen, hänge ich ihn an den nächsten Ast. Ich werde – he, da ist ja jemand. He, Sheriff!«
Hufe planschen im Wasser, drei, sechs, ein volles Dutzend Männer tauchen auf und sind so schwer bewaffnet, dass es Mitch graust.
Mitch Sheldon steht im Bach, schüttet sich das Wasser über den nackten Oberkörper und sieht hoch.
»Hallo«, sagt er langsam, als er den einen der Männer an der Spitze des Aufgebotes erkennt. »Hallo, Reeves, was macht ihr denn hier?«
Reeves, der ihn sehr gut kennt und oft zu den Predigten nach Murphys Diggings kommt, starrt ihn an, zieht dann kurz seinen Hut und sagt heiser: »Hallo, Prediger, wir suchen einen verdammten, blutigen Greaser, der hier vorbeigekommen sein muss. Hast du einen gesehen? Sie haben einige Chinesen und zwei Auswanderer beraubt und umgebracht, es sind drei oder vier Mann gewesen. Einen haben wir erschießen können, zwei sind entwischt, und einer entkam nach der anderen Richtung, aber verwundet. Er muss hier vorbeigekommen sein!«
»Hier? Ja, ich kam gerade vom Haus, es mag zehn Minuten her sein, Reeves, als ich etwas im Bach hörte. Sehen konnte ich nur einen Schatten, aber es schien mir ein Reiter zu sein, der in aller Eile südwärts jagte!«
»Danke, Prediger«, erwidert Reeves heiser und reitet auch schon los, die anderen hinterher. »Wenn ich den erwische, ich schneide ihm die Ohren ab und …«
Das andere verliert sich in dem wilden Hufwirbel, der über das Ufer tobt. Die ganze Meute – und Mitch kommt es in den Sinn, dass es sich wirklich um eine Meute handelt, die einen Hasen hetzt, fegt im wilden Galopp das Ufer entlang und verschwindet hinter den Bäumen links.
Es geht derartig schnell, dass Mitch Sheldon kaum die Tatsache begreift. Er hat Besuch bekommen, und der Besuch ist mit größter Geschwindigkeit wieder verschwunden.
»So schnell geht es«, murmelt der Mann, der manchmal in der Minenstadt die Andachten hält, verwundert. »So schnell kann es gehen, dass man zu einem Lügner wird.«
Er fühlt sich plötzlich müde und lauscht noch einmal. Von dem Aufgebot ist nichts mehr zu hören.
Er geht auf das Haus zu und sieht dann Mary in der Haustür stehen. Sie steht dort, sieht ihn nur an und sagt zuerst kein Wort. Er geht jetzt im Bogen nach rechts, fischt aus der trüben Brühe der Rindertränke sein Hemd, das vom Wasser bis hierher getrieben worden ist, und kommt dann wieder auf sie zu.
»Das – das«, sagt sie stockend. »Mitchell, das war doch Sheriff Buchanan, nicht wahr?«
»Ja«, sagt er leise und sieht an ihr vorbei, kann sie einfach nicht ansehen. »Nun – und?«
»Du – du hast ihn belogen, Mitchell?«
»Ja«, sagt er wieder und denkt an Eva, die Schlange und den verfluchten Baum.
Sie sieht jetzt auch an ihm vorbei und zerknittert ihre gestärkte Schürze zwischen den Händen.
»Du weißt hoffentlich, was du da getan hast, Mitchell!«
»Ja«, sagt er ganz ruhig und wirft sein Hemd in die Holzwanne, in der sie schon die schmutzige Wäsche für den Waschtag liegen hat. »Ich hoffe, dass ich es weiß.«
Er geht weiter, nass wie er ist, und ihn friert etwas, als er mit tropfenden Sachen in einer schnell größer werdenden Lache am Boden vor dem Bett mit jenem Reyes Feliz steht. Ihn friert, aber der Mann dort hat nur ein Handtuch um die Schultern bekommen, das die Wunde notdürftig bedeckt. Der Mann ist wichtig, wichtig, weil er ein Mensch ist. Und dann ist es unwichtig, dass Mitchell Sheldon friert.
»Hole mir ein Laken und reiße es entzwei, Mary!«
»Mitchell, ist das nicht etwas viel für einen Mör…«
Er dreht sich um, in seinen Augen ist plötzlich Härte, die selbst sein Bruder Gregg fürchtet.
»Tu, was ich dir sage. Wenn es hier jemanden gibt, der sich für alles verantworten muss, dann werde ich es sein. Tu es, erst dann können wir uns unterhalten!«
Er sieht ihr nur zwei Sekunden nach, dann holt er etwas Whisky aus dem Schrank. Ganz ruhig feuchtet Mitch das Handtuch an, wäscht dem Mann die Brust sauber. Er hört Mary kommen und die Schere klirren, als sie das Leinenzeug samt der Schere auf die Kommode legt.
»Mitchell, ich will damit nichts zu tun haben, hast du gehört? Ich werde dir nicht helfen!«
»Ich höre!«
»Dieser Mann hier …«
»Du kannst gehen und Gregg holen, er soll sofort herkommen, sofort!«
»Das werde ich tun. Und – hoffentlich wirft Gregg den verdammten Kerl hinaus!«
Er schweigt, er hört sie fortgehen und legt dem Mann einen Verband an.
Er macht den Knoten zu, der Verband sitzt fest um die Brust von Reyes Feliz.
Die Schritte kommen von hinten, laute, harte und schwere Tritte, denn Gregg ist ein Riese, ein Mann, der gute drei Sack Weizen forttragen kann, was ihm niemand nachmacht, auch Mitch nicht.
Gregg stampft heran, hinter ihm ist der leichte Schritt Marys zu vernehmen.
Und dann sagt Gregg auch schon mit seiner polternden, heiseren Stimme: »Bruder, ist das ein Bandit?«
»Ja!«