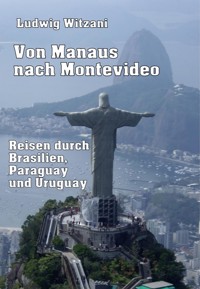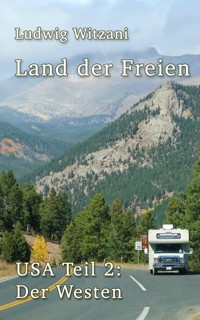
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Kaum irgendwo sonst in der Welt sind die Gefühle von Freiheit und Weite für den Reisenden derart intensiv zu erleben wie am Grand Canyon, in Yosemitie und Yellowstone, in den bizarren Steinwüsten Utahs oder in Texas, Colorado oder Dakota. Doch so vielfältig sich die Natur des amerikanischen Westens darstellt, so vielfältig ist auch seine politische Geographie. Im amerikanischen Westen, dem Experimentierfeld der Vereinigten Staaten, treffen die weltanschaulichen Gegensätze härter aufeinander als anderswo. Auch diese Spaltung in ihre vielfältigen Erscheinungsformen kommt in diesem Buch zur Sprache, ergänzt durch zahl-reiche geschichtliche Exkurse, die die historische Tiefendimension des amerikanischen Westens ausleuchten. Das vorliegende Buch über den amerikanischen Westen ist die direkte Fortsetzung des Ostküstenbuches "Am Anfang war die ganze Welt Amerika".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani: Land der Freien
Reisen durch den Westen der Vereinigten Staaten
____________________________________________
Weltreisen Band XVIII
Ludwig Witzani
Land
der Freien
Reisen durch den Westen
der Vereinigten Staaten
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I Von Chicago nach Seattle
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses
Im Indianerland
Feuer und Eis
Wasserfälle, Mondlandschaften und ein Crash in Boise
Exkurs: Der Oregon Trail
Gelobtes Land im Westen
Macht euren Job so heiter wie die Fischverkäufer von Seattle
II Texas
Der Tod des Präsidenten und die Parade der Longhorn-Rinder
Die unberechenbare Schwester der Karibik
„Remember the Alamo“
Durch das Tal des Rio Grande nach El Paso und Ciudad Juarez
III Berge und Wüsten im amerikanischen Westen
Eine Dünenlandschaft aus Gips und das älteste durchgängig bewohnte Haus der Welt
In den Canyons von Mesa Verde und eine Fahrt mit dem Durango-Train
Auf der höchstgelegenen Asphaltstraße der USA durch die Rocky Mountains
Der Baukasten der Geologie
Zwei Städte in Amerika
IV KALIFORNIEN
Kalifornien durch die Hintertüre
Westküstenherbst
Hauptstadt des liberalen Amerikas
Big Sur
Stadt der Engel
V Jenseits der Lower 48: Ein Blick nach Alaska und Hawaii
Ein Land, das Respekt und Vorsicht einfordert: Alaska
Südsee auf amerikanisch: Hawaii
VI Eine literarische Reise durch den amerikanischen Westen
Reisen und Lesen
Annie Proulx: Weit draußen
Cormack McCarthy: All die schönen Pferde
Guterson: Schnee, der auf Zedern fällt.
Brad Easton Ellis: Unter Null
Anhang
Allgemeine Reisehinweise
Reiseführer für Individualreisen
Foto- und Kartennachweis
Über den Autor
Impressum
Einleitung
Nur wenige Monate hat sich Alexis de Tocqueville in den USA aufgehalten und hat doch darüber ein Buch von fast tausend Seiten geschrieben. Da kann man sehen, wie viel es über die USA zu erzählen gibt - und das im Jahre 1831! Knapp zwei Jahrhunderte später ist noch viel mehr über die Vereinigten Staaten zu erzählen, und man weiß gar nicht, wo man anfangen oder aufhören soll.
Ich habe, der Geografie folgend, an der Ostküste begonnen - in New York und Massachusetts, um dann weiter über Pennsylvania, Virginia und die beiden Carolinas nach Georgia und Florida zu reisen. Dieser Nordsüderkundung der amerikanischen Ostküste schloss sich die Bereisung der „Great River Road“ zwischen New Orleans und Chicago in umgekehrter Richtung an. Diesen ersten Teil meiner amerikanischen Reisen habe ich im Buch „Am Anfang war die ganze Welt Amerika“ (USA Band I: Der Osten, Weltreisen Bd. XVII) beschrieben.
Das vorliegende Buch ist die direkte Fortsetzung des Ostküstenbuches. Es beschreibt den Westen der USA, der gemeinhin als der attraktivere Teil der Vereinigten Staaten gilt. Kalifornien, der Grand Canyon, Yosemite und Yellowstone und die bizarren Steinwüsten Utahs sind längst zu Markenzeichen der Vereinigten Staaten geworden. Kaum irgendwo sonst in der Welt sind die Gefühle von Freiheit und Weite für den Reisenden derart intensiv zu erleben wie an der Westküste der USA, in Texas und Colorado oder Dakota und Montana. Kein Wunder, dass sich kaum jemand der Begeisterung für das „Land der Freien“ (Cormack McCarthy) entziehen kann.
Auch dieses Buch ist von dieser Begeisterung beeinflusst, wenngleich nicht verschwiegen wird, dass die riesigen Gebiete zwischen Mississippi und dem Pazifik eine Geschichte haben, die einen Schatten auf Amerika wirft, weil die Ausdehnung der Vereinigten Staaten von Küste zu Küste gleichbedeutend war mit dem Todesurteil für die indianische Kultur. Diese Vergangenheit kann auch eine Reise durch den amerikanischen Westen nicht ignorieren.
So vielfältig sich die Natur des amerikanischen Westens darstellt, so vielfältig ist seine politische Geographie. Im amerikanischen Westen, dem sozialen Experimentierfeld der Vereinigten Staaten, treffen die weltanschaulichen Gegensätze härter aufeinander als anderswo. Den liberalen, teilweise schon woken Pazifikstaaten Kalifornien, Oregon und Washington State stehen Versionen der alten Frontier-Mentalitäten in Texas und Montana gegenüber. Auch im Westen macht sich die gesellschaftliche Spaltung der USA bemerkbar, die das Land seit der Jahrtausendwende quält. Auch diese Spaltung in ihren vielfältigen Erscheinungsformen kommt in diesem Buch zur Sprache.
Ebenso wie der Band über den amerikanischen Osten fußt dieses Reisebuch auf meinen Reisetagebüchern, die ich auf zehn ausführlichen Reisen durch die Vereinigten Staaten mit einer gewissen Obsession geführt habe. Fünf dieser Reisen führten mich in den amerikanischen Westen, von Chicago bis nach Seattle (Kapitel I) durch Texas (Kapitel II), Utah, Colorado und Nevada (Kapitel III) und mehrfach nach Kalifornien (Kapitel IV) – und nach Alaska und Hawaii, die ich bereits an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe.
Wo immer es möglich war, habe ich versucht, die Unmittelbarkeit meiner Reisetagebücher in den Text zu übernehmen, nur hier und da habe ich im Interesse der Lesbarkeit die Darstellung gestrafft und offensichtliche Fehler korrigiert. Ehrlicherweise will ich eine Warnung anfügen: Wie alle meine Bücher besitzt auch dieses Buch eine gewisse Geschichtslastigkeit, weil ich glaube, dass Reisen nicht nur Fortbewegung im Raum, sondern auch in der Zeit bedeutet.
Und schließlich ein letztes, was den Anspruch dieses Buches definiert. In diesem Buch geht es mir nicht in erster Linie um ein Abbilden, sondern um ein Verstehen, um einen reiseerzählerischen Brückenschlag zwischen dem konkreten Reiseerlebnis und der einordnenden Reflexion, wobei ich gerne zugeben will, dass dergleichen leicht in die Untiefen der Subjektivität führen kann.
Auf der persönlichen Ebene handelt es sich um die Aufarbeitung und Gestaltung meiner eigenen Begegnung mit Amerika, die ich nicht zuletzt auch für mich selbst geschrieben habe – getreu der Maxime von Ernst Jünger, dass nicht beschriebene Zeit verlorene Zeit ist. Wenn das Beschriebene für den einen oder anderen trotzdem von Wert ist, umso besser. Am allerbesten ist es natürlich, wenn der Leser selbst aufbricht, um zu sehen, was der amerikanische Westen für ihn bereithält.
I Von Chicago nach Seattle
Begrabt mein Herz
an der Biegung des Flusses
Durch Wisconsin und Minnesota nach South Dakota
Im Indianerland
Von den Black Hills zum Little Big Horn
und nach Cody
Feuer und Eis
Im Yellowstone- und Grand Teton-Nationalpark
Wasserfälle, Mondlandschaften
und ein Crash in Boise
Über das Snake Plateau durch Idaho
Exkurs: Der Oregon-Trail
Gelobtes Land im Westen
Oregon von Baker City bis Cannon Beach
Macht euren Job so heiter
wie die Fischverkäufer von Seattle
Reisen durch Washington State
Badlands Nationalpark – South Dakota
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses
Durch Wisconsin, Minnesota nach South Dakota
Als Francesco Petrarca im Jahre 1347 seine berühmte Reise zum Mont Ventoux plante, suchte er nach dem passenden Reisegefährten. Das war gar nicht so einfach wie gedacht. „Der eine war mir zu saumselig, der andere zu unermüdlich, der zu langsam, jener zu rasch, der zu schwerblütig, dieser zu fröhlich, der endlich stumpfen Sinnes, jener gescheiter als mir lieb war,“ schrieb Petrarca. Jeder, der öfter und für längere Zeit mit Reisepartnern unterwegs war, weiß ein Lied davon zu singen, wie recht Petrarca hat. Noch komplizierter wird es, wenn die eigene Ehefrau die Reisebegleiterin ist. Darüber wäre viel zu erzählen – aber nur, wenn man sich gegen die Diskretion versündigen wollte. Für diese Reise muss der Hinweis genügen, dass meine Frau Lilia aus Deutschland nach Chicago gekommen war, um mich auf der Reise nach Seattle zu begleiten. Wenn ich sie also im Folgenden nur selten erwähne, muss trotzdem immer mit bedacht werden, dass ihr kritischer und regulativer Einfluss jederzeit in segensreicher Weise gegenwärtig war, um mich vor Fehltritten und Unsinn zu bewahren.
Unsere gemeinsame Reise nach Seattle begann am frühen Morgen mit einem letzten Frühstück im „House of two Urns“. Fünftausend Kilometer lagen vor uns, und das Zeitbudget war knapp. In weniger als vier Wochen musste ich den Wagen in Seattle wieder abgeben.
Aus dem Millionenmoloch Chicago herauszukommen, dauerte fast eine Stunde. Illinois erwies sich im Norden als genauso langweilig wie im Süden, nur hässlicher. Nördlich von Rockford erreichten wir Wisconsin, den „Staat der Deutschen“, wie es hieß, weil fast die Hälfte der Einwohner deutsche Vorfahren besaßen. Wie es den Stereotypen entsprach, machte das Land einen aufgeräumten Eindruck, noch aufgeräumter als Illinois, aber auf eine ansprechendere Weise. Die Landschaft glich einer gut gelaunten fetten Verwandten, die niemand ohne Not allzu oft besucht. Weniger idyllisch war der Anblick zahlreicher Rehe, Biber und Waschbären, die plattgefahren am Rande des Highways lagen. Fleiß hatte offenbar immer auch etwas mit Eile zu tun.
In Madison, der Hauptstadt von Wisconsin, absolvierten wir einen Boxenstopp mit Kaffee und Sandwich. Madison besaß unter jungen Leuten einen sagenhaften Ruf als eine der tolerantesten, fahrradfreundlichsten und umweltbewusstesten Städte der USA. Dementsprechend blank gefegt und leer waren die Straßen und Parks der Stadt. Madisons Kapitol dagegen war einer Großmacht würdig, weiß und prächtig erhob es sich mitten in der Innenstadt. Das war’s aber auch schon, und nach einer Stunde waren wir wieder auf der Straße.
La Crosse im Dreiländereck von Wisconsin, Minnesota und Indiana war kein Fest für die Sinne. Die Spuren der wirtschaftlichen Plackerei lagen als Rohre, Schächte und Halden vor aller Augen. La Crosse´ einziger Trumpf war der Mississippi, der sich im Umkreis der Stadt in zahlreiche Seitenarme aufteilte. Als wir über die Brücke fuhren, warf ich einen letzten Blick auf den großen Strom und seine kleinen Inseln, die aussahen, als würden sie jeden Moment absaufen.
Der Südosten Minnesotas war flach. Schnurgerade zog sich die Straße nach Westen. Gelegentlich waren Anzeichen von Massentierhaltung zu riechen, obwohl kein Schwein zu sehen war. Der Verkehr war gemäßigt, der Blick weit. Farmerland, soweit das Auge reichte. Wir sahen Bewässerungsanlagen, Traktoren, Zäune und Erntebrigaden auf den Feldern.
In Albert Lea, knapp siebenhundert Kilometer hinter Chicago schliefen wir in einem Motel am Highway. Von unserem Zimmer aus sahen wir das flache Band der Schnellstraße, auf der die Autos wie Murmeln hin und her rollten. Von Albert Lea selbst war nichts weiter zu berichten, ein Verkehrsknotenpunkt am Anfang der Prärie, dessen Funktion sich auf Ankommen und Weiterfahren beschränkte.
Am nächsten Reisetag sahen wir das gleiche wie am Vortag: weites Land und einen grandiosen Himmel, über den sich die Wolkengebirge in Zeitlupe hinwegbewegten. Um uns herum ein Meer von Wiesen und Feldern, auf dem, Schiffen gleich, in weiten Abständen Höfe und Farmen sichtbar wurden. Wie einsame Hochhäuser ragten die Getreidespeicher in den Himmel. Der Wagen rollte und rollte auf glatter Straße dem Westen entgegen. Der persönliche Energieaufwand für die Fortbewegung tendierte in Süd-Minnesota gegen null.
In South-Dakota war es genauso. Kilometerfressen war angesagt, nur der Zug der Wolken unterhielt das Auge. Das Beste an Sioux Falls war der verheißungsvolle Name, auch wenn es keine Sioux zu sehen gab. Die Stromschnellen des Big Sioux River, einem Nebenfluss des Missouri, waren alles andere als „big“, sondern fast ausgetrocknet.
Und immer weiter ging es nach Westen. Die Landschaft wurde noch flacher und eintöniger. Breitbandwolkenpanoramen auf einer endlosen Himmelsleinwand. Straßen, wie mit dem Lineal gezogen, gleichmütig dahintröpfelnd die Stunden. Wir näherten uns dem Kornpalast von Mitchell, einer Sehenswürdigkeit, die ihre Attraktion dem Umstand verdankt, dass es sonst weit und breit nichts Interessanteres zu sehen gab. Schon 50 km vor dem Kornpalast wurde der Ort wie eine Weltsensation auf großen Plakaten angekündigt: Mitchell, das Weltzentrum der Popcornkultur!
Auf den ersten Blick sah der Kornpalast von Mitchell aus wie ein farbenfroh bemalter indischer Mogulpalast. Seine Wandbilder waren mit zwölf unterschiedlichen Farbtönen des heimischen Korns gestaltet. Ratlos standen wir vor dem Gebilde. Bei so viel Leere in der Prärie wurde selbst das Popcorn zur Attraktion.
Zwischen Mitchell und Rapid City kreuzte der Missouri die Straße, der große Strom, der um so vieles länger und doch weniger berühmt ist als der Mississippi. Das Wasser war dunkelblau mit einem Schuss ins Türkise. Unmittelbar hinter dem Missouri begann das Indianerland, das die Siedlertrecks nach Westen auf ihrem Weg nach Oregon passieren mussten. Die Farmen und Felder wurden seltener, die Region der Viehzucht begann. Je weiter wir nach Westen kamen, desto mehr Tiere sahen wir auf den Weiden. Cowboys trabten auf ihren Pferden am Straßenrand Richtung Wall und Rapid City.
Wall - South Dakota
Der kleine Ort Wall im Westen von South Dakota war das Tor zu den Badlands, einer bizarren Erosionslandschaft, die etwa zehn Kilometer südlich des Ortes begann. Wir tranken den berühmten 5-Cent-Kaffee im Wall Drug Saloon und übernachteten im Sunshine Inn Motel. Als in der Nacht ein Tornado über die Prärie zog, wackelte das ganze Haus. Tornados waren hier im Sommer keine Seltenheit. Feuchtwarme Luft vom Golf traf auf die Kaltluft der Rockies und brachte die Natur in Wallung. Ganze Siedlertrecks waren im 19. Jahrhundert von Tornados zerschmettert worden.
Als wir am Morgen aus dem Fenster blickten, war die staubige Durchgangsstraße meterbreiten Pfützen blockiert. Die Temperatur war rasant gefallen, und eine dunkle Wolkenwand hing wie eine Decke über der Prärie. Das richtige Wetter zum Besuch des „Grasland Visitor Centers“, in dem die Geschichte und die Ökologie der Graslandschaften des mittleren Westens dargestellt wurde. Neu für mich war, dass die amerikanische Bundesregierung nach den Dust-Bowl-Jahren massenweise brachliegendes Land in South Dakota aufgekauft und rekultiviert hatte. Der Dust Bowl, eine jahrelange Dürre, hatte in den 1930er Jahren tausende Farmerexistenzen zwischen Oklahoma und Dakota vernichtet. John Steinbeck hatte in „Früchte des Zorns“ dieser ökologischen Katastrophe ein literarisches Denkmal gesetzt. Immerhin waren durch das Rekultivierungsprogramm der Regierung weite Teile Dakotas neu besiedelt worden. Die Regionen, die landwirtschaftlich oder ökonomisch nicht nutzbar waren, hatte man zu Grasland-Schutzgebieten umgewandelt. Auf diese Weise sollten Teile der amerikanischen Prärie in einen Zustand wie vor der Ankunft der Weißen zurückversetzt werden. Nun leben die ausgewilderten Bisons wieder im Indianerland, nur die Indianer sind weg.
Womit wir bei den Indianerkriegen wären, einem der bittersten und schändlichsten Kapitel der US-amerikanischen Geschichte. Diese Indianerkriege, die die große Siedlungsbewegung der Europäer nach Westen wie eine Blutspur begleiteten, verliefen fast immer gleich. Es wurden feierlich Verträge zwischen Indianern und dem „großen weißen Vater in Washington“ abgeschlossen, dann wurden die Verträge von den Weißen gebrochen. Es kam zu Protesten, dann zu gewaltsamem Widerstand der Indianer, der im Gegenschlag von der amerikanischen Armee brutal niederkartätscht wurde. Das letzte Kapitel dieses über Generationen hinweg immer weiter eskalierenden Völkermords ereignete sich im Dezember 1890 bei Wounded Knee im Süden der Badlands. Der amerikanische Schriftsteller Dee Brown hatte die Ereignisse in seinem Buch „Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses“ beschrieben.
In dem kleinen Wounded Knee Museum von Walls, das nur aus wenigen Räumen bestand, wurde zunächst die Vorgeschichte des Massakers dargestellt. Ihrer normalen Jagdgründe ebenso beraubt wie der Büffelherden, waren die Prärieindianer nach ihren Niederlagen in den Indianerkriegen in Reservaten zusammengepfercht worden, in denen Alkoholismus, Krankheiten und Kriminalität grassierten. Kein Wunder, dass vor diesem Hintergrund religiöse Erweckungsbewegungen großen Zulauf hatten. Eine solche Erweckungsbewegung, die sogenannte „Geistertanzbewegung“, fand in den späten 1880er Jahren unter den Indianerstämmen der Prärie enthusiastische Gefolgschaft, denn ihre Schamanen verkündeten genau das, wonach sich alle sehnten: die Weißen würden verschwinden, die Bisons zurückkehren, und alles würde wieder so werden, wie es früher einmal gewesen war. Eine herzanrührende kollektive Wunschvorstellung, wie sie sterbende Völker oft überkommt.
Obwohl die indianische Geistertanzbewegung keine Gewalt propagierte, gerieten die Stämme ob dieser Hoffnungen in Unruhe. Als im Dezember 1890 eine Gruppe von etwa 250 Sioux ihr Reservat eigenmächtig verließ, reagierten die Weißen nervös. Im Zuge eines Gerangels wurde der Sioux Häuptling Sitting Bull, einer der Sieger der Schlacht am Little Big Horn, von einem indianischen Kollaborateur erschossen. Er wurde an einer unbekannten Stelle des Wounded Knie Rivers begraben.
Am 28.12.1890 entluden sich schließlich die Spannungen zwischen den Indianern und der Armee in einem Massaker. Mit halbautomatischen Waffen erschossen die Soldaten 250 Indianer, unter ihnen zahlreiche Frauen und Kinder. Der verantwortliche Offizier James William Forsyte und seine Truppe wurden von allen Vorwürfen freigesprochen und belobigt. Die Soldaten erhielten für ihre besondere „Tapferkeit“ die „Medal of Honor“. Einige dieser Schandzertifikate hingen im Wounded Knee Museum von Wall hinter Glas an der Wand.
Dermaßen eingestimmt erschienen mir die Badlands wie eine Landschaft des Todes. Wind und Regen hatten das weiche Gestein zu bizarren Graten, Schluchten und Bergreliefs geformt, als hätte es die Natur darauf angelegt, das Gebirge in ein Abbild seiner gnadenlosen Geschichte zu verwandeln. Das gesamte Gebiet der Badlands war auf einer etwa zwanzig Meilen langen Rundstrecke mit dem Wagen befahrbar. Überall boten Lookouts Ausblicke auf die grauen, gestreiften, gezackten Berge und die Grassäume zu ihren Füßen. Die Kalkfelsen waren weich und nachgiebig, wenn man über sie lief und überraschten hinter jeder Ecke mit neuen Figurationen aus dem großen Skulpturenarsenal der Natur. Gräser mit dicken grünen Stengeln und weißen Spitzen wehten im Wind. Am Ende verließen wir den Wagen und liefen die Wanderwege entlang. Kein Mensch war zu sehen, nur die Geräusche des Windes unterbrachen die Stille.
Crazy Horse Monument – South Dakota
Im Indianerland
Von den Black Hills zum Little Big Horn und nach Cody
Bald hinter Wall war Rapid City erreicht, das Tor zu den Black Hills. Mount Rushmore befindet sich etwa 40 Kilometer südlich von Rapid City und ist über den gut ausgebauten Highway 16 erreichbar. Schon der Trubel am Ortseingang machte klar, dass wir uns einer gesamtamerikanischen Sehenswürdigkeit näherten. Nach einer Slalomfahrt an Hotels und Shops vorüber, stellten wir unser Fahrzeug hinter einer Anhöhe auf einem Parkplatz ab. Danach spazierten wir durch eine Galerie mit Flaggen aller 50 amerikanischen Bundesstaaten zu einer Terrasse, von der aus auf der anderen Talseite die berühmten vier Präsidentenköpfe zu sehen waren, von links nach rechts: George Washington, Thomas Jefferson, Theodor Roosevelt und Abraham Lincoln.
Ein Dokumentarfilm informierte im Visitor Center über die Baugeschichte von Mount Rushmore. Hatte man ursprünglich geplant, Lewis und Clarke oder Buffalo Bill in den Black Hills zu ehren, entwickelte der dänische Bildhauer und Architekt Gutzon Borglum 1925 das Konzept der vier Präsidenten-Köpfe. „Amerikanische Kunst muss kolossal sein“, sprach der Däne und überzeugte damit die Entscheidungsträger. 1927 wurde in Anwesenheit von Präsident Coolidge der Bau begonnen, 1931 war der George Washington-Kopf fertig. 1936 erschien Präsident Franklin D. Roosevelt zur Einweihung des Jefferson Kopfes. Allerdings hatte sich inzwischen gezeigt, dass manche Bergpassagen für die Bearbeitung zu porös waren, so dass man reichlich Material wegsprengen und den verrutschten Kopf von Thomas Jefferson unter großem Aufwand von links nach rechts verlegen musste. 1941 starb Borglum im Alter von 71 Jahren, doch sein Sohn setzte die Arbeit fort. Fertig wurde die Anlage erst 1991, als Präsident George Bush der Ältere Mount Rushmore für vollendet erklärte. Seitdem haben Millionen Touristen aus aller Welt die Präsidentenköpfe besucht. Nur die Indianer meiden das Monument, nicht zuletzt, weil sie der Anblick dieser Präsidentenköpfe an den Verlust ihres Landes erinnert. Das traf besonders für Präsident Lincoln zu, der 1862 in seinem „Homestead Act“ die rechtlichen Grundlagen für die Enteignung von Indianerland geschaffen hatte.
Mount Rushmore
Zweifellos repräsentieren die vier achtzehn Meter großen Riesenköpfe eine wesentliche Facette des amerikanischen Lebensgefühls, oder anders gesagt: sie sind die Manifestation des Bewusstseins von der Größe und dem Aufstieg der eigenen Nation, die bisher immer, wenn es eng wurde, einen Führer gefunden hatte, um den sie sich scharen konnte. Dass es daran im gegenwärtigen Amerika so mangelt, macht das Monument von Mount Rushmore nur umso aktueller.
Wenn man wollte, konnte man diese Betrachtungen in der Nachbarschaft vom Mount Rushmore weiterführen. Denn nicht weit von den vier Präsidentenköpfen entfernt und in der Nachbarschaft eines Bisonparks, der ausgerechnet den Namen „Custer Park“ trug (vgl. S. 32), entsteht seit fast 50 Jahren die größte Skulptur der Erde, eine alle Ausmaße sprengende Darstellung des Indianerhäuptlings Crazy Horse als Antithese zu Mount Rushmore.
Der Indianerhäuptling Crazy Horse hatte die Indianer in der Schlacht am Little Big Horn angeführt, später war er absprachewidrig von den Weißen gefangen genommen und schließlich ermordet worden. Die Lakota-Sioux „begruben sein Herz an der Biegung des Flusses“, wie Dee Brown in dem gleichnamigen Buch geschrieben hatte und verehrten ihn als einen der Größten ihres Volkes.
In diesem Kontext hatte der polnische Bildhauer Korczak Zielkowski in den 1950er Jahren von den Stammesältesten der Lakota-Sioux den Auftrag erhalten, Crazy Horse in den Black Hills durch ein würdiges Denkmal zu ehren, ohne zu ahnen, welche ungeheuren Dimensionen Zielkowski für das Crazy Horse Projekt vorgesehen hatte. Der Pole wollte nicht kleckern, sondern klotzen und konzipierte eine 180 Meter große Reiterskulptur, die Crazy Horse auf dem Rücken seines Pferdes mit ausgestrecktem Arm aus einem Berg herausreiten ließ.
Ohne staatliche Unterstützung begann Zielkowski zunächst damit, den hunderte Meter hohen Berg zurechtzusprengen, um seinen Entwurf Stück für Stück auszuarbeiten. Eine ganze Generation dauerte es, bis wenigstens der dreißig Meter große Kopf des Kriegers aus dem Berg herausgehauen war. Während der jahrzehntelangen Arbeiten am Berg zeugte der wackere Mann mit seiner Frau immerhin zehn Kinder, fünf Mädchen und fünf Knaben, die alle in das Projekt des Vaters einbezogen wurden. Als Zielkowski starb, führte seine Frau die Arbeiten fort.
So ambitioniert das Projekt auch daherkam, so harsch ist die Kritik, die am Crazzy Horse Monument geübt wird – und das mit einem gewissen Recht. Zielkowskis Projekt mochte Züge von Wiedergutmachung in sich tragen, in seiner Ausgestaltung aber ist es originär amerikanisch, oder sollte man sagen: überambitioniert und hybrid wie etwa die Weltinseln von Dubai, die Ruinen von Dydima oder der Riesentempel von Konrak in Orissa. Im Grunde lebt das Crazy Horse Monument aus seinem Widerspruch gegen die aufgesetzte Glorie von Mount Rushmore, wobei der fragmentarische Charakter des Werkes die Vergeblichkeit dieses Widerspruches unfreiwillig dokumentiert.
Elf Dollar zahlte man für den Eintritt und noch einmal acht Dollar für die Busfahrt zum Besucherzentrum und zur Terrasse des Crazy Horse Monuments. Von dieser Terrasse, auf der die Touristen ihre Hamburger verspeisten, konnten wir den großen Berg im Zustand seiner Metamorphose aus etwa einem Kilometer Entfernung betrachten. Unterhalb des fertig ausgearbeiteten grimmigen Gesichts waren die groben Umrisse der nach vorne weisenden, fast hundert Meter langen Hand nur vage zu erkennen. Der gesamte Rest einschließlich des Pferdes wartete noch auf seine Erschaffung im Berg. Das hinderte die ansässigen Indianer aber nicht, täglich zur Freude der Touristen ihren Festornat anzulegen und für reichlich Trinkgeld ihre Klagegesänge anzustimmen.
Vom Crazy Horse Monument aus unternahmen wir einen Abstecher in den Custer Park, ein Schutzgebiet für freilaufende Bisons. Berühmt war dieser Park aber nicht für seine Bisons, sondern für die sogenannten „bettelnden Esel“, die derart an Menschen adaptiert waren, dass sie sich rudelweise an den Straßenrändern drängten, um Naschereien von den Durchreisenden zu erhalten. Ich gab den Eseln nichts. Alleine der Gedanke, dass einer der Esel die Reinkarnation General Custers sein könnte, verleidete mir jede Gabe.
Es war schon Nachmittag, als wir die U385 weiter nordwärts fuhren. Giftgrüne, regennasse Wiesen lagen wie dicke Teppiche vor dunklen Tannenwäldern. Die Häuser am Wegesrand sahen aus, als stammten sie noch aus der Indianerzeit. Die Straßenführung war verschlungen, nur der Himmel war weit wie immer. Die richtige Kulisse für das historische Halunkenland an der Grenze von South Dakota und Wyoming. Wir erreichten Deadwood, eine Goldgräberstadt aus den 1860er und 1870er Jahren, in der Wild Bill Hickock sein Unwesen getrieben hatte. Wild Bill Hickock hatte sein Leben unter großer Anteilnahme seiner Zeitgenossen als Revolverheld, Spieler und Abenteurer verbracht, war Kundschafter in den Indianerkriegen gewesen, soll einen Bären mit Revolver und Messer zur Strecke gebracht und insgesamt acht Menschen erschossen haben - einige von Ihnen in den berühmten „Quick Draw“-Duellen, bei denen sich zwei Antagonisten gegenüber stehen und nur der überlebt, der zuerst schießt und trifft. Wild Bill Hickock starb 1876, als er sich entgegen seiner Gewohnheit beim Pokern mit dem Rücken zur Türe gesetzt hatte und von hinten erschossen worden war. Auch andere Westerngrößen wie Wyatt Earp und Doc Holiday sollen sich in Deadwood herumgetrieben haben. Leider war das „Days of ´76“ Museum, das die Stadtgründung von 1876 dokumentierte, geschlossen. Nur ein Relief von Wild Bill Hickock erinnerte am Ortseingang an die Wildwestära von Deadwood.
Der nächste Morgen war so kalt und dunkel, wie wir es auf dieser Reise noch nicht erlebt hatten. Dazu kam ein Wind, der eine Ahnung von Sturm in sich trug. Wir fuhren weiter in Richtung Wyoming, einer dunklen Wolkenwand entgegen. Eine gut ausgebaute Straße führte uns über 40 km zum so genannten Devils Tower, einem 600 Meter hohen, steil und stolz aus der Landschaft aufragenden Monolithen, der schon von weitem zu sehen war und das Bild der ganzen Umgebung prägte. Wenig verwunderlich, dass dieser Platz für die Indianerstämme der „Rastplatz Manitus“ gewesen war. Heute war er nur noch der Rastplatz der Touristen, die in Limousinen und mächtigen Wohnmobilen durch Wyoming fuhren.
Auf der Weiterreise nach Westen war auf dem Highway viel Unordnung zu sehen. Wo so viel Platz war, brauchte offenbar niemand aufzuräumen. Einmal hielten wir an einer komplett verlassenen Siedlung mit eingestürzten Hütten und verrosteten Autos. Ein Vorschein der Apokalypse und ein mögliches Bühnenbild für eine postmoderne Dystopie. Wieder passierten wir einen Halunkenort, der durch einen Banditen berühmt geworden war. Diesmal handelte es sich um Sundance, die Heimat von Sundance Kid, der zusammen mit seinem Kumpanen Butch Cassidy im späten 19. Jahrhundert die Farmer der Umgebung in Atem gehalten hatte. Paul Newman und Robert Redford hatten die Geschichte von „Butch Cassidy und Sundance Kid“ mit einem romantisierenden Hollywood-Blockbuster weltberühmt gemacht. Ein happy end gab es trotzdem nicht. Als der Boden für Sundance Kid und Butch Cassidy zu heiß wurde, hatten sie sich nach Patagonien abgesetzt, dann nach Chile und Bolivien, wo sie vermutlich 1908 von Soldaten der Armee erschossen worden waren.
Je weiter wir in Wyoming einfuhren, desto mehr offenbarte der Staat seine wirtschaftliche Basis: Bergbau, vor allen Dingen Kohleförderung, hielt Wyoming über Wasser. Wir sahen kilometerweit aufgerissene Erde, in der riesige Schaufelradbagger herumgruben. Wieder ein Bild von den letzten Tagen der Menschheit. Dann folgten endlose Eisenbahnzüge mit hunderten Waggons voller Kohle. Energie für die Millionen Klimaanlagen, die Amerika kühl hielten.
Vor den eigentlichen Rocky Mountains weit im Westen befand sich Big Horn, genauer gesagt das große Tal des Big Horns im Westen und der Little Big Horn im Osten, jener Ort, an dem sich die größte Schlacht zwischen Indianern und Weißen ereignet hatte, die jemals geschlagen worden war: die Schlacht am Little Big Horn.
Die Vorgeschichte der Schlacht am Little Big Horn führt zurück zu einem jener zahlreichen Verträge, die feierlich beschworen und doch von den Weißen gebrochen worden waren. Der Vertrag von Fort Laramie hatte der Sioux-Nation 1868 ein ausgedehntes eigenes Territorium einschließlich der Black Hills garantiert, das für immer von der weißen Besiedlung verschont bleiben sollte. Wie überall im Westen wurde auch dieser Vertrag von den Weißen gebrochen und zwar unter maßgeblicher Mitwirkung eines militärischen Dilettanten, dem gegenüber die Geschichte wenigstens so gerecht gewesen war, ihn für seine Brutalität bezahlen zu lassen. Die Rede ist von General George Armstrong Custer, einem tollkühnen, aber militärisch äußerst unbedarften Kavallerieoffizier, der im Bürgerkrieg bekannt geworden war und der in den Indianerkriegen Gelegenheit fand, seine mörderischen Instinkte auszuleben. So ließ Custer als verantwortlicher Offizier im Jahre 1868 das Cheyennedorf Washita angreifen und zerstören, wobei vorwiegend Frauen und Kinder zu Tode kamen. Danach ließ er 1000 (!) Indianerpferde erschießen, womit er den Cheyenne von Washita die Büffeljagd unmöglich machte und sie faktisch zum Hungertod verurteilte. 1874 drang er widerrechtlich in die Black Hills vor, die den Indianern vertraglich zugesprochen worden waren und entdeckte Gold. Sofort überschwemmten Goldsucher das Indianerland und gründeten die Stadt „Stonewall“, die 1876 nach Custers Tod in „Custer“ umbenannt wurde. Kein Wunder, dass sich die Sioux, Cheyenne, Arapaho und andere Stämme nach diesem Vertragsbruch zu einer großen Widerstandskonföderation unter der Führung von Sitting Bull und Crazy Horse zusammenschlossen und zu den Waffen griffen. Präsident Grant war über Custers Eigenmächtigkeiten, die für den Aufstand mitverantwortlich waren, so verstimmt, dass er ihn suspendieren oder aus der Armee werfen wollte. Nur die Fürsprache einflussreicher Generäle führte dazu, dass Custer dann bei dem Indianerfeldzug eingesetzt wurde, der ihm den Tod bringen sollte. Geplant war eine breite militärische Zangenbewegung mehrerer Armeeeinheiten, die die aufständischen Sioux, Cheyenne und Arapaho vernichten sollte. Aufgrund mangelnder Abstimmung und militärischer Fehler entwickelte sich daraus die schlimmste Niederlage, die amerikanische Truppen im Kampf gegen die Indianer jemals erlitten. Weil Custer in seiner Beschränktheit die Kampfkraft der Indianer sträflich unterschätzte, rückte er mit nur wenigen hundert Männern auf eine große Indianersiedlung zu, teilte seine kleine Streitmacht auch noch einmal in drei Teile und sah sich plötzlich zweitausend bewaffneten Indianern gegenüber. Da er auch das Gelände nicht hatte erkunden lassen, konnte er im entscheidenden Augenblick nicht über den Fluss setzen, wurde eingekreist und auf dem so genannten „Custer Hill“ zusammen mit seinen Soldaten abgeschlachtet, während nur wenige Kilometer weiter eine andere Armeeeinheit tatenlos herumirrte. Um diesen Todeskampf der Custer-Soldaten wurde lange Zeit als „Custers last Stand“ großes Heldengedöns veranstaltet. Die Wahrheit war, dass hier ein überschätzter Schlagetot seine Männer in einen sinnlosen Tod geführt hatte.
Der Ort der Schlacht am Little Big Horn River liegt ziemlich genau an der Grenze von Wyoming und Montana und ist über die Battlefield Road zu erreichen. Jenseits eines kleinen Parkplatzes gab es Infomaterial in einem Visitor Center. Dann konnten die Besucher mit Audio Guide das Schlachtfeld ablaufen, zuerst den Soldatenfriedhof mit dem Mahnmal für die Toten der 7. Kavallerie, ergänzt seit einigen Jahren durch ein Denkmal, das an die in der Schlacht gefallenen Indianer erinnert. Custers sterbliche Überreste lagen nicht auf diesem Friedhof, sondern waren nach West Point überführt worden. Wer wollte, konnte anschließend den Hügel ersteigen, auf dem „Custers last stand“ stattgefunden hatte. Den Sioux allerdings war Custer nach wie vor verhasst wie der Gottseibeiuns, und das mit einem gewissen Recht, denn erst sein Vorstoß in die Black Hills und seine illegitime Goldsucherei hatten 1874 das sinnlose Gemetzel ins Rollen gebracht.
Als sinnlos erwies sich aber auch der Sieg der Indianer am Little Big Horn. Für die Weißen war es nur eine kleine Schlappe in einem Krieg, den sie nicht verlieren konnten. Kurz darauf mussten die Sioux trotz ihres Sieges aufgeben. Crazy Horse wurde gefangen genommen und kurz darauf erschossen. Sitting Bull absolvierte nach seiner Kapitulation einen Karriere-Appendix, der einen Schatten auf seinen Ruhm warf, denn er trat neben Buffalo Bill eine Zeitlang in einem Wildwest- Zirkus auf, ehe er, zwei Wochen vor dem Massaker am Wounded Knee, ebenfalls erschossen wurde.
Zwei Wege führten vom Tal des Big Horns nach Cody, dem Tor zum Yellowstone Park. Der eine machte einen weiten Bogen nach Norden und führte über Montana und Billings. Das war der längere, aber schnellere Weg. Schöner war die Straße durch den Big Horn Nationalpark, die über endlose Serpentinen bis auf eine Hochebene führte, von der aus bereits die Schneefelder der Rockies zu sehen waren. Wir passierten dunklen Nadelwald und schmutzigen Schnee am Straßenrand. Zwischen zwei Tannen stand eine riesige Elchkuh und beobachtete den spärlichen Verkehr. Dann führte die Straße wieder abwärts und bot grandiose Aussichten auf die westlichen Berge. Am Shell Creek überblickten wir die gewaltige Kerbe, die eine launige Natur in den Gebirgszug geschlagen hatte. Über tausend Meter ragte der gewaltige Berg in die Höhe und entließ zahlreiche Quellen, die eine Oase nach der nächsten nährten.
In der Ebene zwischen dem Big Horn Nationalpark und Cody erwartete uns eine völlig andere Klimazone. Unvermittelt stiegen die Temperaturen auf dreißig Grad. Rote Felsen ragten aus verbrannter Erde. Holzschilder warnten vor Waldbrandgefahr. Umso beglückender war der Anblick kleiner Oasen am Wegesrand. Nirgendwo entfaltet die Farbe Grün einen solchen Zauber wie in der Wüste.
Die größte Oase zwischen Big Horn und Yellowstone war Cody, Buffalo Bills Stadt. Auch Buffalo Bill gehörte neben Wild Bill Hickock, Sundance Kid, Butch Cassidy, Wyatt Erp, Doc Holiday und vielen anderen zum dauerhaften Personal der Wildwestgeschichten. Allerdings war er kein Krimineller gewesen, sondern hatte es verstanden, als Impressario seiner selbst das Klischee vom Wilden Westen in seiner „Buffalo Bill Wildwest Show“ weltweit zu vermarkten. Auch in Cody war Buffalo Bill alias William Cody allgegenwärtig: es gab ein Buffalo Bill-Restaurant, einen Buffalo Bill-Burger und Buffalo Bill-Bars ohne Ende.
Wir kamen gerade zurecht, um das Cody-Rodeo zu besuchen, das alljährlich zwischen Juni bis Ende August stattfand. Dieses Rodeo konnte zwar keinen Vergleich mit den großen nordamerikanischen Rodeos wie etwa der Stampede von Calgary aushalten, es war aber durchaus kurzweilig. Die Show begann typisch amerikanisch mit einem Gebet plus Hintergrundmusik von „Legenden der Leidenschaft“. Anschließend standen alle auf, legten die rechte Hand auf ihr Herz und sangen die Nationalhymne. Dann ging es los, und unter großem Geschrei begann der Kampf der Cowboys mit Pferden, Kälbern und Bullen. Besonders haarsträubend war das „Bull Riding“, bei dem es darauf ankam, sich auf dem Rücken eines furchterregenden, muskelbepackten Bullen nur mit der Hilfe eines Stricks so lange wie möglich oben zu halten. So lange wie möglich hieß maximal einige Sekunden, denn kaum hatte sich das Gatter geöffnet, flog der Cowboy schon in hohem Bogen in den Staub. Um zu verhindern, dass der Bulle dem abgeworfenen Cowboy den Rest gab, sprang nach dem Abwurf sofort eine Reihe bunt gekleideter Komparsen in die Arena, um das Tier abzulenken. Erheblich länger hielten sich die Cowboys auf den Rücken der Wildpferde, auch wenn diese einen schier unglaublichen Veitstanz aufführten, um ihre Reiter abzuwerfen. Sie sprangen, bockten, buckelten, zuckten, rannten vor oder stoppten, doch einigen Cowboys gelang es, unter dem Jubel des Publikums sich so lange auf dem Rücken eines Pferdes zu halten, bis eine Glocke ertönte und die Probe bestanden war. Seit meinem Besuch der Stampede von Calgary/Kanada wusste ich, dass den Pferden vor dem Rodeo die Hoden eingeklemmt wurden, um sie zu besonderer Wildheit zu reizen. Ich hätte es fairer gefunden, wenn auch dem Cowboy die Hoden eingeklemmt worden wären, so dass sich Pferd und Mensch mit dem gleichen Handicap aneinander hätten messen können. Auf der anderen Seite waren die Rodeo-Reiter gestraft genug. Längst nicht jeder räumte die Preise auf den großen Veranstaltungen ab, die meisten verbrachten ihr kurzes berufliches Leben als eine jahrelange Aufeinanderfolge von leichten und schweren Stürzen in der Arena, und manch ein Cowboy beendete seine bescheidene Laufbahn vorzeitig als Invalide.
Uneingeschränkt artistisch dagegen war das „Calf Roping“, das Einfangen junger Rinder durch lassowerfende Cowboys. Kaum stürmte das kleine Kalb in die Arena, war schon der Cowboy mit seinem Pferd hinter ihm, warf sein Lasso mit unglaublicher Präzision dem Tier um die Beine, um es abrupt zu stoppen. Dann sprang der Cowboy vom Pferd, warf das Kalb auf den Rücken, als sei es ein Sack Stroh und fesselte es in Sekundenschnelle. Ein Triumph der menschlichen Akrobatik über die Widerspenstigkeit der Natur.
Am Ende wurden alle anwesenden Kinder in die Arena gerufen und aufgefordert, zwei kleine Kälbchen zu jagen. Die ganze Arena grölte vor Lachen, als fünfzig bis sechzig Kinder vergeblich versuchten, die Kälbchen zu fangen. Auch ein anderes, reizendes Bild ist mir im Gedächtnis geblieben: ein Bulle, der gerade einen Rodeoreiter im hohen Bogen abgeworfen hatte, blickte völlig überrascht auf drei Clowns, die sich ihm wie eine Raupe bockspringend näherten. Das Staunen, der Urgrund der Philosophie, streift mitunter sogar ein Rind.
Auf dem Weg von Cody zum Osteingang des Yellowstone Nationalparks
Feuer und Eis
Im Yellowstone- und Grand Teton-Nationalpark
Mächtig und grau kam uns der Yellowstone River aus den Bergen entgegen. Wiesen und Weiden begrenzten das Tal zu beiden Seiten, während die Straße immer höher führte. Kurz vor dem östlichen Parkeingang wurden die Bergflanken weiß, und die Temperaturen fielen. Wir befanden uns bereits oberhalb von zweitausend Höhenmetern, und die ersten Schneeflocken wehten uns entgegen. Als ich den Wagen verließ, um das Ticket für den Nationalpark zu kaufen, fuhr mir ein eisiger Wind in den Kragen. Eine Herde Dallschafe stand auf einer Anhöhe und schaute auf uns herab.
Eine halbe Stunde später erblickten wir den Yellowstone Lake in der Ferne. Glatter, schwarzer Samt im Schatten dunkler Wolken. Wir hatten das Seeufer noch nicht erreicht, da begann es wieder zu schneien. Rau schlug die Brandung an das Ufer, als befänden wir uns am Rande des Nordmeeres. Nur weit im Süden des Sees war innerhalb eines lichtdurchfluteten Himmelssaums ein Teil der majestätischen Teton-Range sichtbar.
Unser erster Anlaufpunkt war das Visitor Center am Yellowstone Lake, in dem sich die Besucher ausführlich über die Geschichte und die Geografie des Parkes informieren konnten. Während draußen das Schneetreiben heftiger wurde, beschäftigten wir uns im Innern mit der Geologie der Supervulkane. Supervulkane sind Vulkane, deren Ausbrüche erdverändernden Charakter besitzen. Ihre Explosionen sind so gewaltig, dass sie nicht nur das Klima, sondern auch die gesamte Geografie ihrer Umgebung weiträumig verändern. Ich hatte Landschaften, die von Supervulkanen geformt worden waren, bereits am Toba-See auf Sumatra und am Taupo-See auf Neuseelandkennengelernt. In beiden Fällen hatten sich nach den Ausbrüchen urzeitliche Senken gebildet, die sich mit Wasser gefüllt hatten. Supervulkane als Geburtshelfer gewaltiger Seen.