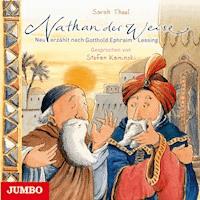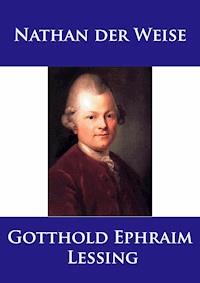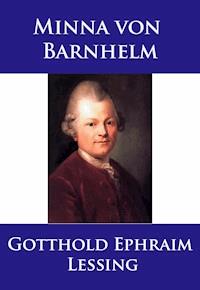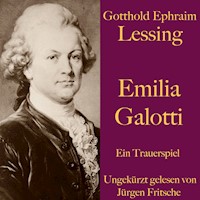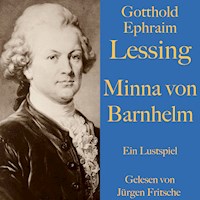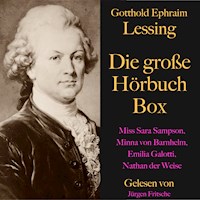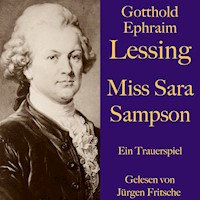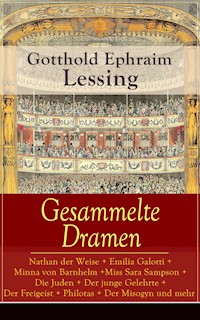0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Gotthold Ephraim Lessings Buch 'Laokoon: Oder, Über die Grenzen der Malerei und Poesie' gilt als Meisterwerk der Literaturkritik. Lessing analysiert die Beziehung zwischen Malerei und Poesie und diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten jeder Kunstform. Dabei bietet er tiefgreifende Einblicke in Ästhetik und Literaturtheorie des 18. Jahrhunderts. Sein Stil ist prägnant und klar, was es auch für Laien zugänglich macht. Dieses Werk wird oft als Wendepunkt in der deutschen Literaturkritik betrachtet und ist ein Muss für jeden Liebhaber von Ästhetik und Kunstgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Laokoon: Oder, Über die Grenzen der Malerei und Poesie
Inhaltsverzeichnis
I.
Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke in der Malerei und Bildhauerkunst setzet Herr Winckelmann in eine edele Einfalt und stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. "So wie die Tiefe des Meeres", sagt er 1), "allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag auch noch so wüten, ebenso zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.
{1. Von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, S. 21. 22.}
Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des Laokoons, und nicht in dem Gesichte allein, bei dem heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdecket, und den man ganz allein, ohne das Gesicht und andere Teile zu betrachten, an dem schmerzlich eingezogenen Unterleibe beinahe selbst zu empfinden glaubt; dieser Schmerz, sage ich, äußert sich dennoch mit keiner Wut in dem Gesichte und in der ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laokoon singet; die Öffnung des Mundes gestattet es nicht: es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadolet beschreibet. Der Schmerz des Körpers und die Größe der Seele sind durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeteilet, und gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber er leidet wie des Sophokles Philoktet: sein Elend gehet uns bis an die Seele; aber wir wünschten, wie dieser große Mann das Elend ertragen zu können.
Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die Bildung der schönen Natur. Der Künstler mußte die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägte. Griechenland hatte Künstler und Weltweise in einer Person, und mehr als einen Metrodor. Die Weisheit reichte der Kunst die Hand, und blies den Figuren derselben mehr als gemeine Seelen ein, usw."
Die Bemerkung, welche hier zum Grunde liegt, daß der Schmerz sich in dem Gesichte des Laokoon mit derjenigen Wut nicht zeige, welche man bei der Heftigkeit desselben vermuten sollte, ist vollkommen richtig. Auch das ist unstreitig, daß eben hierin, wo ein Halbkenner den Künstler unter der Natur geblieben zu sein, das wahre Pathetische des Schmerzes nicht erreicht zu haben, urteilen dürfte; daß, sage ich, eben hierin die Weisheit desselben ganz besonders hervorleuchtet.
Nur in dem Grunde, welchen Herr Winckelmann dieser Weisheit gibt, in der Allgemeinheit der Regel, die er aus diesem Grunde herleitet, wage ich es, anderer Meinung zu sein.
Ich bekenne, daß der mißbilligende Seitenblick, welchen er auf den Virgil wirft, mich zuerst stutzig gemacht hat; und nächstdem die Vergleichung mit dem Philoktet. Von hier will ich ausgehen, und meine Gedanken in eben der Ordnung niederschreiben, in welcher sie sich bei mir entwickelt.
"Laokoon leidet, wie des Sophokles Philoktet." Wie leidet dieser? Es ist sonderbar, daß sein Leiden so verschiedene Eindrücke bei uns zurückgelassen.—Die Klagen, das Geschrei, die wilden Verwünschungen, mit welchen sein Schmerz das Lager erfüllte, und alle Opfer, alle heilige Handlungen störte, erschollen nicht minder schrecklich durch das öde Eiland, und sie waren es, die ihn dahin verbannten. Welche Töne des Unmuts, des Jammers, der Verzweiflung, von welchen auch der Dichter in der Nachahmung das Theater durchhallen ließ.—Man hat den dritten Aufzug dieses Stücks ungleich kürzer, als die übrigen gefunden. Hieraus sieht man, sagen die Kunstrichter 2), daß es den Alten um die gleiche Länge der Aufzüge wenig zu tun gewesen. Das glaube ich auch; aber ich wollte mich desfalls lieber auf ein ander Exempel gründen, als auf dieses. Die jammervollen Ausrufungen, das Winseln, die abgebrochenen a, a, jeu, attatai, w moi, moi! die ganzen Zeilen voller papai, papai, aus welchen dieser Aufzug bestehet, und die mit ganz andern Dehnungen und Absetzungen deklamieret werden mußten, als bei einer zusammenhangenden Rede nötig sind, haben in der Vorstellung diesen Aufzug ohne Zweifel ziemlich ebensolange dauren lassen, als die andern. Er scheinet dem Leser weit kürzer auf dem Papiere, als er den Zuhörern wird vorgekommen sein.
{2. Brumoy, Théât. des Grecs T. II. p. 89.}
Schreien ist der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzes. Homers verwundete Krieger fallen nicht selten mit Geschrei zu Boden. Die geritzte Venus schreiet laut 3); nicht um sie durch dieses Geschrei als die weichliche Göttin der Wollust zu schildern, vielmehr um der leidenden Natur ihr Recht zu geben. Denn selbst der eherne Mars, als er die Lanze des Diomedes fühlet, schreiet so gräßlich, als schrien zehntausend wütende Krieger zugleich, daß beide Heere sich entsetzen 4).
{3. Iliad. E. v. 343. h de mega iacousa—}
{4. Iliad. E. v. 859.}
Soweit auch Homer sonst seine Helden über die menschliche Natur erhebt, so treu bleiben sie ihr doch stets, wenn es auf das Gefühl der Schmerzen und Beleidigungen, wenn es auf die Äußerung dieses Gefühls durch Schreien, oder durch Tränen, oder durch Scheltworte ankömmt. Nach ihren Taten sind es Geschöpfe höherer Art; nach ihren Empfindungen wahre Menschen.
Ich weiß es, wir feinern Europäer einer klügern Nachwelt wissen über unsern Mund und über unsere Augen besser zu herrschen. Höflichkeit und Anstand verbieten Geschrei und Tränen. Die tätige Tapferkeit des ersten rauhen Weltalters hat sich bei uns in eine leidende verwandelt. Doch selbst unsere Ureltern waren in dieser größer, als in jener. Aber unsere Ureltern waren Barbaren. Alle Schmerzen verbeißen, dem Streiche des Todes mit unverwandtem Auge entgegensehen, unter den Bissen der Nattern lachend sterben, weder seine Sünde noch den Verlust seines liebsten Freundes beweinen, sind Züge des alten nordischen Heldenmuts 5). Palnatoko gab seinen Jomsburgern das Gesetz, nichts zu fürchten, und das Wort Furcht auch nicht einmal zu nennen.
{5. Th. Bartholinus de causis contemptae a Danis adhuc gentilibus mortis, cap. I.}
Nicht so der Grieche! Er fühlte und furchte sich; er äußerte seine Schmerzen und seinen Kummer; er schämte sich keiner der menschlichen Schwachheiten; keine mußte ihn aber auf dem Wege nach Ehre, und von Erfüllung seiner Pflicht zurückhalten. Was bei dem Barbaren aus Wildheit und Verhärtung entsprang, das wirkten bei ihm Grundsätze. Bei ihm war der Heroismus wie die verborgenen Funken im Kiesel, die ruhig schlafen, solange keine äußere Gewalt sie wecket, und dem Steine weder seine Klarheit noch seine Kälte nehmen. Bei dem Barbaren war der Heroismus eine helle fressende Flamme, die immer tobte, und jede andere gute Eigenschaft in ihm verzehrte, wenigstens schwärzte.—Wenn Homer die Trojaner mit wildem Geschrei, die Griechen hingegen in entschloßner Stille zur Schlacht führet, so merken die Ausleger sehr wohl an, daß der Dichter hierdurch jene als Barbaren, diese als gesittete Völker schildern wollen. Mich wundert, daß sie an einer andern Stelle eine ähnliche charakteristische Entgegensetzung nicht bemerket haben 6). Die feindlichen Heere haben einen Waffenstillestand getroffen; sie sind mit Verbrennung ihrer Toten beschäftigst, welches auf beiden Teilen nicht ohne heiße Tränen abgehet; dakrua Jerma ceonteV. Aber Priamus verbietet seinen Trojanern zu weinen; oud' eia klaiein PriamoV megaV. Er verbietet ihnen zu weinen, sagt die Dacier, weil er besorgt, sie möchten sich zu sehr erweichen, und morgen mit weniger Mut an den Streit gehen. Wohl; doch frage ich: warum muß nur Priamus dieses besorgen? Warum erteilet nicht auch Agamemnon seinen Griechen das nämliche Verbot? Der Sinn des Dichters geht tiefer. Er will uns lehren, daß nur der gesittete Grieche zugleich weinen und tapfer sein könne; indem der ungesittete Trojaner, um es zu sein, alle Menschlichkeit vorher ersticken müsse. Nemessvmai ge men ouden klaiein, läßt er an einem andern Orte 7) den verständigen Sohn des weisen Nestors sagen.
{6. Iliad. H. v. 421.}
{7. Odyss. D. 195.}
Es ist merkwürdig, daß unter den wenigen Trauerspielen, die aus dem Altertume auf uns gekommen sind, sich zwei Stücke finden, in welchen der körperliche Schmerz nicht der kleinste Teil des Unglücks ist, das den leidenden Helden trifft. Außer dem Philoktet, der sterbende Herkules. Und auch diesen läßt Sophokles klagen, winseln, weinen und schreien. Dank sei unsern artigen Nachbarn, diesen Meistern des Anständigen, daß nunmehr ein winselnder Philoktet, ein schreiender Herkules, die lächerlichsten unerträglichsten Personen auf der Bühne sein würden. Zwar hat sich einer ihrer neuesten Dichter 8) an den Philoktet gewagt. Aber durfte er es wagen, ihnen den wahren Philoktet zu zeigen?
{8. Chateaubrun.}
Selbst ein Laokoon findet sich unter den verlornen Stücken des Sophokles. Wenn uns das Schicksal doch auch diesen Laokoon gegönnet hätte! Aus den leichten Erwähnungen, die seiner einige alte Grammatiker tun, läßt sich nicht schließen, wie der Dichter diesen Stoff behandelt habe. So viel bin ich versichert, daß er den Laokoon nicht stoischer als den Philoktet und Herkules, wird geschildert haben. Alles Stoische ist untheatralisch; und unser Mitleiden ist allezeit dem Leiden gleichmäßig, welches der interessierende Gegenstand äußert. Sieht man ihn sein Elend mit großer Seele ertragen, so wird diese große Seele zwar unsere Bewunderung erwecken, aber die Bewunderung ist ein kalter Affekt, dessen untätiges Staunen jede andere wärmere Leidenschaft, sowie jede andere deutliche Vorstellung ausschließet.
Und nunmehr komme ich zu meiner Folgerung. Wenn es wahr ist, daß das Schreien bei Empfindung körperlichen Schmerzes, besonders nach der alten griechischen Denkungsart, gar wohl mit einer großen Seele bestehen kann: so kann der Ausdruck einer solchen Seele die Ursache nicht sein, warum demohngeachtet der Künstler in seinem Marmor dieses Schreien nicht nachahmen wollen; sondern es muß einen andern Grund haben, warum er hier von seinem Nebenbuhler, dem Dichter, abgehet, der dieses Geschrei mit bestem Vorsatze ausdrücket.
II.
Es sei Fabel oder Geschichte, daß die Liebe den ersten Versuch in den bildenden Künsten gemacht habe: so viel ist gewiß, daß sie den großen alten Meistern die Hand zu führen nicht müde geworden. Denn wird itzt die Malerei überhaupt als die Kunst, welche Körper auf Flächen nachahmet, in ihrem ganzen Umfange betrieben: so hatte der weise Grieche ihr weit engere Grenzen gesetzet, und sie bloß auf die Nachahmung schöner Körper eingeschränket. Sein Künstler schilderte nichts als das Schöne; selbst das gemeine Schöne, das Schöne niedrer Gattungen, war nur sein zufälliger Vorwurf, seine Übung, seine Erholung. Die Vollkommenheit des Gegenstandes selbst mußte in seinem Werke entzücken; er war zu groß, von seinen Betrachtern zu verlangen, daß sie sich mit dem bloßen kalten Vergnügen, welches aus der getroffenen Ähnlichkeit, aus der Erwägung seiner Geschicklichkeit entspringet, begnügen sollten; an seiner Kunst war ihm nichts lieber, dünkte ihm nichts edler, als der Endzweck der Kunst.
"Wer wird dich malen wollen, da dich niemand sehen will", sagt ein alter Epigrammatist 1) über einen höchst ungestaltenen Menschen. Mancher neuere Künstler würde sagen: "Sei so ungestalten, wie möglich; ich will dich doch malen. Mag dich schon niemand gern sehen: so soll man doch mein Gemälde gern sehen; nicht insofern es dich vorstellt, sondern insofern es ein Beweis meiner Kunst ist, die ein solches Scheusal so ähnlich nachzubilden weiß." {1. Antiochus. (Antholog. lib. II. cap. 43). Harduin über den Plinius (lib. 35. sect. 36 p. m. 698) legt dieses Epigramm einem Piso bei. Es findet sich aber unter allen griechischen Epigrammatisten keiner dieses Namens.}
Freilich ist der Hang zu dieser üppigen Prahlerei mit leidigen Geschicklichkeiten, die durch den Wert ihrer Gegenstände nicht geadelt werden, zu natürlich, als daß nicht auch die Griechen ihren Pauson, ihren Piräikus sollten gehabt haben. Sie hatten sie; aber sie ließen ihnen strenge Gerechtigkeit widerfahren. Pauson, der sich noch unter dem Schönen der gemeinen Natur hielt, dessen niedriger Geschmack das Fehlerhafte und Häßliche an der menschlichen Bildung am liebsten ausdrückte 2), lebte in der verächtlichsten Armut 3). Und Piräikus, der Barbierstuben, schmutzige Werkstätte, Esel und Küchenkräuter, mit allem dem Fleiße eines niederländischen Künstlers malte, als ob dergleichen Dinge in der Natur so viel Reiz hätten, und so selten zu erblicken wären, bekam den Zunamen des Rhyparographen 4), des Kotmalers; obgleich der wollüstige Reiche seine Werke mit Gold aufwog, um ihrer Nichtigkeit auch durch diesen eingebildeten Wert zu Hilfe zu kommen.
{2. Jungen Leuten, befiehlt daher Aristoteles, muß man seine Gemälde nicht zeigen, um ihre Einbildungskraft, so viel möglich, von allen Bildern des Häßlichen rein zu halten. (Polit. lib. VIII. cap. 5. p. 526. Edit. Conring.) Herr Boden will zwar in dieser Stelle anstatt Pauson, Pausanias gelesen wissen, weil von diesem bekannt sei, daß er unzüchtige Figuren gemalt habe (de umbra poetica, comment. I. p. XIII.). Als ob man es erst von einem philosophischen Gesetzgeber lernen müßte, die Jugend von dergleichen Reizungen der Wollust zu entfernen. Er hätte die bekannte Stelle in der Dichtkunst (cap. II. ) nur in Vergleichung ziehen dürfen, um seine Vermutung zurückzubehalten. Es gibt Ausleger (z. E. Kühn, über den Älian Var. Hist. lib. IV. cap. 3), welche den Unterschied, den Aristoteles daselbst zwischen dem Polygnotus, Dionysius und Pauson angibt, darin setzen, daß Polygnotus Götter und Helden, Dionysius Menschen, und Pauson Tiere gemalt habe. Sie malten allesamt menschliche Figuren; und daß Pauson einmal ein Pferd malte, beweiset noch nicht, daß er ein Tiermaler gewesen, wofür ihn Herr Boden hält. Ihren Rang bestimmten die Grade des Schönen, die sie ihren menschlichen Figuren gaben, und Dionysius konnte nur deswegen nichts als Menschen malen, und hieß nur darum vor allen andern der Anthropograph, weil er der Natur zu sklavisch folgte, und sich nicht bis zum Ideal erheben konnte, unter welchem Götter und Helden zu malen, ein Religionsverbrechen gewesen wäre.}
{3. Aristophanes Plut. v. 602. et Acharnens. v. 854.}
{4. Plinius lib. XXXV. sect. 37. Edit. Hard.}
Die Obrigkeit selbst hielt es ihrer Aufmerksamkeit nicht für unwürdig, den Künstler mit Gewalt in seiner wahren Sphäre zu erhalten. Das Gesetz der Thebaner, welches ihm die Nachahmung ins Schönere befahl und die Nachahmung ins Häßlichere bei Strafe verbot, ist bekannt. Es war kein Gesetz wider den Stümper, wofür es gemeiniglich, und selbst vom Junius 5), gehalten wird. Es verdammte die griechischen Ghezzi; den unwürdigen Kunstgriff, die Ähnlichkeit durch Übertreibung der häßlichem Teile des Urbildes zu erreichen; mit einem Worte, die Karikatur.
{5. De pictura vet. lib. II. cap. IV. § 1.}
Aus eben dem Geist des Schönen war auch das Gesetz der Hellanodiken geflossen. Jeder olympische Sieger erhielt eine Statue; aber nur dem dreimaligen Sieger, ward eine ikonische gesetzet 6). Der mittelmäßigen Porträts sollten unter den Kunstwerken nicht zu viel werden. Denn obschon auch das Porträt ein Ideal zuläßt, so muß doch die Ähnlichkeit darüber herrschen; es ist das Ideal eines gewissen Menschen, nicht das Ideal eines Menschen überhaupt.
{6. Plinius lib. XXXIV. sect. 9.}
Wir lachen, wenn wir hören, daß bei den Alten auch die Künste bürgerlichen Gesetzen unterworfen gewesen. Aber wir haben nicht immer recht, wenn wir lachen. Unstreitig müssen sich die Gesetze über die Wissenschaften keine Gewalt anmaßen; denn der Endzweck der Wissenschaften ist Wahrheit. Wahrheit ist der Seele notwendig; und es wird Tyrannei, ihr in Befriedigung dieses wesentlichen Bedürfnisses den geringsten Zwang anzutun. Der Endzweck der Künste hingegen ist Vergnügen; und das Vergnügen ist entbehrlich. Also darf es allerdings von dem Gesetzgeber abhangen, welche Art von Vergnügen, und in welchem Maße er jede Art desselben verstatten will.
Die bildenden Künste insbesondere, außer dem unfehlbaren Einflusse, den sie auf den Charakter der Nation haben, sind einer Wirkung fähig, welche die nähere Aufsicht des Gesetzes heischet. Erzeugten schöne Menschen schöne Bildsäulen, so wirkten diese hinwiederum auf jene zurück, und der Staat hatte schönen Bildsäulen schöne Menschen mit zu verdanken. Bei uns scheinet sich die zarte Einbildungskraft der Mütter nur in Ungeheuern zu äußern.
Aus diesem Gesichtspunkte glaube ich in gewissen alten Erzählungen, die man geradezu als Lügen verwirft, etwas Wahres zu erblicken. Den Müttern des Aristomenes, des Aristodamas, Alexanders des Großen, des Scipio, des Augustus, des Galerius, träumte in ihrer Schwangerschaft allen, als ob sie mit einer Schlange zu tun hätten. Die Schlange war ein Zeichen der Gottheit 7); und die schönen Bildsäulen und Gemälde eines Bacchus, eines Apollo, eines Merkurius, eines Herkules, waren selten ohne eine Schlange. Die ehrlichen Weiber hatten des Tages ihre Augen an dem Gotte geweidet, und der verwirrende Traum erweckte das Bild des Tieres. So rette ich den Traum, und gebe die Auslegung preis, welche der Stolz ihrer Söhne und die Unverschämtheit des Schmeichlers davon machten. Denn eine Ursache mußte es wohl haben, warum die ehebrecherische Phantasie nur immer eine Schlange war.
{7. Man irret sich, wenn man die Schlange nur für das Kennzeichen einer medizinischen Gottheit hält, wie Spence, Polymetis p. 132. Justinus Martyr (Apolog. II. pag. 55. Edit. Sylburg.) sagt ausdrücklich: para panti tvn nomizomenwn par' umin Jevn, ojiV sumbolon mega kai musthrion anagrajetai; und es wäre leicht eine Reihe von Monumenten anzuführen, wo die Schlange Gottheiten begleitet, welche nicht die geringste Beziehung auf die Gesundheit haben.}
Doch ich gerate aus meinem Wege. Ich wollte bloß festsetzen, daß bei den Alten die Schönheit das höchste Gesetz der bildenden Künste gewesen sei.
Und dieses festgesetzt, folget notwendig, daß alles andere, worauf sich die bildenden Künste zugleich mit erstrecken können, wenn es sich mit der Schönheit nicht verträgt, ihr gänzlich weichen, und wenn es sich mit ihr verträgt, ihr wenigstens untergeordnet sein müssen.
Ich will bei dem Ausdrucke stehen bleiben. Es gibt Leidenschaften und Grade von Leidenschaften, die sich in dem Gesichte durch die häßlichsten Verzerrungen äußern, und den ganzen Körper in so gewaltsame Stellungen setzen, daß alle die schönen Linien, die ihn in einem ruhigern Stande umschreiben, verloren gehen. Dieser enthielten sich also die alten Künstler entweder ganz und gar, oder setzten sie auf geringere Grade herunter, in welchen sie eines Maßes von Schönheit fähig sind.
Wut und Verzweiflung schändete keines von ihren Werken. Ich darf behaupten, daß sie nie eine Furie gebildet haben 8).
{8. Man gehe alle die Kunstwerke durch, deren Plinius und Pausanias und andere gedenken; man übersehe die noch itzt vorhandenen alten Statuen, Basreliefs, Gemälde: und man wird nirgends eine Furie finden. Ich nehme diejenigen Figuren aus; die mehr zur Bildersprache, als zur Kunst gehören, dergleichen die auf den Münzen vornehmlich sind. Indes hätte Spence, da er Furien haben mußte, sie doch lieber von den Münzen erborgen sollen, (Seguini Numis. p. 178. Spanhem. de Praest. Numism. Dissert. XIII. p. 639. Les Cesars de Julien, par Spanheim p. 48.), als daß er sie durch einen witzigen Einfall in ein Werk bringen will, in welchem sie ganz gewiß nicht sind. Er sagt in seinem "Polymetis" (Dial. XVI. p. 272.): "Obschon die Furien in den Werken der alten Künstler etwas sehr Seltenes sind, so findet sich doch eine Geschichte, in der sie durchgängig von ihnen angebracht werden. Ich meine den Tod des Meleager, als in dessen Vorstellung auf Basreliefs sie öfters die Althäa aufmuntern und antreiben, den unglücklichen Brand, von welchem das Leben ihres einzigen Sohnes abhing, dem Feuer zu übergeben. Denn auch ein Weib würde in ihrer Rache so weit nicht gegangen sein, hätte der Teufel nicht ein wenig zugeschüret. In einem von diesen Basreliefs, bei dem Bellori (in den Admirandis), sieht man zwei Weiber, die mit der Althäa am Altare stehen, und allem Ansehen nach Furien sein sollen. Denn wer sonst als Furien, hätte einer solchen Handlung beiwohnen wollen? Daß sie für diesen Charakter nicht schrecklich genug sind, liegt ohne Zweifel an der Abzeichnung. Das Merkwürdigste aber auf diesem Werke ist die runde Scheibe, unten gegen die Mitte, auf welcher sich offenbar der Kopf einer Furie zeiget. Vielleicht war es die Furie, an die Althäa, so oft sie eine üble Tat vornahm, ihr Gebet richtete, und vornehmlich itzt zu richten alle Ursache hatte usw."—Durch solche Wendungen kann man aus allem alles machen. "Wer sonst", fragt Spence, "als Furien, hätte einer solchen Handlung beiwohnen wollen?" Ich antworte: Die Mägde der Althäa, welche das Feuer anzünden und unterhalten mußten. Ovid sagt: (Metamorph. VIII. v. 460. 461.)
Protulit hunc (stipitem) genitrix, taedasque in fragmina poni Imperat, et positis inimicos admovet ignes.
Dergleichen taedas, lange StÜcke von Kien, welche die Alten zu Fackeln brauchten, haben auch wirklich beide Personen in den HÄnden, und die eine hat eben ein solches Stück zerbrochen, wie ihre Stellung anzeigt. Auf der Scheibe, gegen die Mitte des Werkes, erkenne ich die Furie ebensowenig. Es ist ein Gesicht, welches einen heftigen Schmerz ausdrückt. Ohne Zweifel soll es der Kopf des Meleagers selbst sein. (Metamorph. I. c. v. 515.)
Inscius atque absens flamma Meleagros in illa Uritur: et caecis torreri viscera sentit Ignibus: et magnos superat virtute dolores.
Der KÜnstler brauchte ihn gleichsam zum Übergange in den folgenden Zeitpunkt der nÄmlichen Geschichte, welcher den sterbenden Meleager gleich daneben zeigt. Was Spence zu Furien macht, hält Montfaucon für Parzen, (Antiqu. expl. T. I. p. 162) den Kopf auf der Scheibe ausgenommen, den er gleichfalls für eine Furie ausgibt. Bellori selbst (Admirand. Tab. 77) läßt es unentschieden, ob es Parzen oder Furien sind. Ein Oder, welches genugsam zeiget, daß sie weder das eine noch das andere sind. Auch Montfaucons übrige Auslegung sollte genauer sein. Die Weibsperson, welche neben dem Bette sich auf den Ellebogen stützet, hätte er Kassandra und nicht Atalanta nennen sollen. Atalanta ist die, welche, mit dem Rücken gegen das Bette gekehret, in einer traurigen Stellung sitzet. Der Künstler hat sie mit vielem Verstande von der Familie abgewendet, weil sie nur die Geliebte, nicht die Gemahlin des Meleagers war, und ihre Betrübnis über ein Unglück, das sie selbst unschuldigerweise veranlasset hatte, die Anverwandten erbittern mußte.}
Zorn setzten sie auf Ernst herab. Bei dem Dichter war es der zornige Jupiter, welcher den Blitz schleuderte; bei dem Künstler nur der ernste.
Jammer ward in Betrübnis gemildert. Und wo diese Milderung nicht stattfinden konnte, wo der Jammer ebenso verkleinernd als entstellend gewesen wäre,—was tat da Timanthes? Sein Gemälde von der Opferung der Iphigenia, in welchem er allen Umstehenden den ihnen eigentümlich zukommenden Grad der Traurigkeit erteilte, das Gesicht des Vaters aber, welches den allerhÖchsten hätte zeigen sollen, verhüllete, ist bekannt, und es sind viel artige Dinge darüber gesagt worden. Er hatte sich, sagt dieser 9), in den traurigen Physiognomien so erschöpft, daß er dem Vater eine noch traurigere geben zu können verzweifelte. Er bekannte dadurch, sagt jener 10), daß der Schmerz eines Vaters bei dergleichen Vorfällen über allen Ausdruck sei. Ich für mein Teil sehe hier weder die Unvermögenheit des Künstlers, noch die Unvermögenheit der Kunst. Mit dem Grade des Affekts verstärken sich auch die ihm entsprechenden Züge des Gesichts; der höchste Grad hat die allerentschiedensten Züge, und nichts ist der Kunst leichter, als diese auszudrücken. Aber Timanthes kannte die Grenzen, welche die Grazien seiner Kunst setzen. Er wußte, daß sich der Jammer, welcher dem Agamemnon als Vater zukam, durch Verzerrungen äußert, die allezeit häßlich sind. Soweit sich Schönheit und Würde mit dem Ausdrucke verbinden ließ, so weit trieb er ihn. Das Häßliche wäre er gern übergangen, hätte er gern gelindert; aber da ihm seine Komposition beides nicht erlaubte, was blieb ihm anders übrig, als es zu verhüllen?—Was er nicht malen durfte, ließ er erraten. Kurz, diese Verhüllung ist ein Opfer, das der Künstler der Schönheit brachte. Sie ist ein Beispiel, nicht wie man den Ausdruck über die Schranken der Kunst treiben, sondern wie man ihn dem ersten Gesetze der Kunst, dem Gesetze der Schönheit, unterwerfen soll.
{9. Plinius lib. XXXV. sect. 36. Cum moestos pinxisset omnes, praecipue patruum, et tristitiae omnem imaginem consumpsisset, patris ipsius vultum velavit, quem digne non poterat ostendere.}
{10. Summi moeroris acerbitatem arte exprimi non posse confessus est. Valerius Maximus lib. VIII. cap. 11.}
Und dieses nun auf den Laokoon angewendet, so ist die Ursache klar, die ich suche. Der Meister arbeitete auf die höchste Schönheit, unter den angenommenen Umständen des körperlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden Heftigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er mußte ihn also herabsetzen; er mußte Schreien in Seufzen mildern; nicht weil das Schreien eine unedle Seele verrät, sondern weil es das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet. Denn man reiße dem Laokoon in Gedanken nur den Mund auf, und urteile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine Bildung, die Mitleid einflößte, weil sie Schönheit und Schmerz zugleich zeigte; nun ist es eine häßliche, eine abscheuliche Bildung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Anblick des Schmerzes Unlust erregt, ohne daß die Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das süße Gefühl des Mitleids verwandeln kann.
Die bloße weite Öffnung des Mundes,—beiseitegesetzt, wie gewaltsam und ekel auch die übrigen Teile des Gesichts dadurch verzerret und verschoben werden,—ist in der Malerei ein Fleck und in der Bildhauerei eine Vertiefung, welche die widrigste Wirkung von der Welt tut. Montfaucon bewies wenig Geschmack, als er einen alten bärtigen Kopf, mit aufgerissenem Munde, für einen Orakel erteilenden Jupiter ausgab 11). Muß ein Gott schreien, wenn er die Zukunft eröffnet? Würde ein gefälliger Umriß des Mundes seine Rede verdächtig machen? Auch glaube ich es dem Valerius nicht, daß Ajax in dem nur gedachten Gemälde des Timanthes sollte geschrien haben 12). Weit schlechtere Meister aus den Zeiten der schon verfallenen Kunst lassen auch nicht einmal die wildesten Barbaren, wenn sie unter dem Schwerte des Siegers Schrecken und Todesangst ergreift, den Mund bis zum Schreien öffnen 13).
{11. Antiquit. expl. T. I. p. 50.}
{12. Er gibt nämlich die von dem Timanthes wirklich ausgedrückten Grade der Traurigkeit so an: Calchantem tristem, moestum Ulyssem, clamantem Ajacem, lamentantem Menelaum.—Der Schreier Ajax müßte eine häßliche Figur gewesen sein; und da weder Cicero noch Quintilian in ihren Beschreibungen dieses Gemäldes seiner gedenken, so werde ich ihn um so viel eher für einen Zusatz halten dürfen, mit dem es Valerius aus seinem Kopfe bereichern wollen.}
{13. Bellorii Admiranda. Tab. 11. 12.}
Es ist gewiß, daß diese Herabsetzung des äußersten körperlichen Schmerzes auf einen niedrigern Grad von Gefühl, an mehrern alten Kunstwerken sichtbar gewesen. Der leidende Herkules in dem vergifteten Gewande, von der Hand eines alten unbekannten Meisters, war nicht der Sophokleische, der so gräßlich schrie, daß die lokrischen Felsen, und die euböischen Vorgebirge davon ertönten. Er war mehr finster, als wild 14). Der Philoktet des Pythagoras Leontinus schien dem Betrachter seinen Schmerz mitzuteilen, welche Wirkung der geringste gräßliche Zug verhindert hätte. Man dürfte fragen, woher ich wisse, daß dieser Meister eine Bildsäule des Philoktet gemacht habe. Aus einer Stelle des Plinius, die meine Verbesserung nicht erwartet haben sollte, so offenbar verfälscht oder verstümmelt ist sie 15).
{14. Plinius libr. XXXIV, sect. 19.}
{15. Eundem, nämlich den Myro, lieset man bei dem Plinius (libr. XXXIV. sect. 19) vicit et Pythagoras Leontinus, qui fecit stadiodromon Astylon, qui Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenentem tabulam, eodem loco, et mala ferentem nudum. Syracusis autem claudicantem: cujus hulceris dolorem sentire etiam spectantes videntur. Man erwäge die letzten Worte etwas genauer. Wird nicht darin offenbar von einer Person gesprochen, die wegen eines schmerzhaften Geschwüres überall bekannt ist? Cujus hulceris usw. Und dieses cujus sollte auf das bloße claudicantem, und das claudicantem vielleicht auf das noch entferntere puerum gehen? Niemand hatte mehr recht, wegen eines solchen Geschwüres bekannter zu sein, als Philoktet. Ich lese also anstatt claudicantem, Philoctetem, oder halte wenigstens dafür, daß das letztere durch das erstere gleichlautende Wort verdrungen worden, und man beides zusammen Philoctetem claudicantem lesen müsse. Sophokles läßt ihn stibon kai anagkan erpein, und es mußte ein Hinken verursachen, daß er auf den kranken Fuß weniger herzhaft auftreten konnte.}
III.
Aber, wie schon gedacht, die Kunst hat in den neuern Zeiten ungleich weitere Grenzen erhalten. Ihre Nachahmung, sagt man, erstrecke sich auf die ganze sichtbare Natur, von welcher das Schöne nur ein kleiner Teil ist. Wahrheit und Ausdruck sei ihr erstes Gesetz; und wie die Natur selbst die Schönheit höhern Absichten jederzeit aufopfere, so müsse sie auch der Künstler seiner allgemeinen Bestimmung unterordnen, und ihr nicht weiter nachgehen, als es Wahrheit und Ausdruck erlauben. Genug, daß durch Wahrheit und Ausdruck das Häßlichste der Natur in ein Schönes der Kunst verwandelt werde.
Gesetzt, man wollte diese Begriffe vors erste unbestritten in ihrem Werte oder Unwerte lassen: sollten nicht andere von ihnen unabhängige Betrachtungen zu machen sein, warum demohngeachtet der Künstler in dem Ausdrucke Maß halten, und ihn nie aus dem höchsten Punkte der Handlung nehmen müsse.
Ich glaube, der einzige Augenblick, an den die materiellen Schranken der Kunst alle ihre Nachahmungen binden, wird auf dergleichen Betrachtungen leiten.
Kann der Künstler von der immer veränderlichen Natur nie mehr als einen einzigen Augenblick, und der Maler insbesondere diesen einzigen Augenblick auch nur aus einem einzigen Gesichtspunkte, brauchen; sind aber ihre Werke gemacht, nicht bloß erblickt, sondern betrachtet zu werden, lange und wiederholtermaßen betrachtet zu werden: so ist es gewiß, daß jener einzige Augenblick und einzige Gesichtspunkt dieses einzigen Augenblickes, nicht fruchtbar genug gewählet werden kann. Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir darzu denken, desto mehr müssen wir zu sehen glauben. In dem ganzen Verfolge eines Affekts ist aber kein Augenblick, der diesen Vorteil weniger hat, als die höchste Staffel desselben. Über ihr ist weiter nichts, und dem Auge das Äußerste zeigen, heißt der Phantasie die Flügel binden, und sie nötigen, da sie über den sinnlichen Eindruck nicht hinaus kann, sich unter ihm mit schwächern Bildern zu beschäftigen, über die sie die sichtbare Fülle des Ausdrucks als ihre Grenze scheuet. Wenn Laokoon also seufzet, so kann ihn die Einbildungskraft schreien hören; wenn er aber schreiet, so kann sie von dieser Vorstellung weder eine Stufe höher, noch eine Stufe tiefer steigen, ohne ihn in einem leidlichern, folglich uninteressantern Zustande zu erblicken. Sie hört ihn erst ächzen, oder sie sieht ihn schon tot.
Ferner. Erhält dieser einzige Augenblick durch die Kunst eine unveränderliche Dauer: so muß er nichts ausdrücken, was sich nicht anders als transitorisch denken läßt. Alle Erscheinungen, zu deren Wesen wir es nach unsern Begriffen rechnen, daß sie plötzlich ausbrechen und plötzlich verschwinden, daß sie das, was sie sind, nur einen Augenblick sein können; alle solche Erscheinungen, sie mögen angenehm oder schrecklich sein, erhalten durch die Verlängerung der Kunst ein so widernatürliches Ansehen, daß mit jeder wiederholten Erblickung der Eindruck schwächer wird, und uns endlich vor dem ganzen Gegenstande ekelt oder grauet. La Mettrie, der sich als einen zweiten Demokrit malen und stechen lassen, lacht nur die ersten Male, die man ihn sieht. Betrachtet ihn öftrer, und er wird aus einem Philosophen ein Geck; aus seinem Lachen wird ein Grinsen. So auch mit dem Schreien. Der heftige Schmerz, welcher das Schreien auspresset, läßt entweder bald nach, oder zerstörst das leidende Subjekt. Wann also auch der geduldigste standhafteste Mann schreiet, so schreiet er doch nicht unabläßlich. Und nur dieses scheinbare Unabläßliche in der materiellen Nachahmung der Kunst ist es, was sein Schreien zu weibischem Unvermögen, zu kindischer Unleidlichkeit machen würde. Dieses wenigstens mußte der Künstler des Laokoons vermeiden, hätte schon das Schreien der Schönheit nicht geschadet, wäre es auch seiner Kunst schon erlaubt gewesen, Leiden ohne Schönheit auszudrücken.