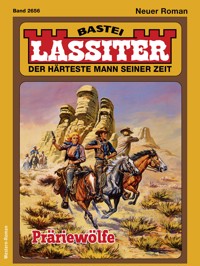1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Das durchdringende Pfeifen einer herannahenden Lokomotive ertönte. Dampfwolken breiteten sich aus, als der Zug in den Bahnhof von Ruby Hill einfuhr. Jubelnde Passagiere saßen dichtgedrängt auf den Dächern der Waggons, Arme wurden aus den offenen Fenstern gereckt. "Die nächste Fuhre ist angekommen", raunte George Sullivan. "Allmählich wird die Lage unübersichtlich und gefährlich." Sein Begleiter nickte. "Nicht mehr lange", gab Anthony Burgess zurück, "und wir sind Fremde im eigenen Land." Sullivans Tonfall wurde aggressiver. "Die Regierung mag etwas zu verschenken haben, ich aber nicht! Mir wird schlecht, wenn ich diese verdammten Europäer sehe!" Für diesen Einwand hatte Burgess nur ein mildes Lächeln übrig. "Es gibt Möglichkeiten, die Dinge zu regeln", meinte er gelassen. "Diese Zecken werden sich nicht in unserem Pelz festsetzen ..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Das Tor zum Himmel
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Das Tor zum Himmel
von Des Romero
Das durchdringende Pfeifen einer herannahenden Lokomotive ertönte. Dampfwolken breiteten sich aus, als der Zug in den Bahnhof von Ruby Hill einfuhr. Jubelnde Passagiere saßen dichtgedrängt auf den Dächern der Waggons, Arme wurden aus den offenen Fenstern gereckt.
»Die nächste Fuhre ist angekommen«, raunte George Sullivan. »Allmählich wird die Lage unübersichtlich und gefährlich.«
Sein Begleiter nickte. »Nicht mehr lange«, gab Anthony Burgess zurück, »und wir sind Fremde im eigenen Land.«
Sullivans Tonfall wurde aggressiver. »Die Regierung mag etwas zu verschenken haben, ich aber nicht! Mir wird schlecht, wenn ich diese verdammten Europäer sehe!«
Für diesen Einwand hatte Burgess nur ein mildes Lächeln übrig. »Es gibt Möglichkeiten, die Dinge zu regeln«, meinte er gelassen. »Diese Zecken werden sich nicht in unserem Pelz festsetzen ...«
Ein langer, harter Arbeitstag ging zu Ende. Pierre Foucheaux wischte sich den Schweiß von der Stirn und schälte sich aus dem Geschirr des Pfluges, mit dem er seinen Acker bearbeitet hatte. Frohgemut winkte er seiner Frau zu, die mit dem Ausnehmen eines Rindes beschäftigt war. Neben ihr saß seine Mutter auf einem Schemel, nahm die Innereien an und füllte sie in einen Bottich.
»Maman!«, rief er der alten Frau zu. »C'est plus tard! Geh ins Haus und ruh dich aus!« In der Sprache wechselte er hin und her. Einerseits wollte er seine Herkunft nicht verleugnen, andererseits aber bei den Amerikanern nicht den Eindruck erwecken, sich nicht anpassen zu wollen. Immerhin hatte er in Ruby Hill die Erfahrung gemacht, dass die Einheimischen seine Bemühungen zu schätzen wussten, wenn er auch seinen französischen Akzent nicht ablegen konnte.
»Ich bin auch gleich fertig!«, sagte seine Frau Audrey laut. »Ich salze die Rinderhälften noch ein, ehe ich sie morgen portionsweise zuschneide!«
Es war erstaunlich, dass Audrey die fremde Sprache deutlich besser beherrschte als Pierre selbst. Wenn man nicht genau hinhörte, hätte man sie für eine Amerikanerin halten können. Foucheaux war aber sicher, dass er in den kommenden Monaten und Jahren kaum mehr als Zuwanderer identifiziert werden konnte. Lediglich seine Mutter weigerte sich, ihre französischen Wurzeln abzulegen. Das aber war verschmerzbar, denn sie würde sich lediglich auf der kleinen Farm aufhalten und so gut wie keinen Kontakt zu den vor Ort ansässigen Menschen pflegen.
Das, was Pierre Foucheaux bedrückte, hatte einen ganz anderen Ursprung. Er und seine Familie waren jetzt seit fast einem halben Jahr in Nevada, doch es reichte kaum zum Überleben. Das Stückchen Land, das er von der Regierung bekommen hatte, warf einfach zu wenig Ertrag ab. Zusätzlich gab es eine Menge Menschen, die lieber von ihren Landsleuten kauften und nicht bei Einwanderern. Es war abzusehen, dass der Traum von einem unbeschwerten Leben in nicht weit entfernter Zukunft platzen würde wie eine Seifenblase. Und das machte ihm Angst.
»Schau nicht so verloren«, sagte Audrey. »Wir haben einen großen Schritt in die Freiheit getan. Nichts kann uns jetzt noch von unserem Glück abhalten. Ich möchte Kinder mit dir, Pierre. Und ich möchte, dass es ihnen für immer gutgeht ...«
Pierre Foucheaux nahm seine Frau in den Arm und küsste sie. Die dunklen Wolken über seinem Verstand aber ließen sich auf diese Weise nicht vertreiben. »Ich will das, was du auch willst, ma chère«, flüsterte er und streichelte Audrey übers Haar. »Ich sehe nur nicht, dass wir irgendwie weiterkommen! Wovon wollen wir unsere Kinder ernähren? Es reicht ja kaum für uns drei!«
Ein hintergründiges Lächeln huschte über die Züge der dunkelhaarigen Frau. »Wir können alles schaffen, was wir uns vornehmen«, erwiderte sie sanft. »Wir müssen es nur wollen. – Willst du es auch, Pierre? Willst du diese Chance zusammen mit mir ergreifen?«
Audreys Charme war nur wenig entgegenzusetzen. Pierre Foucheaux wollte auf der Stelle zustimmen, doch eine Bewegung, die er aus dem Augenwinkel wahrnahm, ließ ihn innehalten. Er drehte seinen Kopf einer Hügelkette zu und erkannte zwei Reiter, die sich schnell näherten.
Sofort nahm ihn ein Gefühl der Beklemmung gefangen. »Schnell, Audrey!«, stieß er aus. »Decke die Rinderhälften mit einer Plane ab! Ich werde die Innereien mit meiner Mutter ins Haus schaffen!« Er packte einen Griff des Bottichs und zerrte daran. Der Ruck war derart heftig, dass das Behältnis zur Seite fiel und seinen Inhalt über den ausgedörrten Boden ergoss.
Audrey Foucheaux wusste genau, worum es ging. Sie verschwand hinter dem Haus und kam mit einer schweren Plane zurück. Unter Einsatz all ihrer Kräfte versuchte sie, das Fleisch dahinter zu verbergen.
»He, ihr!«, hallte plötzlich ein Ruf heran. Er kam von einem der beiden Reiter, die bedrohlich nahegekommen waren. »Hört mit den dummen Spielen auf! Wir haben längst gesehen, dass ihr ein Rind ausgeweidet habt!«
Pierre Foucheaux war es, als würde Eiswasser durch seine Venen fließen. Er scheuchte seine Mutter ins Haus und stellte sich schützend vor seine Frau. »Wir hatten keine Wahl!«, platzte es aus ihm heraus. »Wir leiden Hunger und mussten eines der Rinder töten! Ist es in eurem Land verboten, seinen Unterhalt zu bestreiten?«
Die zwei Reiter zügelten ihre Pferde. Beide hielten Schrotflinten in der Armbeuge. »Ein Mann muss tun, was ein Mann nun mal tun muss«, kam es zurück. »Wenn es aber gegen das Eigentum von Mr. Sullivan geht, sieht die Sache anders aus. Pferde- und auch Rinderdiebstahl wird mit dem Tode bestraft! Wir könnten euch erschießen und hätten vom Gesetz nichts zu befürchten!«
»Nein!«, entfuhr es Pierre Foucheaux. »Lassen Sie Gnade walten! Es war Ihre Regierung, die uns gelockt hat! Wir versuchen doch nur, zu überleben!«
»Mr. Sullivan versucht das ebenfalls«, kam die prompte Erwiderung. »Allerdings hatte er es bisher nicht nötig, von anderen zu stehlen ...«
Foucheaux rückte noch näher an seine Frau heran, breitete die Arme aus und schloss seine Augen. Ihm war klar, dass er mit diesen Männern nicht verhandeln konnte. Sie waren nicht gekommen, um zu reden, sondern um zu töten!
Mehrmals hintereinander donnerten die Schrotflinten. Für einen winzigen Moment spürte Foucheaux, wie sein Körper regelrecht zerfetzt wurde. Und noch ehe sein Geist für immer in der Dunkelheit verschwand, hörte er noch die gequälten Schreie seiner Frau und seiner Mutter.
Dann war nichts mehr!
✰
Der Festsaal war bis zum Bersten gefüllt. Auf den stufenförmig angeordneten Sitzreihen hatten sich Männer und Frauen jeglicher Herkunft niedergelassen. Sie klatschten und bewegten sich rhythmisch zu den Klängen einer Kapelle, die mit ihren Instrumenten klassische Musik anstimmte. Unter großem Beifall trat ein Mann hervor, der auf ein schmales Podest zustrebte und sich vor eine Kanzel stellte. Er hob beide Hände und gebot den Beifallsstürmen Einhalt.
»Ich bin aufs Höchste erfreut«, begann der Mann seine Rede, »dass sich derart viele Menschen eingefunden haben, um mit mir – eurem Bürgermeister – das fünfzigjährige Bestehen unserer Gemeinde zu feiern. Wir alle haben viele neue Freunde gefunden, darunter eine Menge Europäer, die unseren Lebensstil teilen und mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft geworden sind. Sie haben unsere Kultur bereichert wie sonst niemand! Und ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, dass diese wundervollen Menschen ebenso zu Amerika gehören wie jene, die hier geboren worden sind!«
Frenetischer Applaus brandete auf. Die Kapelle spielte einen Tusch und überließ dem Mayor die weitere Gestaltung des Abends, während einschmeichelnde Töne das Festzelt erfüllten.
Viel hatte der Bürgermeister nicht mehr zu sagen, doch auch den wenigen Worten, die noch folgten, verlieh er hohes Gewicht. »Allen Versammelten wünsche ich einen außerordentlichen Abend, verbunden mit dem Wunsch, dass unser Zusammenhalt uns eint und alle Hürden niedergerissen werden, die uns bisher noch voneinander trennen mögen!«
Ein Wink des Mayors ließ die Kapelle zum Walzer aufspielen. Die Paare huschten zur Tanzfläche und wiegten sich zu den Klängen.
»Ich liebe diesen Frieden und die Ausgelassenheit!«, sagte Sandra McCormick und ließ sich beschwingt von ihrem Tanzpartner führen.
Matt Druby schenkte ihr ein Lächeln und meinte: »Und ich liebe es, mich mit dir im Kreis zu drehen. Es ist schön, den Alltag einfach einmal hinter sich lassen zu können.«
Sie tanzten zwischen den Paaren hindurch, als gebe es nur sie beide auf der Tanzfläche. Mehr als einmal trafen sich ihre Blicke in inniger Vertrautheit, doch es war stets Sandra, die sich scheinbar scheu abwandte.
Schließlich beschloss Matt Druby, aufs Ganze zu gehen. »Du weißt, was ich für dich empfinde«, flüsterte er seiner Partnerin zu. »Warum weichst du mir aus? Ich weiß doch, dass du mich auch magst. Und ich möchte, dass du meine Frau wirst ...«
Sandra McCormick kam nicht mehr dazu, eine Antwort zu geben. Plötzlich wurde der Saal von einem Mann gestürmt, der vollkommen außer Atem herausschrie: »Sie haben sie getötet! Sie haben die ganze Familie hingerichtet wie Schlachtvieh!«
Die Kapelle geriet ins Stocken. Lautes Raunen ertönte unter den Gästen.
»Die Foucheaux' sind niedergemetzelt worden!«, krakeelte der Bote in die eintretende Stille. »Ich habe ihre zerschossenen Leiber gesehen! Selbst die Mutter wurde nicht verschont!«
Es erwischte Matt Druby, als hätte man ihm einen Eispflock ins Herz getrieben. Von einem Moment auf den anderen wurde seine Tanzpartnerin zweitrangig. Er stürmte vor und packte den Verkünder der unheilvollen Botschaft bei den Schultern. »Wer steckt dahinter?«, presste er hervor. »Hast du irgendwas gesehen, Phineas?«
Vehement schüttelte der Angesprochene seinen Kopf. »Es müssen ein oder mehrere Täter gewesen sein!«, stieß er aus. »Aber als ich bei Pierre eintraf, war keiner mehr vor Ort!«
»Führ mich hin!«, forderte Druby. »Ich muss sehen, was vorgefallen ist!«
Phineas und er ritten aus der Stadt und erreichten nach einer Viertelstunde das Anwesen der Foucheaux'. Blass vor Grauen und innerlich erschüttert starrte Matt Druby auf ein Bild des Schreckens. Der Untergrund um die Leichen war von Blut durchtränkt. Nicht einmal vor der Mutter von Pierre Foucheaux hatten die feigen Mörder Halt gemacht. Ihr Gesicht war kaum wiederzuerkennen, und ihr Leib von unzähligen Schrotpartikeln zerfetzt.
»Dahinter steckt Sullivan!«, keuchte Phineas. »Darauf würde ich jeden Eid ablegen!«
Druby sah die beiden Rinderhälften und den umgestürzten Bottich mit Innereien. Es hatte tatsächlich den Anschein, als wäre dies eine Racheaktion von George Sullivan gewesen, der seinen finanziellen Verlust mit dem Tod von drei Einwanderern hatte begleichen wollen.
»Damit wird er nicht durchkommen, ganz gleich, wie viel Macht er besitzt«, brummte Druby vor sich hin. »Falls es noch Gerechtigkeit in dieser Welt gibt, werde ich dafür sorgen, dass sie Anwendung findet!« Angewidert wandte er sich ab.
»Der Sheriff ist nicht in der Stadt«, gab Phineas zu bedenken. »Es wird mindestens zwei Wochen dauern, bis er zurückkehrt.«
Matt Drubys Miene war wie versteinert. Er konnte immer noch nicht fassen, was geschehen war. Dennoch arbeitete sein Verstand auch weiterhin. »Ich werde mich um Sullivan kümmern«, raunte er bedrohlich. »Und sollte es auch das Letzte sein, was ich tue ...«
✰
Die Durchsicht seiner neuen Auftragsunterlagen hatte bei Lassiter ein Gefühl des Unwohlseins ausgelöst. Er war sich auch noch nicht sicher, wie er gerade diese Angelegenheit angehen sollte. Da waren einfach zu viele Faktoren, die eine Rolle spielten. Für einen einzelnen Mann war die Aufgabe fast schon zu groß.
Dennoch gab es einige Ankerpunkte, genauer gesagt zwei Namen. Bei ihren Trägern wollte Lassiter beginnen, aber nicht, ohne zuvor ein paar Informationen einzuholen.
Der Mann der Brigade Sieben war mit dem Zug bis Hamilton gefahren und von dort aus etwa dreißig Meilen nach Nordwesten geritten. Gerade überquerte er die Stadtgrenze von Ruby Hill, ließ seinen Grauschimmel über die staubige Straße traben und sah sich nach dem nächsten Saloon um. Lassiter war nicht durstig, wusste aber, dass eine Schänke der wichtigste Umschlagplatz war, um Auskünfte zu erhalten.
Er leinte sein Pferd am Hitchrack an, grüßte eine Lady, die über den Boardwalk stolzierte und ihm milde lächelnd einen koketten Blick zuwarf und stieß durch die Schwingtüren des Saloons. Ihn empfing eine recht angenehme Atmosphäre. Es lag nur leichter, unaufdringlicher Tabakgeruch in der Luft. Er vermischte sich mit dem Parfüm zweier Damen zu einer ungewöhnlichen, aber nicht unangenehmen Melange.
Schmunzelnd nickte Lassiter den leichtbekleideten Ladys am Tresen zu, die daraufhin verhalten kicherten, und steuerte einen Tisch an, an dem zwei Herren saßen. Der eine las Zeitung, der andere versuchte, seine Mischkünste mit einem Kartenstapel zu verfeinern.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«, fragte Lassiter. »Ich bin weit geritten und könnte gut ein wenig Gesellschaft vertragen.«
Der Mann mit dem Kartenspiel wies auf einen freien Stuhl, sein Nebenmann senkte die Zeitung ein kleines Stück und entblößte ein Paar kritisch dreinblickender Augen, die von einem runden Brillengestell eingerahmt waren. »Einen anderen Platz haben Sie nicht gefunden?«, murrte er.
»Verzeihen Sie«, entgegnete Lassiter und setzte sich ans Kopfende des Tisches. »Ihr Begleiter war so freundlich, mich an diesen Tisch zu lassen.«
»Er ist weder mein Begleiter«, kam die schnippische Antwort, »noch ist er mein Freund, mein Bruder oder gar mein Schwager. Er ist einfach ein Gast, der meine Zeitungslektüre nicht mit seinem Gerede stört!«
Kurz hob Lassiter eine Braue und wiegte seinen Kopf. »Das ist bedauerlich«, meinte er. »Ich bin fremd in der Gegend und habe gehofft, ein wenig mehr über die Stadt und ihr Umfeld zu erfahren.«
»Sie können mit mir reden«, sagte der Kartenmixer und legte seinen Stapel beiseite. Verschmitzt deutete er mit dem Daumen auf seinen Nebenmann. »Er hat sich zu mir gesetzt. Wenn ihm irgendwas nicht passt, steht es ihm frei, zu gehen.«
»Mein Name ist Lassiter«, sagte der Brigade-Agent. »Wie darf ich Sie nennen?«
»Kurt! Ich heiße Kurt. Allerdings fürchte ich, dass ich Ihnen nicht viel erzählen kann. Jedenfalls nichts, von dem ich mit Fug und Recht behaupten könnte, es würde der Wahrheit entsprechen.«
Für einen Moment wurde Lassiter stutzig, kaschierte seine Bedenken aber mit einem scherzhaften Einwurf. »Gerüchte!«, stieß er interessiert aus. »Ich liebe nichts mehr als Gerüchte!«
»Na ja«, gab Kurt zäh von sich, »es ist schon etwas mehr als ein Gerücht.« Ihm war sichtlich unwohl, und er wollte das Thema, das er angerissen hatte, nicht weiter ausbauen. »Es ist sicher besser, wenn ich Sie nicht auf eine falsche Fährte locke. Tut mir leid, wenn ich etwas angefangen habe, das ich nicht zu Ende führen kann.«
Abwehrend hob Lassiter eine Hand und schüttelte leicht den Kopf. »Irgendetwas sagt mir, dass Sie genau auf den Punkt hinauswollten, der für mich von Interesse ist. Ich bin nämlich nicht ganz zufällig in Ruby Hill ...«
Ehe er weiterreden konnte, unterbrach ihn das laute Rascheln einer Zeitung. »Die Herren werden erlauben, dass ich mir einen ruhigeren Sitzplatz suche«, sagte der Kerl mit der Nickelbrille, erhob sich stramm und blickte auf Kurt hinab. »Und Ihnen rate ich, sich nicht in die Nesseln zu setzen! Sie könnten unangenehmere Verletzungen davontragen als lediglich Pusteln und gerötete Haut.« Im Stechschritt entfernte er sich und setzte sich in den hintersten Winkel des Saloons.
Lassiter lachte in sich hinein, als eine der Damen am Tresen hüftschwingend ausgerechnet auf diesen Snob zuging. Gleich darauf aber wurde er wieder ernst und wandte sich seinem Gesprächspartner zu. Um es ihm leichter zu machen, gab Lassiter ihm ein paar Stichworte. »Sagen Ihnen die Namen George Sullivan und Anthony Burgess etwas?«, fragte er.
Es hatte den Anschein, als würde in Kurts Gesicht Blässe aufsteigen. Er nahm den Kartenstapel wieder an sich und knetete ihn mit den Fingern durch. »Manchmal bin ich ein wenig vorlaut, wenn ich lieber schweigen sollte«, sagte er mit schüchternem Lächeln, schaute Lassiter aber nicht an. »Wir feiern übrigens gerade das fünfzigjährige Bestehen dieser Gemeinde. Vielleicht möchten Sie lieber zum Festsaal gehen ...«
»Es gibt hier eine Menge Immigranten«, erwiderte Lassiter und ignorierte vorsätzlich die Aufforderung. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass ...«