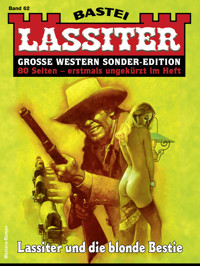
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es waren sieben Mann, und Lassiter hatte keine Chance, gegen diese wilden Burschen bestehen zu können. Denn sie hatten die Falle so raffiniert aufgebaut, dass er sich jetzt vorkam wie ein Dickhornschaf inmitten eines Wolfsrudels.
Ganz plötzlich waren sie zwischen den Felsen aufgetaucht, die sich rings um die staubige Senke auftürmten. Keiner von ihnen hatte etwas gesagt, aber Lassiter wusste auch so Bescheid.
Dies war ein Überfall.
Sie würden ihm sein Geld, sein Pferd und seine Waffen wegnehmen - und vielleicht auch sein Leben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
LASSITER UND DIE BLONDE BESTIE
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Vorschau
Impressum
LASSITER UNDDIE BLONDE BESTIE
Es waren sieben Mann, und Lassiter hatte keine Chance, gegen diese wilden Burschen bestehen zu können. Denn sie hatten die Falle so raffiniert aufgebaut, dass er sich jetzt vorkam wie ein Dickhornschaf inmitten eines Wolfsrudels.
Ganz plötzlich waren sie zwischen den Felsen aufgetaucht, die sich rings um die staubige Senke auftürmten. Keiner von ihnen hatte etwas gesagt, aber Lassiter wusste auch so Bescheid.
Dies war ein Überfall.
Sie würden ihm sein Geld, sein Pferd und seine Waffen wegnehmen – und vielleicht auch sein Leben.
Ihr Anführer, ein großer, dunkelgekleideter Mann, stand ungefähr fünf Schritt von Lassiters Pferd entfernt auf einem kegelförmigen Felsbrocken und sah Lassiter mit ironischem Grinsen an.
Und er wartete übertrieben lange, bis er endlich zu sprechen begann.
»Ein schönes Pferdchen hast du da, mein Freund«, sagte er. »Und auch alles andere, was du besitzt, gefällt mir. Der Sattel ist bestimmt seine dreihundert Dollar wert. Beste mexikanische Handarbeit, das erkennt man auf den ersten Blick. Und deinen Wildlederanzug und die Stiefel hast du ebenfalls nicht in irgendeinem billigen Store gekauft. Du scheinst mir einer von den Glückspilzen zu sein, die einen Dollar nicht erst rumzudrehen brauchen, bevor sie ihn ausgeben. Also macht es dir auch sicherlich nichts aus, wenn du uns ein wenig an deinem Glück teilhaben lässt. – Ja, du scheinst mir so etwas wie ein Wohltäter der Menschheit zu sein. Und weil du außerdem sicherlich auch noch eine gute Portion Verstand besitzt, wirst du jetzt wohl meine Bitte nicht abschlagen und ein wenig absteigen.«
Er sagte das alles mit einem kalten, zynischen Lächeln. Seine Stimme hatte sogar einen freundlichen Klang, aber Lassiter entging nicht der grausame Unterton, der in dieser Stimme mitschwang.
Dieser schwarzgekleidete Bursche war kein gewöhnlicher Straßenräuber. Der stellte etwas ganz Besonderes innerhalb seiner Zunft dar. Er war der Leitwolf eines unheimlich gefährlichen Rudels.
Lassiter blickte in die Runde. Dann zuckte er resignierend die Schultern und grinste schief.
»Du hast recht, Schwarzwolf«, sagte er. »Es bleibt mir wirklich kaum etwas anderes übrig, als besonders großzügig zu sein heute.«
Nach diesen Worten saß er ab. Er bewegte sich langsam und hütete sich, auch nur eine winzige verdächtige Bewegung zu machen.
Er kannte sich aus mit Burschen dieser Art. Sie beobachteten ihn mit angespanntem Misstrauen, und jeder von ihnen hatte den Finger am Abzug von Gewehr oder Revolver. Sie würden schießen, sobald sie das für notwendig hielten. Wahrscheinlich tat es ihnen sogar schon etwas leid, dass alles so glattging und er ihnen keinen Grund gab, auf ihn zu feuern.
Der schwarzgekleidete Boss des Rudels bewegte ein wenig den Gewehrlauf hin und her.
»Stell dich dort rüber, Mann!«, befahl er. »Ja, so ist's gut. Und jetzt schnall deinen Gurt ab!«
Lassiter war zwei Schritt vom Pferd weggetreten und löste jetzt gehorsam die Schnalle seines Revolvergurts.
Die Wachsamkeit der Banditen ließ keinen Augenblick nach. Es hatte wirklich keinen Sinn, etwas zu versuchen. Er würde schneller tot sein, als er denken konnte.
Der Boss der Schufte war sichtlich zufrieden.
»Gut so«, sagte er sanft. »Du bist wirklich ein kluger Junge. So ersparst du uns Arbeit und dir selbst eine Menge Ärger.«
»Du redest ziemlich viel«, bemerkte Lassiter trocken. »Das scheint wohl zu deinem persönlichen Stil zu gehören, wie?«
Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich sekundenlang.
»Du hast recht«, sagte er dann. »Ich rede wirklich zu viel. Das hält uns alle nur unnötig auf. – Machen wir also kürzer.«
Lassiter hörte hinter sich gleitende Schritte. Er ahnte, was auf ihn zukam, duckte sich instinktiv und warf sich zur Seite. Im selben Augenblick krachte etwas hart gegen seinen Kopf. Vor seinen Augen zerplatzte ein Feuerball, und er sah die Erde auf sich zurasen.
Wie aus weiter Ferne hörte er seinen eigenen heiseren Schrei, und dann wurde es endgültig Nacht um ihn.
Er merkte nichts von dem, was die Banditen mit ihm anstellten.
Als er wieder zu sich kam, verspürte er zunächst ein dumpfes, undefinierbares Brausen in seinem Schädel. Er erinnerte sich nur langsam wieder an das, was geschehen war.
Mühselig drehte er den Kopf einmal nach links und einmal nach rechts. Dann setzte er sich stöhnend auf und hatte dabei das Gefühl, sein Kopf würde in tausend Stücke platzen, wenn er noch eine einzige unvorsichtige Bewegung machte.
Um ihn herum brandete Gelächter auf und dröhnte in seinen Ohren. Wie durch Nebel sah er die sieben Banditen, die auf ihren Pferden saßen. Der Boss selbst hatte sich auf Lassiters Rappen geschwungen. Ein anderer Kerl setzte sich gerade Lassiters teuren Stetson auf und warf seinen eigenen speckigen Filz zu Lassiter hinüber.
Lassiter blickte an sich herunter und knurrte einen Fluch. Das einzige Kleidungsstück, das ihm die Schufte gelassen hatten, war die lange rote Drillichunterhose, in der er nicht gerade einen erhebenden Anblick bot.
Alles andere hatten ihm die Schufte genommen. Seine teuren Stiefel, den Hut, den handgearbeiteten Anzug aus Wildleder, das Hemd, die Waffen. Und natürlich das Pferd.
Es war klar, dass die Banditen das als einen gewaltigen Spaß betrachteten. Gleich würden sie ihn allein lassen. Vielleicht aber gaben sie sich damit nicht zufrieden und trieben ihn erst etliche Meilen vor sich her über Stock und Stein.
Der einzige Trost, der Lassiter verblieben war, lag darin, dass sie ihm das Leben lassen wollten. Und das war schon eine ganze Menge.
Langsam hob Lassiter den Kopf und sah den Boss der Halunken an, der hoch über ihm auf dem schwarzen Pferd thronte.
Der Mann hob kurz die Hand, und das Gelächter der anderen verstummte.
»Du kannst jetzt verschwinden, Mister!«, sagte er zu Lassiter. »Und zwar in die Richtung, aus der du gekommen bist. An dieser Stelle beginnt verbotenes Gebiet. – Hast du das nicht gewusst? Du kommst doch aus der Richtung von Iron Springs. Haben dir da die Leute nicht gesagt, dass es gefährlich ist, nach Norden in die Berge zu reiten?«
Lassiter hielt dem stechenden Blick des Bandenführers gelassen stand. Natürlich hatte er in Iron Springs, der Stadt, die zwanzig Meilen weiter südlich lag, von dem sogenannten ›verbotenen Gebiet‹ gehört. Trotzdem war er losgeritten. Aus einem ganz besonderen Grunde.
»Nein«, sagte er ruhig. »Ich habe nichts davon gehört. – Wer bist du überhaupt? Welches Interesse hast du daran, keinen Fremden in dieses Gebiet zu lassen?«
»Ich bin Jack Naruga.«
»Und ich bin Lassiter. Merk dir den Namen gut, Naruga! Eines Tages sehen wir uns wieder. Und das wird gar nicht mehr lange dauern. Mein Wort darauf.«
Naruga lachte.
»Du willst mir drohen?«, rief er. »Das ist verdammt mutig von dir, Lassiter. Hast du noch nicht erkannt, dass ich dich auf der Stelle töten könnte?«
»Warum tust du es nicht, Naruga?«
»Ich habe es nicht nötig. Denn du kannst mir nicht gefährlich werden. Wir brauchen niemanden zu fürchten.«
»Du scheinst auf einem verdammt hohen Ross zu sitzen«, knurrte Lassiter wütend. »Was ihr hier gemacht habt, ist Wegelagerei. Ich könnte in Iron Springs den Sheriff benachrichtigen. Für das, was ihr mit mir gemacht habt, würdet ihr ein paar Jahre die Welt durch Eisengitter betrachten müssen.«
Jack Naruga grinste niederträchtig.
»Du könntest – und wir würden«, sagte er. »Aber du wirst uns nicht anzeigen, das steht fest. Ich weiß über dich Bescheid, Lassiter. Du hast selbst genug Ärger mit Sternträgern und Wells-Fargo-Agenten. Oder bist du nicht der Lassiter, den ich meine?«
»Schon möglich«, brummte Lassiter.
»Na also«, sagte Naruga zufrieden. »Du bist der berüchtigte Lassiter. Der Mann, der immer wieder gejagt wird und nirgendwo Ruhe findet. Mir brauchst du nichts vorzumachen. Ich kenne mich aus mit Burschen von deinem Kaliber. Nach allem, was ich so von dir gehört habe, bist du mir noch nicht einmal unsympathisch. – Aber du bist ein Wolf, Lassiter. Ein richtiger zweibeiniger Wolf. Nein, du bist sogar mehr als nur ein Wolf. In dir ist noch ein gehöriger Schuss Pumablut und Klapperschlangengift. Ha, ich überlege, ob ich dich nicht doch noch erschießen soll. Es wäre vielleicht wirklich besser für uns alle.«
Er zog aufreizend langsam den Revolver aus dem tief ausgeschnittenen Holster. Lassiter wurde innerlich steif.
Er erkannte, dass Naruga keine leeren Worte gesprochen hatte. Und er wusste nur zu gut, wer Jack Naruga war. Er trug den Beinamen Tonto-Jack. War mit Sicherheit einer der gefährlichsten, grausamsten und durchtriebensten Burschen, von denen Lassiter je gehört hatte.
Nach außen hin blieb Lassiter ruhig, und er hielt auch weiterhin dem Blick des Banditenbosses stand.
Er wusste, dass es Tonto-Jack Naruga nichts ausmachen würde, ihn auf der Stelle zu erschießen.
Die nächsten Sekunden würden die Entscheidung bringen.
Was mochte jetzt im Kopf dieses Mannes vorgehen?
Welchen Entschluss würde er fassen?
»Was meinst du, Lassiter?«, fragte er zynisch. »Ist es nicht vielleicht für mich und alle anderen besser, wenn ich Geierfraß aus dir mache?«
»Deine Sache«, antwortete Lassiter kalt. »Wenn du mich jetzt nicht umlegst, werde ich Jagd auf dich machen. Und ich werde mir alles zurückholen, was du mir genommen hast. Mit Zinsen, versteht sich.«
Er sprach absichtlich so herausfordernd. Denn er war der Meinung, dass so etwas die beste Wirkung auf einen stolzen Burschen wie Tonto-Jack Naruga haben würde.
Stolze Raubritter wie er liebten es, eine scharfe Herausforderung anzunehmen.
Tonto-Jack überlegte eine Weile.
Dann sagte er langsam: »Du bist schlau, Lassiter. Du bist wirklich ganz verdammt schlau. Du verstehst es, einen Mann an der richtigen Stelle zu packen. – Aber gut. Ich nehme die Herausforderung an. Irgendwie fängt die Sache an, mir Spaß zu machen. Was hältst du von einer kleinen Wette, Lassiter?«
Lassiter grinste bissig. »Hast du schon mal einem nackten Mann was aus der Tasche holen können, Naruga?«, fragte er knurrend. »Ich mache dir einen Gegenvorschlag. Gib mir meine Sachen zurück. Mein Pferd, die Waffen und alles andere. Und dann lässt du mich mit euch reiten. Was passiert ist, wollen wir dann vergessen.«
Tonto-Jacks Gesichtsausdruck verriet wieder Misstrauen.
»Bist du auf der Flucht?«, wollte er wissen.
»So kann man es nennen«, antwortete Lassiter.
»Wells Fargo wieder mal?«
»Nicht Wells Fargo und auch nicht das Gesetz. Ich habe in der Nähe von Santa Fé ein Mädchen kennengelernt. Nicht mehr ganz jung, aber verdammt reich. Sie wollte mich unbedingt heiraten, aber ich hatte nicht die richtige Lust und bin abgehauen. Jetzt will sie aus Rache meinen Skalp. Zwei ihrer Schießer haben mich vor drei Tagen in Durango aufgespürt. Ich hatte Glück und war schneller. Jetzt liegen sie beim Doc. Sie haben mir alles erzählt, nachdem ich sie von den Beinen geholt hatte. Von ihnen weiß ich auch, dass die junge Lady mich tot sehen will.«
Tonto-Jack lachte.
»So was ist mir auch schon mal passiert«, erzählte er. »Ich bin damals fünfhundert Meilen weit geritten, bis ich endlich wieder meine Ruhe hatte. Ja, manche Weiber sind verdammt schlimm. Was die einmal an der Angel zu haben glauben, wollen sie um keinen Preis mehr freigeben.«
Er stieß noch einmal ein kurzes, raues Lachen aus, wurde dann aber schlagartig wieder ernst.
»Nein, Lassiter!«, knurrte er. »Daraus wird nichts. Mit mir können nur Burschen reiten, zu denen ich hundertprozentiges Vertrauen habe. Und das ist bei dir nicht der Fall. Irgendetwas an dir warnt mich. – Hau jetzt ab, Hombre! Sieh zu, wie du irgendwie zurechtkommst. Ich bin verdammt gespannt, ob wir uns noch einmal wiedersehen. Ich wette meinen Kopf, dass du es niemals schaffen wirst, überhaupt jemals wieder in meine Nähe zu kommen.«
Er trieb sein Pferd auf Lassiter zu und holte plötzlich eine zusammengerollte Treiberpeitsche hinter dem Gürtel hervor.
»Lauf, Lassiter!«, schrie er. »Oder ich mache dir Beine!«
Die Peitschenschnur zerschnitt pfeifend die Luft.
Lassiter sprang auf und rannte los. Trotzdem konnte er dem ersten Peitschenhieb nicht entkommen. Es gab ein klatschendes Geräusch, und die Lederschnur ließ die Haut auf seinem Rücken aufplatzen. Ein beißender Schmerz fraß sich durch seinen Körper.
Er biss die Zähne zusammen und lief, so schnell er konnte.
Das höllische Gelächter der wilden Meute schmerzte seinen Ohren. Es war eine Demütigung, wie er sie noch nie erlebt hatte. Wie ein räudiger Köter wurde er davongejagt und hatte nicht die geringste Chance, sich zu wehren.
Noch mehrmals klatschte die Peitsche auf seinen nackten Rücken. Tonto-Jack Naruga blieb solange hinter ihm, bis er die steinige Senke verlassen hatte.
»Lauf!«, schrie er höhnisch. »Und lass dich nie wieder hier blicken! Beim nächsten Mal werde ich dir die Haut in Streifen schneiden.«
Lassiter bewegte sich über spitze Steine, und seine Füße wurden von scharfen Dornen aufgerissen. Aber er spürte weder diesen Schmerz noch das Beißen der Peitschenhiebe auf seinem Rücken.
Schlimmer als alles andere war die Wut über die Demütigung, die ihm widerfahren war.
In seinem Herzen brannte der Hass, während das Hohngelächter der wilden Horde hinter ihm verklang.
Er befand sich in einem schmalen Canyon, der in vielen scharfen Windungen nach Süden verlief. Zwei Meilen war der Canyon lang. Dahinter mündete er in ein karges, staubiges Tal, das sich wie ein riesiger Trichter immer mehr nach Süden hin öffnete. Es gab dort kein Wasser, nur rötlich-braune Erde, die von Dornbüschen und gelbverbranntem Bunchgras bedeckt war. Hier und da wucherten ein paar größere Büsche oder reckten sich ein paar vereinzelte, windzerzauste Bäume einsam in das Blau des hitzeflimmernden Himmels.
Lassiter marschierte, bis er das Ende des schmalen Canyons erreicht hatte.
Als sich vor ihm der Blick auf das trostlose Tal öffnete, ließ er sich auf einem Stein nieder, um sich auszuruhen und zu überlegen.
Grimmig blickte er an sich herab.
War er nicht schon jetzt so gut wie verloren?
Ein Kojote, ein streunender Wolf oder ein angriffslustiger Puma konnten ihm schon bald zum Verhängnis werden. Oder ein Schlangenbiss. Vielleicht auch ein Rudel Rothäute, die sich einen Spaß daraus machen würden, ihn einzufangen und ihm die Kopfhaut abzuziehen.
»Sei verdammt, Tonto-Jack!«, knurrte er vor sich hin. »Dafür sollst du in der Hölle schmoren.«
Dann dachte er daran, dass er eigentlich noch großes Glück gehabt hatte. Dass er den Ritt in den Canyon gewagt hatte, war ihm um ein Haar zum tödlichen Verhängnis geworden.
Damit hatte er keine Sekunde lang gerechnet.
Das Land, das hinter diesem Canyon begann, gehörte doch dem Mann, der ihm einen Brief geschickt hatte.
Lassiter kannte diesen Mann nicht. Er wusste nur, dass er sehr reich war und dringend Hilfe benötigte.
Den betreffenden Brief hatte Lassiter von einem Mittelsmann bekommen. Das war an sich nichts Außergewöhnliches. Es kam immer wieder vor, dass ein Mann Hilfe brauchte und sich nach einem geeigneten Partner umsah. In diesem Fall hatte Lassiter das Angebot bekommen.
Und er hatte angenommen, weil er Geld brauchte.
Der Schreiber des Briefes hatte ihm zehntausend Dollar angeboten, und das war eine Summe, mit der man eine ganze Weile gut leben konnte.
Über seine Sorgen hatte er so gut wie gar nichts mitgeteilt. Trotzdem witterte Lassiter vom ersten Augenblick an etwas Besonderes hinter diesem Schreiben. Das war nicht eine der üblichen Aufforderungen, seinen Revolver gewissermaßen zu vermieten.
Hier ging es um mehr, das spürte Lassiter mit scharfem Instinkt.
Während er beim Canyonausgang auf einem Stein saß und sich die wundgescheuerten Füße rieb, fielen ihm wieder die wesentlichen Sätze aus dem Schreiben des Unbekannten ein.
Reiten Sie von Iron Springs nach Norden. Sie müssen durch den Bone Canyon, um auf mein Land zu kommen. Es könnte Schwierigkeiten für Sie geben. Aber was immer auch geschieht, verraten Sie keinem Menschen, dass ich Sie erwarte. Alles muss äußerst geheim bleiben ...
Lincoln F. Miles
Lassiter hatte sich daran gehalten und geschwiegen, als ihn die wilden Burschen gestellt hatten.
Er fragte sich, was in diesem sogenannten ›verbotenen Gebiet‹ los war.
Wurde es von Banditen beherrscht? Kontrollierte Tonto-Jack Naruga vielleicht das Land mit seinen Halunken, während er jenen Lincoln F. Miles terrorisierte und von ihm seinen Tribut forderte?
Lassiter hatte ähnliche Zustände schon erlebt, wo Banditen das Land beherrschten und andere Menschen gnadenlos unter ihre Knute zwangen. Aber so etwas ging meistens nur kurze Zeit gut. So lange, bis ein paar Marshals oder andere Gesetzesvertreter aufkreuzten und dem Spuk ein schnelles Ende bereiteten.
In diesem Falle schien mehr dahinter zu stecken.
Lassiter hatte sich in Iron Springs unauffällig nach Lincoln F. Miles erkundigt. Man kannte den Rancher in der Stadt, und niemand sprach schlecht über ihn. Nur eine Tatsache kreidete man ihm an, ohne sich jedoch sonderlich darüber aufzuregen. Es war etwas, wozu jeder ein gutes Recht hatte, und die Leute in Iron Springs nahmen es als gegeben hin. Nämlich den Umstand, dass der Rancher sein Land zum ›verbotenen Gebiet‹ erklärt hatte.
Er wollte eben allein sein. Und wenn sich doch einmal ein Unbefugter auf seinem Land verirrte, wurde er davongejagt. Das Weideland in den Tälern nördlich des Bone Canyons war nun mal sein Eigentum, und jeder Mensch hatte das Recht, andere Leute von diesem Besitz fernzuhalten.
Gedankenverloren starrte Lassiter vor sich hin.
Wenn er es recht betrachtete, gab es nur die eine Möglichkeit, dass der Rancher auf irgendeine Art von Banditen erpresst wurde. Die Schufte hatten ihn gezwungen, jenes Verbot auszusprechen. Und sie hatten ihn so in der Hand, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als zu gehorchen. Er konnte sich frei bewegen, durfte die Städte in der Umgebung besuchen und stand nach außen hin als reicher, angesehener Mann da.
Wahrscheinlich wurde er ständig von den Halunken beobachtet, so dass es ihm unmöglich war, mit irgendjemand über seine Sorgen zu sprechen.
Den Brief hatte er wohl nur durch einen glücklichen Zufall herausschmuggeln können.
Lassiter hatte den Brief von Jeremy Swanson bekommen, einem guten alten Bekannten in Santa Fé. Und Jeremy Swanson wiederum hatte ihn von einem seiner Freunde, der Lincoln F. Miles von früher her gut kannte.
Inzwischen war das Schreiben schon zwei Monate alt. Eine Zeitspanne, in der sich vieles geändert haben konnte.
Vielleicht hatte Lincoln F. Miles inzwischen längst seine Meinung geändert. Vielleicht brauchte er gar keine Hilfe mehr und hatten sich seine Probleme auf andere Art gelöst.
Seufzend ließ Lassiter seinen Blick über die weite, trostlose Senke schweifen.
Noch zwanzig Meilen bis Iron Springs. Und das auf nackten Füßen über schroffes Gestein und harte, mit Dornen und Disteln bedeckte Erde. Der Weg würde eine Hölle für Lassiter bedeuten, aber ihm blieb keine andere Wahl. Er musste zurück nach Iron Springs.
Wenn er Pech hatte, würden sie ihn dort davonjagen wie einen verkommenen Köter. Unter Umständen sperrte ihn der Sheriff sogar ein wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
»O Hölle!«, seufzte der große Mann und machte sich auf den Weg.
II
Als sich die Sonne senkte, hatte er seiner Schätzung nach noch nicht mehr als höchstens zehn Meilen zurückgelegt. Also erst die Hälfte der Strecke bis Iron Springs.
Es war wirklich die Hölle. Seine Füße brannten, als hätte man sie über einem Feuer geröstet. Seine Kehle war so ausgetrocknet wie das Land, durch das er marschierte.
War er überhaupt schon so weit gekommen, wie er glaubte? Er begann daran zu zweifeln, denn die vielen kleinen Umwege, die er hatte machen müssen, kosteten doch viel Zeit.
Wieder einmal blieb er auf einem der zahlreichen steinigen Hügel stehen und spähte in die Ferne. Nirgends war eine Spur von Leben zu entdecken. Nichts als rotbraune, trostlose Einsamkeit umgab ihn.
Er marschierte weiter und dachte an angenehmere Dinge, um die Schmerzen und den Durst zu vergessen. Dabei beobachtete er ständig aufmerksam den Boden. Nicht allein wegen der Disteln und Dornen, deren Ranken sich oft so dicht an den roten Erdboden schmiegten, dass man sie leicht übersehen konnte.
Gefährlicher waren Schlangen und Skorpione, die es in der Einöde mit tödlicher Sicherheit gab. Ein Biss einer Klapperschlange oder giftigen Viper würde genügen, und Lassiter brauchte sich keine weiteren Gedanken mehr über Lincoln F. Miles oder sonst etwas auf der Welt zu machen.
Plötzlich blieb der große Mann stehen.
Aus den Augenwinkeln hatte er eine Bewegung wahrgenommen. Irgendwo im Westen.
Und dann sah er die Reiter.
Ihre Silhouetten hoben sich deutlich vor dem rotflammenden Hintergrund des Abendhimmels ab.
Er zählte sieben Mann.
Sie kamen von Süden herauf und bewegten sich langsam in nördlicher Richtung.
Wenn sie die Richtung beibehielten, würden sie in einer halben Stunde auf einer Höhe mit Lassiter sein. Das wiederum bedeutete, dass er auf die Reiter stoßen würde, wenn er sich jetzt nach Westen wandte und sich möglichst schnell vorwärtsbewegte.
Lassiter zögerte noch.
Hatte das überhaupt einen Sinn?
Es gab doch kaum einen Zweifel daran, dass das Ziel der Reiter der Bone Canyon war. Dass sie also ins verbotene Gebiet von Lincoln F. Miles wollten. Und dass sie zu diesen Leuten gehörten.
Zum Teufel mit all diesen Gedanken!
Der große Mann setzte sich in Bewegung. Er wollte wenigstens versuchen, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Mit großen Schritten marschierte er in die nächste Senke hinab, in die das rote Sonnenlicht schon nicht mehr hineinreichte.
Für ihn war das ein günstiger Umstand. Er würde sich auch von jetzt an weiterhin so bewegen, dass ihn die fremden Reiter vorerst nicht sehen konnten.
Geduckt hastete er zwischen Dornensträuchern und ausgetrockneten Creosotbüschen dahin. Er machte sich noch nicht die geringsten Gedanken, wie er sich den Reitern nähern konnte. Das würde sich ergeben, sobald der Zeitpunkt gekommen war.





























