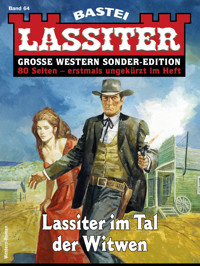
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Plötzlich hielt die schöne Witwe einen Derringer in der Hand. "Jetzt ist es aus, Lassiter", sagte die Frau eisig. "Du hättest niemals in unser Tal kommen dürfen. Hier hat auf dich von Anfang an der Tod gewartet. Das hast du gewusst, aber du hast es trotzdem riskiert. Und dafür musst du bezahlen!" Lassiters Blick glitt über Marianas vollendete Gestalt. Welch ein verdammter Narr war er doch gewesen. Selbst seine Feinde hatten ihm geraten, nicht ins Tal der Witwen einzudringen. Jetzt sah er dem Tod ins Auge...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
LASSITER IM TAL DER WITWEN
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Vorschau
Impressum
LASSITER IM TALDER WITWEN
Seine verzweifelte Stimme gellte durch die mondhelle Nacht. »Lasst mich leben! Bitte, lasst mich doch leben!«
Er war noch ein Junge, kaum älter als achtzehn. Sein Gesicht war bleich und von Todesangst gezeichnet. Mondlicht sickerte durch das Geäst der mächtigen Burreiche. Von einem der Äste hing die fertig geknüpfte Henkerschlinge herab und schaukelte leicht im Nachtwind hin und her.
Vier Mann standen um das Pferd herum, auf dessen blanken Rücken sie den Jungen gesetzt hatten. Einer packte das Tier am Kopfgeschirr und führte es unter die baumelnde Schlinge. Ein anderer Mann schwang sich auf sein Pferd, trieb es an die Seite des Jungen, griff nach dem Lasso und streifte dem Todeskandidaten die Schlinge über den Kopf.
Der Junge schrie nicht mehr. Er wimmerte nur noch. Seine Lippen bebten, und seine Zähne schlugen klappernd aufeinander.
Der Mann auf dem gesattelten Pferd zog die Schlinge fest und drehte sie, bis der dicke, fachgerecht geknüpfte Knoten ein Stück hinter dem rechten Ohrläppchen gegen das Genick des Verurteilten stieß. Die Bewegungen des Henkers waren schnell und gekonnt, wurden mit routinehafter Geschicklichkeit ausgeführt.
Jetzt lenkte er sein Pferd etwas zur Seite.
»Das wär's dann«, sagte er rau und nahm die aufgerollte Rinderpeitsche vom Sattelhaken.
In wenigen Sekunden würde der geflochtene Lederriemen durch die Luft sausen und auf das Pferd des Jungen klatschen. Und dieser Schlag würde gleichzeitig das Ende eines Menschen bedeuten.
Der Junge presste die Zähne fest aufeinander. Sein schlanker Körper verkrampfte sich. Er wusste, dass es keine Hoffnung mehr für ihn gab, und doch sträubte sich alles in ihm, jetzt schon von der Welt Abschied nehmen zu müssen. Der Henker hob den Arm mit der Peitsche.
Im selben Augenblick zerriss das Krachen eines Gewehrschusses die angespannte Stille.
Der Peitschenmann schrie auf und schwankte im Sattel. Er ließ die Peitsche fallen und presste die linke Hand auf den rechten Oberarm. Blut quoll dunkel zwischen seinen Fingern hervor.
Der Junge, der vor Angst schon halbtot gewesen war, lebte wieder auf. Er erkannte seine Chance, wusste aber auch um die Gefahr, in der er noch immer schwebte. Sie kam nicht von den vier Männern, sondern diesmal von seinem eigenen Pferd. Durch den plötzlichen Schuss und den lauten Schmerzensschrei des Getroffenen war es zusammengezuckt, tänzelte nervös und drohte jeden Moment unter dem Jungen durchzugehen.
Er presste fest die Schenkel an den Tierleib. Es war das einzige, was er tun konnte, und das Pferd wurde allmählich ruhiger.
Der Peitschenmann saß schwankend im Sattel.
Ein paar Schritte von seinem Pferd entfernt standen reglos seinen drei Kumpanen. Die drei hielten Gewehre in den Händen, aber die Mündungen der Waffen waren gegen die Erde gerichtet. Und niemand dachte daran, etwas zu unternehmen.
Sie konnten den Unbekannten nicht sehen, der aus der Dunkelheit auf sie geschossen hatte. Er befand sich irgendwo am westlichen Talhang inmitten der dunklen Tannen, die dort wie eine dunkle Wand in den mondhellen Himmel ragten.
»Werft die Gewehre weg!«, meldete er sich jetzt endlich. »Und werft eure Gurte mit den Revolvern hinterher. Bleibt dort stehen, wo ihr gerade seid! Ich kann jeden von euch klar und deutlich sehen. Eine verdächtige Bewegung, und es knallt wieder.«
Die vier Männer starrten in die Richtung, aus der die Stimme kam.
»Was meinst du, Rob?«, fragte einer von ihnen, und er meinte den verwundeten Mann auf dem Pferd. »Wollen wir's drauf ankommen lassen? Es scheint nur einer zu sein.«
Er sprach so leise, dass es der unbekannte Schütze nicht hören konnte. Trotzdem reagierte der Mann im Wald.
»Ich warne euch!«, brüllte er, aber für die vier Burschen unter dem Galgenbaum gab es kein Zurück mehr.
Wie auf ein geheimes Kommando rissen sie ihre Gewehre hoch und begannen zu feuern. Das wilde Stakkato der Schüsse zerfetzte die Nacht.
Männer schrien getroffen auf, taumelten, behinderten sich gegenseitig in ihren Aktionen.
Der gefesselte Junge kämpfte mit seinem immer nervöser werdenden Pferd. Das Tier drängte nach vorn, schien sich durch nichts aufhalten lassen zu wollen, und der Junge presste ihm hart die Schenkel gegen den Leib, fluchte, bettelte, sprach beruhigend auf den braunen Wallach ein.
Es waren für ihn mit Sicherheit die schlimmsten und längsten Minuten seines jungen Lebens. Minuten, die er niemals vergessen würde.
Der Strick spannte sich immer mehr. Der Junge bekam kaum noch Luft.
»Lieber Gott, hilf mir!«, röchelte er, und die blauen Augen schienen ihm aus den Höhlen zu quellen.
Die Schüsse verstummten.
Der Peitschenmann war vom Pferd gestürzt. Zwei seiner Partner bewegten sich nicht mehr. Er selbst und ein anderer Mann stöhnten gequält und waren nicht mehr fähig zu kämpfen.
Hufschlag näherte sich. Ein Reiter tauchte im Blickfeld des Jungen auf. Es war ein großer Mann. Ein schwarzer Umhang hüllte seinen Körper ein. Auf seinem Kopf saß ein breitkrempiger schwarzer Hut. Das Pferd war ebenfalls schwarz und ohne die geringste Zeichnung.
Der Junge starrte ihn an, als hätte er soeben ein Gespenst erblickt. Er konnte sich kaum noch auf dem Rücken seines Wallachs halten. Sein Oberkörper neigte sich mehr und mehr nach hinten.
Er wusste, dass es um Bruchteile von Sekunden ging, die ihn vom Tod trennten.
Der schwarze Reiter jagte heran. Schweigend. Im Mondlicht blitzte sekundenlang die lange Klinge eines Messers auf. Dann ein rascher Schnitt, und das Seil riss entzwei wie die Saite einer Gitarre.
»Santa Maria!«, schrie der Junge und fiel rücklings vom Pferd, als der Druck der Schlinge so jäh nachließ.
Der Schwarzgekleidete warf nur einen kurzen Blick auf ihn, sprang von seinem Rappen und kniete gleich darauf neben ihm nieder.
»Rafael Guerras, nicht wahr?«, fragte er ruhig.
Der Junge starrte ihn fassungslos an. »Sie kennen mich? Wer sind Sie, Señor? Hat man Sie etwa ...«
Er musste husten. Durch sein hastiges, keuchendes Atmen war feiner Staub in seinen Hals gedrungen.
Der Schwarzgekleidete nickte lässig.
»Ja, man hat mich geschickt, um nach dir Ausschau zu halten«, sagte er. »Die Frauen haben dich vermisst. Du warst schon seit Stunden überfällig. Deshalb waren sie besorgt um dich.«
»Wer sind Sie, Señor? Ich habe Sie nie im Tal gesehen. Sind Sie vielleicht ein Freund der Patrona?«
»Ich bin Lassiter«, sagte der große Mann. »Ruh dich noch ein paar Minuten aus, Junge! Ich muss jetzt mit den beiden Hombres reden.«
»Lassiter?«, fragte Rafael Guerras erstaunt. »Aber meine Mutter hat doch immer gesagt, Sie wären ...«
Lassiter winkte ab.
»Richtig«, unterbrach er den Jungen. »Aber manchmal ändern sich die Zeiten. Später wirst du alles verstehen.«
Er richtete sich auf und ging zu den beiden Männern hinüber, die nebeneinander stöhnend und ächzend auf der harten Erde lagen. Beide starrten ihn genau wie Rafael Guerras aus weit aufgerissenen Augen an. Auch aus ihren Mienen sprachen Unglauben und Überraschung.
»Lassiter!«, keuchte der Mann, der vorhin noch den Henker spielen wollte. »Du bist wirklich Lassiter? Ich kann es einfach nicht glauben. Ausgerechnet du kaufst dich in dieses Spiel ein? Das ist doch Wahnsinn! – Oder bist du vielleicht ein Doppelgänger von Lassiter?«
Lassiter grinste. »Du bist doch auch kein Doppelgänger von Lorne Clayton« sagte er. »Wir beide sollten uns lange genug kennen, Lorne. Da dürfte eigentlich eine Verwechslung nicht drin sein. – Na, glaubst du jetzt endlich, dass ich es wirklich bin? Hast du mich nicht an der Stimme erkannt, als ich euch anrief? Du hättest wissen müssen, dass es zwecklos sein würde. Trotzdem hast du deinen Partnern zugenickt und ihnen den Befehl zum Kampf gegeben. Wie kann man nur so dämlich sein!«
Lorne Clayton schüttelte ein paarmal den Kopf. Er schloss die Augen. Schweißtropfen hatten sich auf seiner Stirn gebildet.
»Du bist es wirklich«, sagte er leise. »Ja, du bist Lassiter. Aber ich kann es noch immer nicht verstehen. Ausgerechnet du! Hast du denn vergessen, was seinerzeit zwischen dir und Mariana Guerras gewesen ist? Schlägst du dich jetzt tatsächlich auf ihre Seite? Diese verdammte Hure hätte dich damals um ein Haar an den Galgen gebracht. Und jetzt hilfst du ihr. Das geht über meinen Verstand.«
»Ich habe ihrem Sohn geholfen«, gab Lassiter eisig zurück. »Der Junge hatte keine Chance gegen euch, aber ihr wolltet euch einen Spaß daraus machen, ihn hängen zu sehen. Ihr solltet euch schämen!«
Lorne Clayton schwieg und starrte zu Boden. Eine Kugel hatte ihn am rechten Oberarm erwischt, und ein zweites Geschoss hatte seinen rechten Oberschenkel durchschlagen. Es waren keine lebensgefährlichen Wunden, wenn rechtzeitig etwas unternommen wurde.
Sein Partner hatte sich inzwischen ebenfalls aufgesetzt. Auch er war nicht so schwer verwundet worden, dass es ihn das Leben kosten würde. Die Wunden mussten nur rechtzeitig behandelt werden.
»Ich könnte euch jetzt erledigen«, sagte Lassiter hart, »Genauso wie ihr Rafael Guerras erledigen wolltet. Ihr habt Glück, dass ich kein Mörder bin. – Haut jetzt ab, Hombres! Zieht euch auf eure Gäule und verschwindet. Seht zu, dass ihr schnell genug zu einem Doc oder einem anderen Burschen kommt, der eure Kugellöcher verarzten kann. Wenn erst der Wundbrand drin steckt, könnt ihr euer Testament machen.«
Lorne Clayton hob müde den Kopf.
»Was hast du vor, Lassiter? Warum hast du uns nur gehindert, diesen Bastard einer Hure zu hängen? Das wird dich noch mitten in die Hölle führen. Hat eigentlich in letzter Zeit dein Verstand nachgelassen?«
Lassiter grinste. »Kümmere dich nicht um meinen Verstand, Lorne Clayton«, sagte er verächtlich. »Kümmere du dich lieber um dein Leben. Jede Minute ist kostbar. Das solltest du wissen.«
Er wandte sich ab und ging zu seinem Pferd zurück. Rafael Guerras war bereits dabei, seinen Wallach zu satteln.
Lassiter wartete und sah, wie sich Lorne Clayton und sein Partner gegenseitig auf die Beine halfen und zu ihren Pferden hinüberhumpelten.
»Du bist ein Selbstmörder, Lassiter!«, rief Clayton heiser herüber, als er im Sattel saß. »Was du in dieser Nacht getan hast, wird sich bald rumsprechen im Grenzland. Und dann nimmt von dir kein Hund mehr ein Stück Brot an.«
Nach diesen Worten ließ er sein Pferd angehen.
Lassiter starrte den beiden Männern gedankenverloren nach.
»Ja, Clayton«, murmelte er vor sich hin. »Vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich tatsächlich verrückt geworden ...«
Der Junge war mit dem Satteln fertig und sah zu Lassiter herüber.
»Was haben Sie gerade gesagt, Señor Lassiter?«
»Ach, nichts Besonderes, Junge. Reiten wir!«
Er schwang sich in den Sattel und ritt an. Rafael Guerras folgte ihm und trieb sein Pferd an Lassiters Seite. Der Junge sah noch immer stark mitgenommen aus. Seine Kleidung war an vielen Stellen zerfetzt, ein Zeichen dafür, dass man ihn wahrscheinlich ein Stück mit dem Lasso über das unebene Gelände geschleppt hatte.
Sie ritten in südliche Richtung. Ungefähr zwanzig Meilen vor ihnen befand sich die Grenze zu Mexiko. Und irgendwo im Grenzgebiet lag das Tal, in dem Mariana Guerras herrschte.
Sie war eine schöne Frau. Eine der schönsten Frauen, die Lassiter je kennengelernt hatte.
Ein Teufelsweib.
Langbeinig, schlank, fast so groß wie Lassiter. Raffiniert und mit tausend Tricks vertraut.
Witwe seit knapp vier Jahren, und jetzt war sie dreiunddreißig. Sie hatte schon sehr früh geheiratet. Mit fünfzehn war sie die Frau des reichen Hacendaros und Minenbesitzers Fernando Guerras geworden. Im selben Jahr hatte sie ihren Sohn Rafael bekommen.
Die Stimme des Jungen riss Lassiter aus seinen Gedanken.
»Das werde ich Ihnen nie vergessen, Señor Lassiter. Ich war schon vor Angst halbtot. Und dann waren Sie plötzlich da. Ich kann es noch immer nicht richtig fassen, dass ich noch lebe.«
Lassiter nickte leicht. »Das kann ich verstehen, Rafael. Ich habe mich auch schon in solchen Situationen befunden.«
Eine Weile herrschte Schweigen.
Lassiter beobachtete den Jungen aus den Augenwinkeln. Es war ihm deutlich anzusehen, dass ihn viele Gedanken beschäftigten und dass er noch eine ganze Reihe von Fragen auf dem Herzen hatte.
Schließlich gab er sich einen Ruck.
»Hat meine Mutter Sie wirklich geschickt?«, fragte er heiser.
Lassiter nickte.
»Zweifelst du etwa daran, Rafael?«
»Ich – ich kann es noch immer nicht richtig glauben, Señor Lassiter. Meine Mutter hasst Sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie hat es mir oft genug gesagt.«
Er sah Lassiter fragend von der Seite an.
»Ich weiß«, murmelte Lassiter. »Und ich kann ihren Hass verstehen. Es ist schlimm, wenn eine Frau so früh den Mann verliert.«
»Durch Ihre Schuld, Lassiter!«, zischte der Junge. »Oder stimmt es nicht, was Mutter immer behauptet hat? Sind Sie etwa nicht der Mann, der meinen Vater Fernando Guerras getötet hat?«
»Doch. Es stimmt«, sagte Lassiter. »Mir blieb keine andere Wahl, Junge. Dein Vater war ein Bandit. Ich war ihm im Wege und sollte sterben. Ich habe in Notwehr gehandelt, Rafael.«
»Sie lügen!«, stieß der Junge wütend hervor. »Mein Vater war ein ehrbarer Hacendado. Er hatte es nicht nötig, andere Menschen zu berauben. Er besaß selbst genug.«
Lassiter zuckte resignierend die Schultern. Wie sollte er diesem hitzköpfigen jungen Mann alles erklären? Wie konnte er ihn von der Wahrheit überzeugen?
Fernando Guerras war nach außen hin tatsächlich ein ehrbarer Hacendado gewesen. Aber nur nach außen hin. Er lebte auf einer großen Hazienda, umgeben von einer starken Mannschaft. Er war reich, aber sein Reichtum stammte aus Raubzügen, die er immer wieder nördlich der Grenze unternahm.
Er überfiel Geldtransporte, die für die Silberminen von Tombstone bestimmt waren. Er legte sich immer wieder mit Wells Fargo an, der übermächtigen Transportgesellschaft, die auch Lassiters erbittertste Feindin war. Er kannte keine Skrupel. Raubte, mordete, ließ nur selten Überlebende zurück. Und verschwand immer wieder unerkannt über die Grenze.
Dann kam jener Tag, an dem er und seine Banditen Lassiter überfielen und ausraubten. Sie hielten ihn für tot und ließen ihn liegen. Aber Lassiter lebte. Er fand die Fährte der Bande und folgte ihr bis zur Hazienda des reichen, angesehenen Don Fernando Guerras.
Lassiter holte sich die zwanzigtausend Dollar zurück, die sie ihm abgenommen hatten. Und er tötete Fernando Guerras im Zweikampf.
Von nun an verfolgte ihn die schöne Witwe Mariana Guerras mit ihrem tödlichen Hass. Aber Lassiter verzichtete darauf, sich mit der Frau anzulegen. Es widerstrebte ihm, gegen Frauen zu kämpfen. Außerdem hatten inzwischen Rurales und Geheimagenten von Wells Fargo Wind von der ganzen Angelegenheit bekommen. Sie durchsuchten die Hazienda des toten Fernando Guerras, fanden genügend Beweise für die Schuld des Hacendados und beschlagnahmten die Hazienda.
Mariana Guerras aber tauchte mit ihrem Sohn Rafael unter. Ihr Mann hatte vorgesorgt. Irgendwo in den zerklüfteten, unwegsamen Bergen im Niemandsland lag ihr Versteck. Eine Zeitlang lebte sie dort völlig zurückgezogen, aber seit einem halben Jahr hörte man wieder von ihr.
Die Bewohner des Grenzlandes nannten ihren Namen nur, wenn sie unter sich waren. Zwischen ihnen und der schönen Witwe herrschte eine Art Privatfehde. Man dachte nicht daran, das Gesetz einzuschalten. In diesem Landstrich pflegte man Meinungsverschiedenheiten unter sich auszutragen. Denn es gab kaum jemanden, der eine weiße Weste hatte.
Das alles hatte Lassiter inzwischen herausgefunden.
Und er war der Überzeugung, auf eine heiße Fährte gestoßen zu sein.
Alles deutete darauf hin, dass die Fäden bei Mariana Guerras zusammenliefen. Nur über sie konnte er seiner Meinung nach den Auftrag lösen, den er angenommen hatte.
Ein höllischer Auftrag. Vielleicht wartete auf Lassiter jetzt schon der Tod.
Obwohl er von Anfang an um die Gefahren gewusst hatte, war er nicht davor zurückgeschreckt, den Auftrag anzunehmen.
Den Jungen hatte er belogen. Es war kein Zufall gewesen, dass er im letzten Augenblick dazwischengefahren war, als Lorne Clayton und seine Kumpane Rafael Guerras hängen wollten.
Lassiter war dem Jungen schon vom frühen Morgen an unauffällig gefolgt. Von Sonoita aus, der kleinen Stadt, die an der Überlandstraße nach Tombstone lag. Dort hatte er Rafael Guerras zum ersten Mal gesehen. Die Ähnlichkeit mit Fernando Guerras war so frappierend, dass es für Lassiter nicht den geringsten Zweifel mehr gegeben hatte.
Von diesem Zeitpunkt an hoffte er, das Versteck von Mariana Guerras ausfindig machen zu können.
Jetzt hatte sich die Situation geändert.
Lassiter hatte das Vertrauen von Rafael Guerras errungen. Er hatte den Jungen belogen. Und wenn ihm Rafael weiterhin seine Lüge glaubte, würde er Lassiter in das Versteck seiner Mutter führen.
Eine tödliche Lüge, dachte Lassiter. Vielleicht hat Lorne Clayton recht gehabt. Irgendwie bin ich verrückt. Ich muss verrückt sein. Mariana Guerras wird ihren Hass befriedigen wollen ...
Die Stimme des Jungen riss ihn aus seinen Gedanken.
»Was denken Sie, Lassiter? Warum antworten Sie mir nicht? Ich habe gesagt, dass Sie ein Lügner sind. Wollen Sie das so einfach auf sich sitzen lassen?«
»Du wirst später alles verstehen«, antwortete Lassiter ruhig. »Eines Tages wirst du mich nicht mehr einen Lügner nennen.«
Der Junge betrachtete ihn wieder eine Weile nachdenklich.
Dann sagte er langsam: »Sie haben mir das Leben gerettet, Lassiter. Sie haben Ihr eigenes Leben riskiert, um den Sohn Ihrer erbittertsten Feindin zu retten. Und später haben Sie behauptet, meine Mutter hätte Sie geschickt. – Stimmt das wirklich?«
»Ich verstehe deine Zweifel nicht, Rafael.«
»Und ich habe ein seltsames Gefühl, Señor Lassiter. Ich kann Ihnen nicht richtig trauen. Vielleicht wollen Sie mich nur als Ihr Werkzeug benutzen. Vielleicht wollen Sie durch mich in unser Versteck vordringen. – Sie begeben sich in eine große Gefahr. Meine Mutter wird Sie töten, wenn ...«
»Deine Mutter hat mich geschickt«, unterbrach ihn Lassiter scharf. »Ich habe kein Interesse, dich hier zu belügen.«
Der Junge war zusammengezuckt. Er richtete seinen Blick wieder starr nach vorne und schwieg.
Lassiter lächelte verhalten. Er wusste jetzt, dass ihn Rafael Guerras dorthin führen würde, wo Lassiter hin wollte.
Aber was wartete auf ihn am Ende dieses Weges?
Er durfte nicht weiter darüber nachdenken. Er musste dieses Wagnis einfach eingehen.
Immerhin hatte er einem Mann ein Versprechen gegeben. Und Lassiter war es gewohnt, sein Wort zu halten. Um jeden Preis.
Rafael Guerras begann wieder zu sprechen: »Ich werde niemals vergessen, was Sie für mich getan haben, Lassiter. Das schwöre ich Ihnen. Aber gegen meine Mutter kann ich nicht ankommen. Außerdem liebe ich meine Mutter. Sollten Sie gelogen haben, so sind Sie ein toter Mann. Dann kann Sie niemand mehr retten.«
»Ich weiß«, murmelte Lassiter, und er überlegte im gleichen Atemzug, ob es vielleicht nicht doch besser für ihn sein würde, auf der Stelle umzukehren.
Er spürte, dass der Knochenmann schon seine eiskalte Hand nach ihm ausgestreckt hatte. Trotzdem gab es kein Zurück mehr.
Er musste weitergehen auf dem Weg, den er eingeschlagen hatte.
II
»Da sind wir.«
Sie hielten in einem Engpass zwischen steil aufragenden Felsen, und Rafael Guerras streckte den rechten Arm aus.
Ein zerklüftetes Tal breitete sich vor ihnen aus. Mitten in diesem Tal erhoben sich die Gebäude einer Hazienda. Ein paar niedrige Adobehütten, eine niedrige Scheune, ein langgestreckter Pferdestall – und das Haupthaus.
Es glänzte weiß in dem grellen Sonnenlicht des Mittags. Zwei Stockwerke, ein flaches Dach, eine weiträumige Veranda und davor der quadratische Hof.
Eine richtige Hazienda, die jedoch nicht in die karge Landschaft hineinpasste. Hier war für Rinderzucht nicht der richtige Platz, denn von dem spärlich wachsenden, von der Sonne verbranntem Gras hätten nicht mehr als zehn Rinder satt werden können.
Stille herrschte im Tal. Es ging auf den Mittag zu. Die Sonne brannte heiß. Pferde standen oder lagen im Schatten einiger Bäume, die den weiträumigen Corral begrenzten.
Kein Mensch war auf dem Hof zu sehen.
Lassiter und der Junge ritten an. Ein schmaler Pfad führte zwischen kahlen Felsen hindurch zu Tal. Der Hufschlag klang laut durch die abgrundtiefe Stille.
Auf dem Hof der Hazienda ließ sich noch immer niemand blicken.
Erst als die beiden Reiter vor dem großen Haus hielten, wurde es ringsum lebendig.
Rechts von ihnen kamen zwei Männer aus der Scheune. Zwei weitere Männer verließen den Pferdestall, der schräg links hinter Lassiter und dem Jungen lag.
Lassiter blickte kurz nach beiden Seiten und sah, dass die Männer Gewehre in den Händen hielten. Alle vier waren gefährlich aussehende Burschen, die den Teufel nicht zu fürchten schienen.
Schweigend blieben sie stehen und musterten Lassiter mit finsteren, abschätzenden Blicken.
Und dann schwang die massive Eichenholztür des Hauses auf. Eine Frau schritt hinaus auf die steinerne Terrasse und blieb im gleißenden Sonnenlicht stehen.
Lassiter erkannte sie sofort wieder.
Mariana Guerras, die schöne Witwe.





























