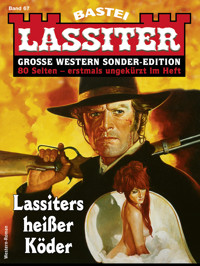
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die nackte Puppe drängte sich verlangend gegen Lassiter. Das Mondlicht zauberte einen silbernen Schimmer auf ihre samtweiche Haut. Lassiter spürte, wie ihn die Erregung packte. Und dann durchbrach jäh eine eisige Stimme die herrschende Stille. »Ich denke, ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt sind wir an der Reihe.« Die Stimme gehörte Sidney Blood. Lassiter kannte sie nur zu gut. Der Wells-Fargo-Agent trat ins Mondlicht, und ein halbes Dutzend Männer folgten ihm. Sie alle hielten Revolver oder Gewehre in den Händen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
LASSITERS HEISSER KÖDER
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Vorschau
Impressum
LASSITERS HEISSER KÖDER
Es war eine verdammt kleine Zelle, und sie war eigentlich nur für einen Gefangenen gedacht. Trotzdem hatte man diesmal zwei Männer in dem engen Loch eingepfercht. Es roch bedrückend nach angefaultem Stroh und modrigem Gemäuer. Zwei schmale Bahnen gelben Mondlichts fielen durch die engen vergitterten Fensteröffnungen hoch oben in der massiven Bruchsteinwand.
Der eine Gefangene lag zusammengekrümmt auf der schmalen Eisenpritsche, deren eine Seite fest mit der Wand verbunden war. Sein rasselndes Atmen brach plötzlich ab. Er warf sich auf den Rücken, riss die Arme hoch und rang mit qualvollem Keuchen nach Luft. Es hörte sich an wie der letzte ersterbende Hilfeschrei eines Ertrinkenden.
Der Mann, der dicht neben der Pritsche auf dem stinkenden Strohsack lag, war sofort auf den Beinen und beugte sich über seinen Leidensgefährten.
»Hier, nimm das, Isa! Das wird dir über den Rest der Nacht hinweghelfen.«
Der Angesprochene schüttelte mühsam den Kopf. In dem matten, trostlos wirkenden Mondlicht wirkte sein Gesicht gespenstisch bleich. Das graue Haar stand wirr um seinen Kopf.
»Ich brauch's nicht mehr, Lassiter«, keuchte er. »Es geht zu Ende. Ich spür das ganz deutlich. Aber du musst es schaffen, Junge. Warst ein verdammt feiner Kerl. Du musst es schaffen, hörst du ...«
Er rang wieder nach Luft. Er wollte sich aufbäumen, aber Lassiter legte ihm leicht die Hände auf die ausgemergelten Schultern und drückte ihn sanft auf das harte Lager zurück.
Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt er ein kleines, gelbbraunes Kügelchen. Opium. Ein bestochener Wärter hatte ein halbes Dutzend dieser Kügelchen in die Zelle geschmuggelt. Sie waren nicht für Lassiter bestimmt, sondern für Isaak O'Neill. Der alte Mann war zusammen mit Lassiter in einer der finstersten Hafenspelunken von Frisco verhaftet worden.
Das war vor zwei Tagen geschehen, und Lassiter hatte noch immer keine Ahnung, weshalb man ihn in diese finstere Zelle geworfen hatte.
Es war eine Zelle im Hafengefängnis von San Francisco, dem berüchtigsten Gefängnis der Stadt.
Hier herrschte schon zwangsläufig ein besonders rauer Ton. Wärter, die sich Nacht für Nacht mit betrunkenen, zum großen Teil bärenstarken Seeleuten herumschlagen mussten, wurden mit der Zeit ebenfalls besonders hartgesottene Burschen.
In gewisser Hinsicht hatte Lassiter Verständnis dafür, dass man als Gefangener in diesem Bau nicht mit Samthandschuhen angefasst wurde.
Er hatte jedoch eine ganze Menge dagegen, dass er völlig grundlos eingesperrt worden war.
Isaak O'Neill atmete ruhiger.
»Ich hab's mir überlegt«, flüsterte er heiser. »Gib mir das Zeug! Dann habe ich wenigstens keine Schmerzen mehr, bis es endgültig zu Ende ist mit mir.«
Er nahm das Kügelchen und steckte es in den Mund. Lassiter setzte sich auf die harte Pritschenkante.
Auch er ahnte, dass es mit Isaak O'Neill zu Ende ging. Der alte Mann besaß nicht mehr genug Widerstandskraft. Skorbut und Ruhr hatten den ehemaligen Steuermann auf seiner letzten Fahrt von China herüber zu sehr geschwächt. Hier in der feuchten, modrigen Zelle war dann noch dieser verdammte Husten hinzugekommen.
»Willst du mir nicht endlich verraten, was los ist?«, fragte Lassiter leise, aber eindringlich. »Ich möchte wissen, warum ich hier eingesperrt worden bin. Du hast ein Geheimnis, das ist mir längst klar. Draußen gibt es mindestens einen einflussreichen Mann, der ein starkes Interesse an dir hat. Es war bestimmt nicht einfach und auch nicht billig, dir das Opium zukommen zu lassen. Warum hat der Unbekannte das auf sich genommen? Und warum bin ich verhaftet worden, als ich rein zufällig in dieser Kneipe neben dir am Tresen stand?«
Isaak O'Neill schloss die Augen. Trotz der äußerst schwachen Beleuchtung erkannte Lassiter den nachdenklichen Ausdruck auf dem eingefallenen Gesicht des Steuermanns.
»Du hast recht, Lassiter«, flüsterte er nach einer Weile. »Du hast nichts mit der Sache zu tun. Aber ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Es steht verdammt viel auf dem Spiel. Vielleicht bist du einer von den vielen Spitzeln, die sie auf mich angesetzt haben. Ist doch eigentlich ein ziemlich seltsamer Zufall, dass sie dich zusammen mit mir eingelocht haben.«
»Das ist es ja, was mich auch stört«, knurrte Lassiter. »Zum Teufel, O'Neill. Jetzt vergiss doch endlich mal dein verdammtes Misstrauen!«
Auf den nur schemenhaft erkennbaren Zügen O'Neills zeichnete sich die beginnende Entspannung ab. Er lächelte zufrieden. Das Rauschgift begann zu wirken.
»Paloma«, flüsterte er. »Paloma Amoy. Sie ist meine Tochter, Lassiter. Such sie in Chinatown. Vielleicht findest du sie. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Wenn du hier herauskommen solltest, kannst du ja Verbindung mit ihr aufnehmen. Sie ist klug. Sie wird selbst entscheiden, ob sie dir vertrauen kann. – Paloma Amoy, Lassiter. Merk dir den Namen gut. Sie nennt sich schon lange so, weil O'Neill zu gefährlich werden könnte für sie. Nur wenige Eingeweihte wissen, dass sie meine Tochter ist. Wenn das herauskommt, befindet sie sich in großer Gefahr. Aber auch dein Leben wird gefährdet sein, sobald gewisse Leute merken, dass du sie suchst.«
Er schloss die Augen, und auf seinem Gesicht lag noch immer dieses zufriedene Lächeln.
Lassiter hatte noch viele Fragen, aber er schwieg ebenfalls.
Was ihm O'Neill da gesagt hatte, war nicht mehr als ein vager Anhaltspunkt. Er hatte nicht die geringste Ahnung von den eigentlichen Zusammenhängen, aber seine Neugier war geweckt worden.
Hier schien es sich in der Tat um eine ganz große Sache zu handeln. Sonst hätte Isaak O'Neill mehr verraten.
»Sie ist klug«, fuhr der alte Mann leise fort. »Vielleicht habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht und dir viel zu viel verraten. Aber solltest du tatsächlich ein verdammter Spitzel sein, Lassiter, so wird dir meine Auskunft auch nicht weiterhelfen. Dann wirst du sehr schnell in der Hölle sein.«
»Ja«, murmelte Lassiter, »das glaube ich dir, Isa.«
O'Neill sagte nichts mehr. Seine gleichmäßigen Atemzüge verrieten, dass er eingeschlafen war.
Lassiter setzte sich wieder auf den Jutesack mit der angefaulten Strohfüllung. Langsam ließ er sich auf den Rücken sinken, verschränkte die Arme unter dem Nacken und schlief ein.
Er wusste, dass es jetzt keinen Sinn hatte, sich weitere Gedanken über das zu machen, was er gehört hatte. Schlafen war das einzig Sinnvolle, was er in dieser Nacht noch machen konnte.
Er hätte wahrscheinlich nicht so ruhig geschlafen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, einen Blick in die Nebenzelle zu werfen. Und zwar in die Zelle, die sich hinter der Wand befand, in der die Eisenpritsche von Isaak O'Neill verankert war.
Zwei Männer befanden sich dort. Einer von ihnen hatte ein Ohr gegen einen Blechtrichter gepresst, der in ein Eisenrohr mündete, das aus der Wand ragte.
Der Horcher nickte dem zweiten Mann zu.
»Eine ausgezeichnete Erfindung, Marshal«, sagte er leise.
»Damit dürfte also endgültig feststehen, dass dieser Lassiter unschuldig ist.«
Der schwarzgekleidete Marshal nickte.
»Bleibt nur die Frage, was er jetzt unternehmen wird, Mr. Kennedy«, murmelte er. »Haben Sie genau verstehen können, was O'Neill alles zu ihm gesagt hat?«
»Nein, leider nicht. Er hat etwas von Chinatown geflüstert. Dort soll Lassiter sich mit jemand in Verbindung setzen. Ich glaube, das war ein Mädchenname. Paola oder so ähnlich. Werden Sie dafür sorgen, dass Lassiter auf freien Fuß gesetzt wird?«
»Ja, natürlich. Kommen Sie mit in mein Büro, Mr. Kennedy. Wir können dort alle weiteren Schritte besprechen.«
Die beiden Männer verließen den leeren Zellenraum. Ihre Gesichter drückten Zufriedenheit aus.
Als sie sich später im Office des Marshals befanden, das in einem Nebengebäude des Hafengefängnisses untergebracht war, stellte der Marshal als erstes eine scheinbar beiläufige Frage an seinen Begleiter Kennedy: »Können Sie mir verraten, warum Wells Fargo solch ein starkes Interesse an Lassiter hat, Mr. Kennedy? Oder sind Sie nicht befugt, diese Frage zu beantworten?«
Tob Kennedy, ein Wells-Fargo-Agent, sah den Marshal mit zweideutigem Lächeln an.
»Mit Ihrer Sache hat es nichts zu tun, Marshal Safford«, sagte er. »Aber Sie wissen doch Bescheid über die vielen Schwierigkeiten, die dieser Mann unserer Company schon gemacht hat. Der hat uns schon mehr geschadet als ganze Banden zusammengenommen.«
Der Marshal erwiderte das Lächeln nicht. Er blieb ernst.
»Ich habe von der Geschichte gehört«, sagte er. »Aber trägt nicht Wells Fargo einen Großteil selbst die Schuld daran?«
»Das ist nicht Ihre Angelegenheit«, gab der Wells-Fargo-Mann schroff zurück. »Für Sie ist einzig und allein Ihr Auftrag wichtig.«
»Dann soll sich Wells Fargo auch in dieser Sache nicht weiter einmischen«, sagte der Marshal ebenso abweisend. »Sie können gehen, Mr. Kennedy. Von jetzt an werde ich meine Entscheidungen allein treffen.«
»Soll das ein Rausschmiss sein, Marshal?«
»Betrachten Sie es, wie Sie wollen!«
Tob Kennedy wandte sich wütend der Tür zu.
»Sie werden noch von uns hören, Marshal!«, knurrte er, als er den Türknauf bereits in der Hand hatte. »Es könnte gut sein, dass Sie sich diesmal zu viel herausgenommen haben!«
Sekunden später knallte die Tür hinter ihm ins Schloss.
Marshal Ken Safford ließ sich in seinen Stuhl hinter dem schweren Schreibtisch sinken.
»Da stimmt was nicht«, murmelte er im Selbstgespräch. »Ich fresse meinen Stern, wenn diese Wölfe nicht wieder einmal ganz bestimmte Absichten haben ...«
Lassiter wurde wach, als die schwere, eiserne Zellentür knarrend aufschwang. Drei Männer traten ein. Marshal Ken Safford und zwei seiner Deputies. Alle drei waren dabei gewesen, als Lassiter in der Hafenkneipe zusammen mit Isaak O'Neill verhaftet worden war.
Die beiden Deputies hatten abgesägte Schrotflinten in den Fäusten. Der Marshal war nur mit dem Revolver bewaffnet, der jedoch im Holster steckte, das von seinem langschößigen Prince-Albert-Rock zum größten Teil verdeckt wurde.
Lassiter setzte sich auf und warf als erstes einen Blick auf Isaak O'Neill.
Der bärtige Seemann lag still da, als schliefe er. Auf seinem eingefallenen Gesicht lag ein Ausdruck des tiefen Friedens.
Isaak O'Neill war tot.
»Das war so gut wie Mord, Marshal«, sagte Lassiter grimmig. »Dieser Mann musste in ein Hospital. Er war schwer krank, das konnte jeder sehen. Der Aufenthalt in dieser verdammten Zelle war zu viel für ihn.«
Der Marshal blickte starr auf den Toten.
»Ja, Lassiter«, gab er verhalten zurück. »Sie haben vielleicht recht mit Ihrer Behauptung. Aber mich als Marshal sollten Sie nicht beschuldigen. Sie wissen genau, dass ich als ausführendes Gesetzesorgan die Anweisungen des Gerichts zu befolgen habe. Hat er noch irgendetwas zu Ihnen gesagt, bevor er starb?«
»Nein.«
»Wissen Sie, ob er Angehörige hat, die wir benachrichtigen müssen?«
Lassiter schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht mehr über ihn, als dass er Isaak O'Neill heißt. Das ist alles, Marshal. – Und jetzt habe ich mal eine Frage! Was liegt gegen mich vor? Warum bin ich eingesperrt worden?«
Marshal Ken Safford zuckte die Schultern.
»Tut mir leid, dass das passiert ist, Mr. Lassiter«, murmelte er. »Sie standen in dem schweren Verdacht, ein Kumpan von O'Neill gewesen zu sein. Das hat sich inzwischen als Irrtum herausgestellt. Sie sind ab sofort wieder ein freier Mann. Nachher können Sie in meinem Office Ihre persönlichen Sachen abholen, die Ihnen bei der Festnahme abgenommen wurden.«
Lassiters Gesicht verriet nicht, was er in diesen Sekunden dachte. Er erkannte glasklar, dass hier etwas faul war. Diese Entlassung kam für seine Begriffe zu schnell und zu plötzlich. Er grinste spöttisch.
»Darf ich wenigstens erfahren, was gegen mich vorlag, Marshal?«, fragte er.
»Sie wurden verdächtigt, ein Komplize O'Neills zu sein.«
»Und was war mit dem alten Burschen los?«
»Das ist streng geheim. Seien Sie froh, dass Sie nicht in dieser Geschichte drinstecken. Und ich rate Ihnen darüber hinaus, nicht weiter neugierig in Bezug auf den Toten zu sein. Sie könnten sich dabei verteufelt schnell die Finger verbrennen.«
»Ich werde daran denken«, sagte Lassiter trocken. Er warf einen letzten Blick auf seinen toten Zellennachbarn und schritt am Marshal vorbei aus dem muffigen Raum.
Der Marshal setzte sich an seine Seite. Gemeinsam schritten sie durch den schmalen, matt erleuchteten Gang, der hinaus in die Freiheit führte.
Minuten später atmete Lassiter erleichtert auf, als sie ins grelle Sonnenlicht des Morgens traten ...
II
Es ging auf den Abend zu, aber er wurde noch immer beschattet. Seit er das Marshal's Office neben dem Gefängnis verlassen hatte, waren sie hinter ihm her.
Sie wechselten sich ab und waren äußerst geschickt. In allen möglichen Verkleidungen traten sie auf, verhielten sich so zurückhaltend wie nur möglich, und trotzdem machten sie Fehler.
Lassiter besaß den ausgeprägten Instinkt des Mannes, der aus der Wildnis kam. Und er wusste, dass auch im unübersehbaren Durcheinander einer großen Stadt Gefahren lauerten. Nur hatte man hier größere Schwierigkeiten, sie schnell genug zu erkennen.
Überall musste er seine Feinde vermuten. Er war aus einem ganz bestimmten Grunde freigelassen worden, und jetzt sollte er sie auf eine bestimmte Fährte führen.
Jeder Mann, jede Frau konnte ein Spitzel sein: Die Kellnerin im Speiserestaurant, der verschlafene Kutscher der Pferdedroschke, der krummbeinige mexikanische Viehtreiber, der dort drüben auf dem Gehsteig kauerte und missmutig in die Sonne blinzelte, das Mädchen, das ihn mit grellgeschminktem Mund ansprach, ob er nicht Lust auf ein paar nette Stunden in einem verschwiegenen Hotelzimmer hätte, und viele, viele andere.
Sie alle konnten zu den Spitzeln gehören, die man aus einem bestimmten Grunde auf seine Fährte gesetzt hatte.
Welcher Grund war das?
Isaak O'Neill hatte verdammt geheimnisvoll getan. Er musste seinen guten Grund gehabt haben, selbst noch angesichts des nahen Todes misstrauisch jedem Menschen gegenüber zu sein.
Lassiter spielte in Gedanken viele Möglichkeiten durch, aber nichts fiel ihm ein, was wichtig genug sein könnte, um einen solchen Aufwand zu betreiben.
Die Sonne versank hinter dem Horizont. Lassiter blieb ein paar Minuten vor der Schaufensterauslage eines Waffengeschäftes stehen. Aber er sah sich nicht die ausgestellten Gewehre, Pistolen und Revolver an, sondern benutzte die große Scheibe lediglich als Spiegel.
Er befand sich auf der Kings Road, einer der großen Geschäftsstraßen. Ein Strom von Passanten wälzte sich an ihm vorbei. Neben ihm blieb ein vornehm gekleideter Mann vor dem Schaufenster stehen und zündete sich umständlich eine lange schwarze Zigarre an.
Lassiter beachtete den Mann nicht, ging langsam weiter und betrat Minuten später eins der vielen Speiserestaurants, die es in dieser Straße gab. Es war ein langgestreckter Raum mit niedriger, holzgetäfelter Decke, von der schwere Messingkandelaber herabhingen. Die Tische standen in kleinen, voneinander durch blumengeschmückte Bambuswände abgetrennte Nischen. Kerzen verbreiteten behagliche Wärme.
Der große Mann fand eine Nische am Ende des Raumes und setzte sich so, dass er den Eingang überblicken konnte.
Er hatte kaum Platz genommen, als der vornehm gekleidete Mann hereinkam, den er bereits erwartet hatte. Sein Instinkt hatte wieder einmal recht behalten: Der Vornehme gehörte zu seinen Bewachern.
Der Mann blieb kurz stehen, sah sich unauffällig nach allen Seiten um und steuerte dann zielbewusst auf das Ende des Raumes zu. Am vorletzten Tisch nahm er Platz und griff nach der Speisekarte, die vor ihm auf dem Tisch lag.
Ein schwarzbefrackter Kellner kam an Lassiters Tisch und nahm die Bestellung auf. Anschließend fragte er den Mann am Nebentisch nach seinen Wünschen.
»Wir haben Sie ja lange nicht gesehen, Mr. Kennedy«, sagte der Kellner zu dem Vornehmen. »Nett, dass Sie uns mal wieder die Ehre geben. Soll ich Rotwein dazu servieren, wie üblich?«
Kennedy nickte knapp.
»Bring mir auch noch eine Zeitung, José! Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, die neuesten Nachrichten zu lesen.«
José verneigte sich leicht und verschwand.
Das Lokal begann sich schnell zu füllen. Eine schlanke, rothaarige Frau von knapp dreißig Jahren trippelte durch den Gang zwischen den einzelnen Nischen und sah sich suchend nach einem freien Tisch um. Lassiter war inzwischen der einzige Gast, der noch einen Tisch für sich allein hatte. Die Frau blieb mit charmantem Lächeln stehen.
»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«, fragte sie mit unverkennbar mexikanischem Akzent.
»Selbstverständlich, Madam.« Er machte eine einladende Handbewegung.
Lächelnd ließ sie sich auf einen der gepolsterten Stühle sinken, Lassiter genau gegenüber.
Sie war eine hübsche Frau, die Charme und Intelligenz ausstrahlte. Lassiter fragte sich, warum eine Schönheit wie sie es nötig hatte, ohne einen männlichen Begleiter auszugehen.
»Hoffentlich störe ich nicht«, begann sie auf die übliche Weise ein Gespräch. »Falls Sie aber ...«
Lassiter unterbrach sie, indem er sich schnell vorbeugte und ihr die Hand auf den Arm legte.
»Sie stören mich keineswegs, Madam«, sagte er. »Ich bin völlig ohne Anhang. In Frisco kenne ich kaum einen Menschen. Wenn Sie nichts dagegen haben, lade ich Sie ein.«
Sie lächelte verheißungsvoll.
»Nichts wäre mir lieber als das«, sagte sie leise. »Ich bin nämlich ebenfalls allein. Sie verstehen?«
»Ich glaube schon«, grinste Lassiter. Dann nannte er seinen Namen.
»Mara Ruiz«, sagte die Rothaarige. »Ich wohne in einem hübschen kleinen Hotel nicht weit von hier.«
Lassiter beugte sich noch etwas mehr vor.
»Gehst du immer so scharf ran, Lady?«, fragte er anzüglich.
»Das ist mein Geschäft«, antwortete sie schnippisch. »Ich bin übrigens keins von den billigen Flittchen, falls du das denken solltest. Ich suche mir nur die beste Kundschaft aus!«
»Bist du sicher, dass du bei mir richtig liegst?«
Sie runzelte ganz kurz die Stirn. Ihr Blick glitt über seine Kleidung. Dann nickte sie zufrieden.
»Du bist kein Bluffer«, murmelte sie. »Ich möchte sogar wetten, dass du einer von den Burschen bist, mit denen man es auch umsonst machen würde. Stimmt's?«
»Die Antwort musst du dir selbst geben«, sagte Lassiter. »Später ...«
Drei Stunden später, und Lassiter befand sich mit Mara Ruiz in dem kleinen Hotel, von dem sie gesprochen hatte. Sie bewohnte dort kein normales Zimmer, sondern zwei gepflegt eingerichtete Räume, den einen zum Wohnen, den anderen zum Schlafen.
Lassiter hatte bemerkt, dass ihnen der vornehme Mr. Kennedy bis kurz vor das Hotel gefolgt war.
Als er mit Mara ihren Wohnsalon betrat, wollte die Frau sofort Licht machen, aber Lassiter hielt sie schnell zurück.
Er fasste ihren Arm und zog sie mit sich ans Fenster. Durch die Gardine spähten sie hinunter auf die Straße, die von den vielen Laternen vor Geschäften und Wohnhäusern ziemlich hell erleuchtet war.
Auf der anderen Straßenseite stand Kennedy und zündete sich gerade wieder eine seiner langen schwarzen Zigarren an. Im Schein des Zündholzes wurde sein kantiges Gesicht sekundenlang taghell erleuchtet.
»Kennst du den?«, fragte Lassiter schnell.
»Ja, natürlich. Das ist Mr. Tob Kennedy. Er sitzt in der Geschäftsleitung von Wells Fargo. Wenn ich richtig informiert bin, gehört er zu den führenden Leuten in dieser Firma.«
Gerade schlenderte ein weiterer Mann heran und sagte im Vorübergehen etwas zu Kennedy. Beide verhielten sich sehr unauffällig, aber Lassiters scharfen Augen entging es nicht, wie Kennedy dem anderen leicht zunickte und ebenfalls etwas sagte.
Mara Ruiz zog an einer weißen Schnur, und eine buntbemalte Leinenjalousie senkte sich vor das Fenster.
Dann machte sie Licht und begann, sich auszuziehen.
Sie bewegte sich gekonnt, irgendwie zu gekonnt für Lassiters Begriffe. Zu routiniert.
Von einer echten Könnerin hatte er mehr erwartet. Ein längeres Hinausziehen, ein raffiniertes Vorspiel.
Für Mara Ruiz schien das Ganze eher eine Pflichtübung zu sein.
Lassiter kannte viele Frauen, natürlich auch eine Anzahl von der Sorte, die für Geld ihren Körper hergaben.
Die hier war anders. Irgendwie zu kalt. Und zu intelligent. Ihr ganzes bisheriges Auftreten passte nicht zu einer Professionellen. Sie hatte sich zwar Mühe gegeben, im branchenüblichen Tonfall zu sprechen, aber jetzt schien ihr wahres Wesen zutage zu treten.
Lassiter sah eine Whiskyflasche und Gläser auf dem Tisch stehen und schenkte sich ein.
Grinsend sah er zu, wie Mara aus ihren Kleidern schlüpfte.
Als sie völlig nackt war, kam sie langsam auf ihn zu. In ihren Augen lag nicht einmal gespieltes Verlangen, ganz zu schweigen von Leidenschaft. Wie eingeübt hob sie die Arme und schlang sie um seinen Hals.
»O Darling«, flüsterte sie.
Sie konnte nicht sehen, wie Lassiter grinste, da sie ihren Kopf an seiner Brust barg.
Seine Hände glitten über ihren nackten Rücken, streichelten die Brüste, die Schenkel. Aber noch zeigte sie keine Reaktion.
Er ging auf das Spiel ein und steigerte sich künstlich in Erregung. Trotz ihrer spürbaren Kälte war sie von begehrenswerter Schönheit. Sie besaß einen festen Körper, an dem alles so war, wie es sich ein Mann wünschte. Aber gerade ihr routiniertes Verhalten war es, das Lassiter am meisten reizte.
Allmählich wurde ihr Keuchen echt, steigerte sich mehr und mehr, bis sie vor Verlangen zu brennen schien.
Lassiter schlüpfte ebenfalls aus seinen Kleidern. Sank dann mit ihr im Schlafraum auf das weiche Doppelbett.
Sie schloss fest die Augen. Ihre halb geöffneten Lippen schimmerten feucht und waren voll zitternder Begierde. Wenn sie je einen bestimmten Plan gehabt hatte, wie Lassiter seit kurzem vermutete, so hatte sie inzwischen alles vergessen.
Jetzt war sie nur noch Frau, ging sie wie die meisten anderen Frauen auf in dem heißen, körperlichen Glück der Stunde.
Später murmelte Lassiter grinsend: »Du wolltest mir noch eine Frage beantworten, Mara. Gehöre ich zu den Männern, für die du es auch umsonst machen würdest.«
»Ja, Lassiter!«, flüsterte sie heiß. »Immer. Jeden Tag, wenn du es so haben möchtest.«
Er streichelte leicht ihre Brüste.
»Das geht leider nicht, Mara.«
»Warum?«
»Ich bleibe nicht lange in Frisco.«
»Gefällt es dir in dieser Stadt nicht?« Sie schien enttäuscht.
»Ich halte es nie besonders lange in einer Stadt aus«, antwortete er. »Erst recht nicht hier, wo sich die Leute gegenseitig auf die Füße treten. Das gefällt mir nicht.«
»Und warum bist du nach Frisco gekommen?«





























