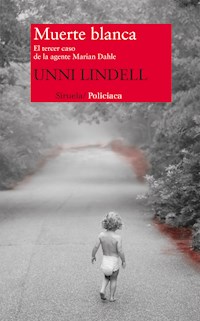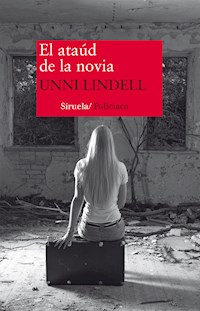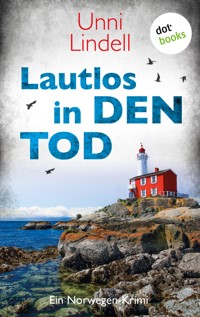
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern – unter ihnen eine Mörderin Wie jedes Jahr kehren die Schwestern Judith, Lisbeth und Carol für Weihnachten zu ihrer Großmutter nach Tromsø zurück. Doch diesmal wird die Heimkehr von einem Mord überschattet: Kurz vor den Feiertagen wird ein Mann im örtlichen Krankenhaus getötet, der zuvor seine schwangere Frau misshandelte. Der pensionierte Polizist Holger Eliassen verdächtigt eine der Schwestern, denn alle drei scheinen mehr über den Mord zu wissen, als sie zugeben. Ist es Lisbeth, die Hebamme? Judith, die Fotografin? Oder Carol, die mit ihrer Alkoholsucht kämpft? Eliassen hegt einen noch dunkleren Verdacht: Steckt eine von ihnen hinter der bestialischen Mordreihe an Männern, die er während seiner Dienstzeit nie klären konnte? Er muss die Wahrheit aufdecken, bevor er selbst zum nächsten Opfer wird… »Ein gut geschriebener Krimi, der einem die Haare zu Berge stehen lässt« – Aftenposten Fesselnder Kriminalroman aus dem hohen Norden von der norwegischen Bestsellerautorin– für Fans von Jo Nesbø und Anne Holt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
eBook-Neuausgabe Oktober 2025
Die norwegische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Rødhette« bei Ashehoug, Oslo.
Copyright © der norwegischen Originalausgabe 2004 Unni Lindell
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die agentur literatur Gudrun Hebel, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Karol Kinal unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-975-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Unni Lindell
Lautlos in den Tod
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Sieh dich vor, Wolf!
Bald holt dich Rotkäppchen!
(Graffito an einer Mauer)
Prolog
Das kleine Mädchen ging an den Blumen am Feldrand vorbei. Die Sonne, die um diese Jahreszeit rund um die Uhr schien, hing über ihr wie ein brennendes gelbes Auge. Die Berge hatten weiße Schneekappen. Es war ein besonders schöner Tag. In der Ferne bellte ein Hund. Ihr rotes Kleid war von Lehm und Sahne befleckt. An den Füßen trug sie kleine Stoffschuhe. Sie wollte zum Baum. Zu dem Baum, der sprach, wenn sie das Ohr an den Stamm legte und lauschte. Der Baum gehörte ihr und ihren Schwestern, aber an diesem Tag wollte sie ohne die anderen hingehen. Das hatte sie noch nie gemacht, denn die Großmutter wollte sie nicht allein in den Wald lassen.
Sie blieb stehen und pflückte eine Blume. Als sie sah, dass sie die Blume mit der Wurzel ausgerissen hatte, war sie traurig. Sie wusste, dass die Wurzeln in der Erde bleiben mussten, damit die Blume jedes Jahr von neuem leben könnte.
Sie dachte an ein Eichhörnchen, das sie einige Tage zuvor gesehen hatte, als sie mit ihrer Schwester hier gewesen war. Das Eichhörnchen war mit wippendem Schwanz im Wald verschwunden.
Wenn ich doch bloß ein Eichhörnchen hätte, dachte sie. Wenn ich doch nur ein Kätzchen oder einen kleinen Hund hätte. Oder einen süßen kleinen Tiger oder den blauen Puppenwagen aus dem Schaufenster des Spielzeugladens neben dem Kino in der Stadt.
Die Stille im Wald war aus vielen gelben und grünen Geräuschen zusammengesetzt. Dünnen Geräuschen, von Blättern mit kleinen Schnäbeln.
Sie sah die gelben Sonnenflecken an, die hoch, hoch da oben durch das Blattwerk huschten. Auf dem Waldboden wurden sie zu ungleichmäßigen Ringen aus Gold. Es roch so gut. Die Welt war genauso groß wie dieser Wald und ebenso hell und schön. Und noch immer hatte sie den Geschmack von Erdbeeren im Mund.
Der Läufer steigerte sein Tempo, als er den Wald erreichte. Wenn seine Turnschuhe auf den Boden auftraten, klang es hohl, als gäbe es unter dem hartgetretenen Boden heimliche Räume. Der Läufer war groß und kräftig.
(Bald, in einer Minute und dreiundvierzig Sekunden, würde er das kleine Kind zwischen den Bäumen entdecken. Dann würde er stehen bleiben, und weil er müde wäre, würde er die Hände auf die Knie stützen und Atem holen.)
Sein Haaransatz und seine Achselhöhlen waren nass. Der Schweiß lief ihm in die Augen. Er hob die Hand und ribb ihn weg. Dann hob er den Kopf und schaute zu dem Kind hinüber. Und als er noch so dastand, kam ihm ein schlimmer Gedanke.
Das kleine Mädchen hatte ihn noch nicht gesehen. Es sang. Es kniete neben einem Büschel Gänseblümchen. Dann erhob es sich und strich sich die Haare aus den Augen.
Der Läufer spürte, dass etwas überhand nahm, etwas Großes, Gefährliches. Kleine Mädchen dürften nicht allein in den Wald gehen.
Sein Puls verlangsamte sich nicht, während er sich noch ausruhte, er wurde schneller.
Der Läufer richtete sich auf.
Sein Herz schlug so hart wie vorher, aber es schlug auf eine andere Weise.
Er wusste, dass der Wald stumm war.
Liebes Nachtbuch,
heute ist der 29. Dezember 1998. Albern, im Nachtbuch meiner Kindheit zu schreiben, aber ich habe ein wenig zu viel getrunken. Ich war vierzehn, als ich das erste Mal einen Mann getötet habe, und seither habe ich nicht damit aufhören können. Eigentlich habe ich erst beim dritten begriffen, dass es Mord war, damals war ich einundzwanzig, aber ich denke kaum noch daran. Es hat sich einfach so ergeben. Und zum Glück kann man es mir ja nicht ansehen.
Der Erste ist mein Onkel Olaf gewesen. Olaf mit den Fischaugen und dem Schmerbauch. Er starb am 26. Dezember, im Jahr vor meiner Konfirmation.
Als ich damals die Tür zu dem Zimmer öffnete, in dem er lag, geschah etwas Merkwürdiges: Er wurde plötzlich zu dem fremden Mann im Wald. Ich geriet in Panik. Ich hatte das Gefühl, der Kopf wollte mir zerspringen. Und mich überschwemmte eine Woge von Aggression.
Ich erinnerte mich plötzlich an mein zerfetztes Kleid und die zerschrammten Arme. Daran, wie mein Herz in meinen Ohren hämmerte, wie die Steinchen sich durch meine Socken bohrten und unter meinen Fußsohlen festklebten. Als ich damals, vor so langer Zeit, in den Wald hineingegangen war, hatte ich mich vor nichts gefürchtet. Aber als ich wieder herauskam, fürchtete ich mich vor allem. Damals war mir zum ersten Mal ein böser Mann begegnet. Es gibt viele böse Männer auf der Welt. Aber es gibt auch einige böse Mädchen.
Das stärkste Gefühl, wenn ich einen Mann getötet habe, ist das Gefühl zu herrschen, Macht zu haben und Sicherheit. Und ich fühle mich glücklich. Richtig glücklich. Ich empfinde Ruhe. Alles stimmt. Plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung, jedenfalls für eine Weile. Das nennt man Omnipotenz. Darüber habe ich gelesen. Die vielen Beschreibungen von mir in diesem Text haben mir nicht gefallen. Er schrieb, ich litte an einer extremen Form von Verleugnung und Egozentrik und würde deshalb völlig normale Ansprüche meiner Umwelt als irrelevant abtun. Das führe dann zu dem Drang, Angst, Panik und Minderwertigkeitsgefühle zu unterdrücken, schrieb er. Es gehe darum, Stabilität zu gewinnen. Und das sei nur möglich, wenn ich die Kontrolle wiedererlangte. Omnipotenz also, aber das ist nichts als ein Wort, und Wörter sind nicht gefährlich.
... Trotzdem bin ich doch ein Mensch. Wenn das Gefühl der Befreiung sich gelegt hat, kommt die faserige Angst. Weiß und kalt kriecht sie mein Rückgrat hoch. Schwer wie ein Stein liegt sie im Bauch. Die Tage nach dem Mord an Onkel Olaf verschwimmen in meiner Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass Weihnachten war und dass ich mich durchsichtig fühlte wie Glas. Dass es eiskalt war. Und dass mich die konstante Winterdunkelheit umzingelt hielt. Die Dunkelheit, das waren die schwarzen Löcher in den Spitzengardinen. Schwarze Augen, die mich von draußen ansahen. Es knackte leicht in den Wänden, als wollte jemand dort ausbrechen. Die Möbel kamen mir fremd vor, das Zimmer roch anders. Die Stille im Haus, das kalte Lampenlicht. Ach, ich kann mich an alles erinnern.
Als ich oben im Kinderzimmer stand und die Gardinen zur Seite zog und zu den schwach leuchtenden Sternen hochschaute – sie waren weiß, fast durchsichtig wie Fingerabdrücke auf Glas –, hätte ich in diesem Moment, einem gefährlichen Moment, beinahe Mutter Berit erzählt, was ich getan hatte. Aber dann kam Besuch, Leute, die mit leisen Stimmen redeten, immer mehr Leute. Und das hat mich gerettet.
Die alte Standuhr tickte und tickte und schlug laut tönend jede halbe und volle Stunde.
Ich saß stocksteif in Großvaters altem Schaukelstuhl, und meine Füße waren eiskalt. Großmutter sagte, es gebe viele Arten zu trauern, und ich brauchte kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nicht weinte. Und das hatte ich auch nicht. Aber meine Schwestern weinten.
Ich wollte natürlich nicht ins Gefängnis oder ins Erziehungsheim. Ich wusste, dass man böse Kinder ins Erziehungsheim steckte. Ich wollte, dass alles wieder normal wäre. Und das wurde es ja auch, nach einer Weile.
TEIL 1 FROST
Schnee Nordlicht Wind
Kapitel 1 – Schnee
Der Schnee kann hoch oben als Regen beginnen und dann auf dem Weg nach unten gefrieren. Er kann wieder schmelzen, ehe er den Boden erreicht. Er kann mit dem Wind über Hügelkämme peitschen, und er kann sich zu unregelmäßigen Haufen sammeln. Trockener Schnee, der über den Boden treibt, wird zu kleinen Partikeln geschliffen und zu Schneewehen und Harschschnee zusammengepresst. Unter dem Mikroskop sieht Schnee aus wie kleine, aus Perlen zusammengesetzte Eissterne. Vor allem im Herbst, wenn der Schnee noch nicht liegen bleibt, kann es vorkommen, dass er in Gräben und an Waldrändern Schutz sucht. Dass Schnee weiß aussieht, hängt mit dem Sonnenlicht zusammen. Schnee ist weiß, weil er alles sichtbare Licht aus der Sonnenstrahlung reflektiert. In der Kälteperiode sind die Farben abstrakt. Der Winter ist eine geizige Jahreszeit.
Carol Marner schaltet die Lampe auf der Fensterbank ein. Es ist Samstag, der 22. Dezember 2003, erst kurz nach zwei Uhr nachmittags, und um diese Zeit herrscht in norwegischen Kleinstädten meistens Ruhe. Die Schneewehen am Straßenrand haben dunkelblaue Kanten. Das geizige Tageslicht, das mittags für kurze Zeit zu ahnen ist, hat sich zurückgezogen, und die Dunkelheit färbt die Landschaft jetzt wieder schwarz. Es ist eiskalt. Die wenigen Straßenlaternen, die es hier gibt, brennen rund um die Uhr, aber eine ist defekt. Das Licht flackert einige Male auf, dann erlischt es wieder. Die immer neuen Versuche des Lichts, sich festzusetzen, sind irritierend. Der Motor einer Schneefräse dröhnt regelmäßig. Die Fräse frisst hungrig den kalten Schnee vor einer Garage und spuckt die schwere Masse als dicken weißen Strahl wieder aus.
Auf dem Weg in die Küche fällt Carol Marners Blick im Spiegel auf ihr Gesicht. Sie geht zuerst daran vorbei, bleibt dann aber stehen und macht kehrt. Automatisch fährt sie sich mit der Hand durch ihre kurzgeschnittenen Haare. Ihr Spiegelbild starrt sie aus der ovalen Fläche aus geschliffenem Glas an. Der Untergrund des Spiegels ist vor Alter braungefleckt. Im Spiegel sieht sie das Foto hinter sich an der Wand, es ist aufgenommen worden, als sie drei oder vier Jahre alt war. Sie ist die Jüngste, sie ist die Dunkelste. Die beiden älteren Schwestern sehen auf dem Bild fast gleich aus. Das hat sich inzwischen geändert. Als Erwachsene sind Lisbet und Judith sehr verschieden. Obwohl es ein Schwarzweißfoto ist, kann Carol sich erinnern, welche Farbe die Kleider hatten. Sie weiß es eigentlich nicht selbst, aber ihre Schwestern haben darüber gesprochen. Rot, blau und gelb. In der Regel hatte jede ihre feste Farbe. Carol weiß noch, dass ihre Lieblingsfarbe eigentlich Rosa war. Aber die Großmutter sagte, Rosa sei nur etwas für Babys. Carol wusste, dass das nicht stimmte, die Nachbarstöchter trugen schließlich rosa Kleider.
Carol ist mager und hat fast keine Brüste, aber sie trägt einen BH, der das ein wenig korrigiert. Die Schwellungen unter ihren Augen ändern sich von Tag zu Tag. Manchmal wirkt ihr Gesicht aufgedunsen, wenn sie morgens aufwacht. Und das gerade jetzt, wo sie aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz eine Stelle im Laden unten im Haus gefunden hat und ziemlich gut zurechtkommt. Aber sie weiß nicht, wie lange sie sich da halten kann. Vorläufig hat sie noch nichts gestohlen.
Sie ist nicht wie ihre Schwestern, sie hat keine Angst, es zu zeigen, wenn sie sauer ist oder Angst hat. Aber jetzt hat sie eine gute Phase. Ihre beiden Schwestern leben in einer seltsamen Symbiose. Ist die eine abweisend oder übellaunig, wird die andere ängstlich und unsicher. Und ist die eine wieder freundlich, wird die andere abweisend und unleidlich. Es ist ein einsames Gefühl, danebenzustehen, aber Carol hat nicht die Kraft, sich da einzumischen.
Jetzt geht sie zum Fenster, reißt es sperrangelweit auf und rückt dann zwei Bücher im Regal gerade. Sie blickt auf das viele Weiß. Sie wandert jetzt schon seit mehreren Stunden ruhelos durch die Wohnung.
Die Schwestern beschweren sich immer über den Rauchgeruch. Der hat sich in den getäfelten Wänden festgesetzt. Jetzt packt die Kälte sie. Die eiskalte Meeresluft füllt das Zimmer. Carol beugt sich hinaus und sieht, dass sich Reif wie ein weißer Bart an die Außenwände geheftet hat. Sie steckt sich eine Zigarette an und bläst den Rauch in die Kälte hinaus, aber immer, wenn sie einen neuen Zug machen will, dreht sie sich zum Zimmer hin um.
Carol ist nervös, weil jetzt jeden Moment die Schwestern kommen können. Judith fährt den weiten Weg von Oslo mit dem Auto, während Lisbet nur ein gutes Dutzend Kilometer vom Krankenhaus in Tromsø hat.
Es sind noch zwei Tage bis zum Heiligen Abend. Normalerweise übernachtet Judith bei Lisbet in dem schönen Einfamilienhaus, aber in diesem Jahr haben beide gesagt, dass sie Carol besuchen wollen.
Sie hat Wohnzimmerwände, Vorhänge und Möbel zugeräuchert und sucht immer wieder die Erniedrigung, egal ob in ihrem sozialen Umfeld oder wenn sie allein durch die Straßen von Tromsø wandert, auf der Suche nach jemandem, bei dem sie schnorren kann. Sie ist wegen Ladendiebstahls und Vernachlässigung ihres Sohnes angezeigt worden. Sie ist als Rezeptfälscherin und Taschendiebin aufgeflogen. Sie hat in der Ausnüchterungszelle übernachtet und ist an der Endhaltestelle aus Bussen geworfen worden. Aber eigentlich ist sie stolz. Und stur.
Carol schließt das Fenster und geht in die Küche, wo sie anfängt, Kartoffeln zu schälen. Sie legt die Kartoffeln in einen Topf mit kaltem Wasser, damit sie sich nicht verfärben.
Lisbet ist Hebamme, und sie distanziert sich von allem, was ungesund ist, obwohl Carol glaubt, sich vage erinnern zu können, dass sie sie einige Male mit einer Partyzigarette gesehen hat, was jedoch schon lange her ist. »Deine Schwester ist so sauber, dass sie nach Chlor riecht«, sagte die Großmutter, als sie noch klein waren. Und so ist Lisbet noch immer. Sie hat schmale, gepflegte Hände mit sauberen, blanken Nägeln. Sie trägt ihr volles blondes Haar zu einem Pagenkopf geschnitten, benutzt diskreten Lippenstift und gerade ausreichend Augen-Make-up. Kühl ist eine Bezeichnung, die gut auf sie passt. Carol weiß, dass ihre Schwester eine gute Hebamme ist. Carol selbst hat ihren Sohn unter der Fuchtel einer strengen alten Furie geboren, als sie gerade siebzehn war. Die Schmerzen schienen sie zu zersägen. Sie weiß noch, dass sie trotz allem das Gefühl hatte, in kundigen, wenn auch feindseligen Händen zu sein.
Sie wirft einen Blick auf das schiefhängende Thermometer, das am Fensterrahmen befestigt ist. Draußen sind es neunzehn Grad minus. Alle wissen, dass Carol es nicht schaffen wird, die Feier am Heiligen Abend zu arrangieren. Der Heilige Abend ist Lisbets großes Meisterwerk, mit Weihnachtswichteln und Engeln und roten Herzen in den Fenstern. Und mit sauberen, frischgebügelten Tischdecken, perfekter Kost und kleinen Silberlöffeln, um den Kaffee umzurühren. Carol nimmt schon die ängstliche Unruhe wahr, die in ihrem Magen wütet. Sie muss eine halbe Flasche von etwas Stärkendem mitnehmen und die irgendwo verstecken, als heimliches Depot. Vielleicht im Kleiderschrank oder in ihren Stiefeln oder im Handtuchregal im Badezimmer. Natürlich hoffen alle, dass sie sich anständig benehmen wird. Sich anständig zu benehmen bedeutet, ruhig und ziemlich nüchtern zu sein, keine Witze zu erzählen und nicht in Tränen auszubrechen. Sie fragt sich, ob Judith auch in diesem Jahr Willy ausfindig machen wird. Er wohnt jetzt nicht mehr in der Pflegefamilie, sondern hat in Tromsø eine kleine Sozialwohnung. Und ohne ihn ist Weihnachten nicht Weihnachten.
Die Heizkörper geben in der kühlen Wohnung plötzlich leise Seufzer von sich. Ob den anderen schmecken wird, was Carol vorbereitet hat? Sie fasst sich an den Hals und spürt, wie das Blut in ihren Adern pulsiert. Sie geht zum Fenster und versteckt ihr Gesicht in den Vorhängen. Auch die riechen nach Stille, und die Stille breitet sich in ihr aus wie Gift. Vielleicht muss sie doch ein Valium nehmen, ehe ihre Schwestern kommen.
Judith Marner nähert sich Engelsvågen. Auf dem Kirchdach liegt Schnee, die Kirche ist angestrahlt. Judith fährt vorbei an der Fabrik, die jetzt einer Kette gehört, vorbei an der Tankstelle mit dem grellen Licht und dem baufälligen Haus, wo Virak in den alten Zeiten sein Café und den Süßigkeitenladen hatte. Der liebe, dicke Virak Karlsen, der immer lachte und lächelte und ihnen Drops und Lakritzschiffchen schenkte.
Bei dem hellgrünen Versammlungshaus biegt Judith ab und erreicht den kleinen Weg, der zu dem Haus führt, in dem sie und ihre Schwestern aufgewachsen sind. Der Weg ist fast derselbe, nur Hecken und Bäume sind etwas größer geworden. Aber hier im hohen Norden wächst ja nichts sehr schnell.
Als sie klein waren, hatten die Schwestern einen Baum im Wald, der ihnen gehörte. Sie kletterten darin hoch und setzten sich auf den zweitobersten Ast. Sehr hoch war das gar nicht, aber es kam ihnen so vor. Alles ließ sich berühren, wenn sie da oben im Baum saßen: Wind, Wolken und der papierfarbene Tagmond. Sie weiß noch, wie sie das Ohr an den Stamm legte und auf das dunkle Herz des Baumes lauschte. Sie weiß noch, wie der Baum im Sommer rauschte, wie er bei Regen hysterisch weinte und wie er im Winter den Schnee trug wie einen weißen Pelz.
Es ist fast 27 Stunden her, dass Judith in Oslo aufgebrochen ist. Eine Nacht hat sie im Hotel verbracht, in Mosjøen, ansonsten hat sie immer wieder einmal angehalten und ein Nickerchen eingelegt, aber wenn der Motor ausgeschaltet ist, wird es schnell kalt. An einigen Gebirgspässen staute sich der Verkehr, wäre die Straße wieder zugeschneit, hätte man im Auto erfrieren können. Riesige Schneepflüge gaben sich alle Mühe, die Pässe befahrbar zu halten. Einmal war vor ihr eine Schneelawine heruntergekommen. Bei Saltfjellet musste sie eine ganze Stunde warten, ansonsten aber ist die Fahrt gut verlaufen.
Beim Anblick der beiden kleinen, hellen Fenster in Mutter Berits altem Haus empfindet sie eine tiefe Wehmut. Die Betontreppe vor der Haustür zerbröckelt. Der weiße Anstrich blättert oben am Giebel und hinter der Regenrinne ab. Obwohl die Großmutter schon vor Jahren ins Pflegeheim gezogen ist und das Haus vermietet hat, gehört es ihr noch immer. Jetzt wohnen dort Michelle Tangen und ihr Mann. So haben sie als Kinder die beiden immer genannt. Michelle Tangen und ihr Mann. Vielleicht, weil Michelle aus England kommt, während Reidar Tangen sein ganzes Leben in Engelsvågen verbracht hat. Der langweilige Reidar mit seinen ewigen Strickjacken liebt Blumen und hat in einer Ecke des Gartens ein kleines Gewächshaus aufgestellt. Jetzt ist das Glas von Eis und Reif bedeckt.
Eine von Michelles drei Katzen sitzt auf der Fensterbank und leckt sich die Pfote. Judith sieht im Vorbeifahren die schwarze Silhouette hinter der Tüllgardine. Das erleuchtete Fenster ist ein gelbes Dreieck im Schnee, und die Katze zeichnet sich in der einen Ecke deutlich ab.
Früher haben Michelle und Reidar in dem Wohnblock hinter der Fabrik gewohnt, wo vor langer, langer Zeit auch Judith, Lisbet und Carol mit ihrer Mutter gelebt haben. Auch Onkel Olaf hatte dort eine kleine Wohnung.
Es war immer wieder von neuem phantastisch, wenn Michelle Tangen hereinkam und ihre dicken englischen Versandhauskataloge mit den Bildern von Frauen in feinen Kleidern mitbrachte. Judith, Lisbet und Carol lagen dann auf dem Boden und schnitten die Papierdamen aus den Katalogen.
Judith erinnert sich an das Geräusch der kleinen Scheren, die sich durch das Papier fraßen. Es war ein leises, ungefährliches Geräusch. Und sie erinnert sich an die Papierdamen, die in Spitzenunterwäsche, Kleidern, Mänteln, türkisund rosafarbenen Blusen und engen schwarzen Hosen nebeneinander lagen. Immer hatten sie einen kleinen Knick in der Hüfte und wohlgeformte, graziös aneinandergelegte Beine in schönen Schuhen. Und die Männer, mit ihren Hawaiihemden und ihren Schmalztollen. Sie erinnert sich an den Geruch im Wohnzimmer, den Geruch von warmem Winterzimmer. Das Bewusstsein, dass draußen der Reif in den Brettern saß, dass die Kälte sich mit ihren weißen Zähnen festgebissen hatte. Und in der Küche war Mutter Berit schon am Werk, um irgendetwas zu backen. Judith erinnert sich an das Gefühl, geborgen zu sein vor den Gefahren der Welt draußen.
In den Katalogen gab es auch Vorhänge und Teppiche, Handtücher und Bettwäsche. Alles von guter englischer Qualität. Die Vorhänge wurden ausgeschnitten und mit Spucke auf die Innenseiten von Pappkartons geklebt. Auf diese Weise bekamen die Papiermenschen ein Haus zum Wohnen und ein Zimmer, in dem sie sich aufhalten konnten. Und die Kleider wurden mit Büroklammern an den dünnen Körpern der Papierdamen befestigt.
Judith fährt noch hundert Meter, biegt vom Weg ab und stellt ihren neuen Volvo neben den kleinen Laden, über dem Carol wohnt. Ein gelbes Plakat mit dem Kilopreis für Schweinerippe steht auf einem Holzklotz in der Eingangstür. Die Lebensmittel in den beleuchteten Schaufenstern sind mit Lametta und norwegischen Fähnchen geschmückt.
Sie sieht den alten Sivander in seinem weiten Mantel über den Hof gehen. Er ist groß und dünn, fast knochig, und hat ein altmodisches, längliches Gesicht. Sicher war er bis jetzt im Laden, denkt sie. Der Laden ist sein Leben, sonst hat er kaum eine Beschäftigung. Jetzt dreht er sich um und mustert neugierig das fremde Auto, das auf den Hof fährt und hält. Judith winkt ihm zu, aber er erkennt sie nicht, er dreht sich nur um und geht langsam weiter.
Judith sieht zu, wie er in der Dunkelheit verschwindet. Dann beugt sie sich vor und schaut zu Carols Fenstern hoch. Eins steht offen. Da lüftet sie sicher, ehe wir kommen, denkt Judith.
Im Autoradio singt Louis Armstrong gerade die Schlusstakte von »What a wonderful world«.
Als sie den Motor des Volvo 70 ausschaltet, verschwindet die beruhigende Radiostimme, und die Heizung verstummt. Jetzt merkt sie, wie müde sie ist. Der starke Geruch von neuem Auto füllt ihre Nase auf angenehme Weise. Judith will gerade die Autotür öffnen, dann aber lässt sie die Hand wieder sinken und lehnt den Kopf für einen Moment an die Nackenstütze. Sie will sich nur ein wenig sammeln, sich einige Sekunden Ruhe gönnen, ehe sie zu Carol hochgeht.
Judith schließt die Augen. Nach und nach entsteht das Bild von Mutter Berits weißem Haus in ihr. Sie sieht es im Winter, wie jetzt. Und im Sommer, mit dem grünen Rasen und den Blumen an der Wand. Sie sieht es im Herbst. Und im Frühling. Und dahinter liegen die Berge wie eine dichte Mauer. Sie hört Lachen durch die Räume rollen und im ersten Stock jemanden weinen. Sie nimmt eine Stille wahr, die sich irgendwo hinter ihrer Stirn festsetzt, und sie sieht ein Fahrrad, das umgekippt auf dem Kiesweg liegt.
Sie hat sich auf das Wiedersehen mit ihren Schwestern gefreut, aber jetzt weiß sie nicht mehr so recht. Ihre Stimmung hat sich unterwegs verändert, und nun, wo sie am Ziel ist, empfindet sie nur Leere. Episoden aus ihrer Kindheit und Jugend wirbeln ihr durch den Kopf. Alles wird so fremd, gefährlich und kalt, jetzt, wo sie zu Hause ist. Sie freut sich ja auf Lisbet, fragt sich aber, in welchem Zustand Carol diesmal sein wird.
Morgen ist der dreiundzwanzigste Dezember. Dann wird sie Willy holen. Judith freut sich darauf, ihrem Neffen ihr neues Auto zu zeigen. Es ist zum Brauch geworden, dass sie ihn holt. Aber in diesem Jahr wird alles anders sein, denn Willy ist von seiner letzten Pflegefamilie in eine eigene kleine Wohnung in Tromsø gezogen. Dort scheint er jedoch nie zu sein. Gerüchte wollten wissen, dass er sich einfach herumtreibt, das hat Lisbet ihr am Telefon erzählt.
Judith weiß, wenn sie sich umdreht, wird sie die Lichter des Pflegeheims ahnen können, in dem die Großmutter lebt. Sie denkt an die alte Frau, die einsam und verlassen unter einer weißen Decke in einem viel zu grell beleuchteten Zimmer liegt. Morgen werden sie sie besuchen, alle drei. Und am Heiligen Abend wollen sie sie zu Lisbet nach Hause holen.
Judith versucht, die gute Stimmung wiederzufinden, mit der sie in Oslo aufgebrochen ist. Aber sie sieht nur das hellgrüne Neonlicht im Schaufenster.
Lisbet Marner Johansen wirft einen raschen Blick auf die Uhr. Das gelblich trübe Licht im Krankenhausflur wirkt vor der Dunkelheit draußen grell. Lisbet sieht ihr Spiegelbild im Fenster und weiß, dass sie zum Wiedersehen mit ihren Schwestern eine halbe Stunde zu spät kommen wird. So ist es fast immer. Sie hat das Gefühl, fast ihr ganzes Leben in der weißen Tracht verbracht zu haben. Weil sie alles richtig machen will, fühlt sie sich gestresst, wenn nicht alles so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Und Zeit gehört zu den Faktoren, die ihr immer wieder in die Quere kommen. Immer häufiger ertappt sie sich bei der Vorstellung, wie alles anders hätte kommen können.
Es war ein hektischer Nachmittag mit zwei Geburten, bei einer lief alles gut. Bei der anderen sah es nicht so einfach aus, aber um die hat Inga sich gekümmert, auch wenn die Gebärende deutlich durchblicken ließ, dass Lisbet ihr Kind holen sollte. Aber Lisbet stellte sich taub, verließ das Zimmer und überließ die Patientin ihrer älteren Kollegin. Jetzt hört sie das leise Wimmern des frischgeborenen Kindes.
Sie greift zur Fernbedienung und stellt den Fernseher leise. Auf einem roten Sofa neben einem viel zu stark geschmückten Weihnachtsbaum ist dort eine Frau zu sehen, die mit dem Ministerpräsidenten redet. Sie hat Ähnlichkeit mit Judith, denkt Lisbet, und streicht zerstreut eine Falte in ihrer weißen Tracht glatt. Die Frau auf dem Bildschirm lacht so herzlich, dass ihre dunkelblonden Locken beben. Sie ist hübscher als Judith, denkt Lisbet. Warum nur bringt sie es niemals über sich, ihrer Schwester etwas Nettes zu sagen? Ihre Fotos werden in vielen großen Zeitungen veröffentlicht. Wenn Carol dabei ist, hat Lisbet immer das Gefühl, sie dürfe nichts Positives über Judith sagen.
Als sie sich gerade umziehen will, kommt ein Zuwandererpaar durch die Tür. Die Frau jammert und lehnt sich an ihren Mann. Der ist bleich. Die Frau starrt ängstlich zu Boden. »Ist das euer erstes Kind?«, fragt Lisbet und schaut noch einmal ungeduldig auf die Uhr. Der Mann schüttelt den Kopf.
»Essen?«, zwitschert eine Schwesternhelferin aus der Tür des Stationszimmers. Lisbet dreht sich um, schüttelt den Kopf, sagt, dass sie jetzt aufbrechen werde. »Aber ich fahre nicht nach Hause, sondern nach Engelsvågen. Zu meinen Schwestern.« Sie bittet die Schwesternhelferin, der Stationsschwester Bescheid zu sagen, damit jemand sich um das neu eingetroffene Paar kümmert. Dann überredet sie die werdenden Eltern, sich in die zwei orangefarbenen Sessel vor der Wand zu setzen, und versichert ihnen, dass sich bald jemand ihrer annehmen werde.
Als sie im Umkleideraum die Krankenhauskleidung ablegt, nimmt sie den strengen Geruch ihres Körpers wahr. Sie kann nicht mehr duschen, und das ist ihr unangenehm. Aber sie zieht ein wenig Papier aus dem Behälter über dem Waschbecken, feuchtet es an und lässt Seife darauf laufen. Dann wäscht sie sich unter den Armen und zieht das blaue Wollkleid an. Sie streift eine dicke Strumpfhose über, ehe sie die Füße in die schwarzen Lederstiefel schiebt. Dann kämmt sie sich und wäscht sich gründlich die Hände. Vom Auto aus ruft sie ihren Mann an, der im Erdgeschoss ihres Hauses seine Arztpraxis betreibt. Die Vorstellung, dass etwas einfach nicht stimmt, kommt ihr in letzter Zeit immer häufiger, aber sie entschuldigt sich damit, dass sicher nur ihre Verachtung für alles, was mit Liebe zu tun hat, daran schuld ist. Sie wird daran arbeiten, genau wie ein Naturforscher mit schleimigen Larven arbeitet, aus denen dann schließlich schöne Schmetterlinge werden. Sie fragt ihren Mann, was die Söhne machen. Sie hat Essen für sie bereitgestellt, und sie hat ihnen auf Zetteln notiert, wie das Essen zubereitet wird. Ihr Mann sagt, sie solle sich einen schönen Abend machen. Lisbet mustert im Rückspiegel ihren Mund, in den Mundwinkeln liegt ein bitteres Lächeln auf der Lauer. Ihr graust davor, bei Carol zu übernachten, aber sie weiß, dass sie sich zusammenreißen muss. Sie verspürt ein Kribbeln im Magen, wenn sie daran denkt, dass sie bald Judith wiedersehen wird.
Die geheimen Muster, die Art, wie die Schwestern miteinander umgehen, alles, was um jeden Preis aufrechterhalten bleiben muss, denkt sie und sieht die tiefrote Rose aus Seide an, die ihr jüngster Sohn über den Rückspiegel gehängt hat.
Carol geht in die Küche. Sie wünscht sich Freundschaft, kein Mitleid, aber sie weiß nicht, wie sie die Maske abwerfen soll, die sie sich in all diesen Jahren zugelegt hat. Die Kartoffeln kochen im Topf vor sich hin. Auf der Anrichte steht eine Platte mit Roastbeef und rohen Zwiebelringen. Das Roastbeef hat sie unten im Laden eingepackt gekauft und auf der Platte arrangiert. Eine Lichtsäule von der Straßenlaterne liegt über Anrichte und Linoleumboden. Carol sieht zum Parkplatz hinunter und stellt fest, dass Judiths Wagen unten steht. Judith hat ihr von dem neuen schwarzen Auto erzählt. Für Judith sind Autos wichtig. Jetzt entdeckt Carol auch Judith, die weißen Hände, die sie auf dem Schoß verschränkt hat. Sie sitzt ganz still im Auto und wartet. Worauf wartet sie? Warum kommt sie nicht hoch? Hat sie mit Lisbet verabredet, unten zu warten, damit sie zusammen eintreffen können? Carol spürt, wie der Glaube, dass am Ende alles gut gehen wird, zerbröselt. Das Glück, das all ihr Leid rechtfertigen kann, wird vernichtet, wenn die Schwestern als Paar erscheinen und nicht einzeln. Das wäre mehr, als sie ertragen könnte.
Plötzlich fällt ihr etwas ein. Kurz bevor sie in die Schule kam, kniete sie einmal auf einem Stuhl vor dem Fenster und sang: »Papa, komm nach Hause ...« Ihre Stimme war hoch und rein. Hell, fast wie eine kleine Glocke. Damals hatte Mutter Berit sie zum ersten Mal geohrfeigt. Sie spürt noch immer, wie die Wange damals gebrannt hatte. Es ging eigentlich nicht so sehr um den Schlag, sie war schon häufiger geschlagen worden, von ihrer Mutter und von den Schwestern. Nur nicht von der Großmutter. Aber damals sah Carol wohl ein, dass nichts jemals wieder wirklich gut werden könnte. Sie erinnert sich an den Geruch des kalten Fensterglases. Wenn sie vom Stuhl stiege, hatte sie gedacht, würde die Kälte vom Boden durch ihre Socken dringen. Denn es war Herbst. Dieses Gefühl setzte sich in ihr fest und ließ sie seither nie wieder ganz los. Vielleicht war es damals, als sie beschloss aufzugeben.
Ihre Erinnerungen vermischen sich mit dem Bild des großen schwarzen Autos und der ältesten Schwester, die dort unten sitzt und wartet. Das Geräusch in diesem Bild erinnert sie an etwas. Sie sieht die hohen Schneekanten, das Schild mit dem Preis für Schweinerippe und das Lametta. Und die Pappkartons, die der Wind mitgefegt hat und die hinten bei den Mülltonnen aufeinanderliegen.
Judith dreht sich um und schaut zu Carols Küchenfenster hoch, und plötzlich entdeckt sie ihre Schwester. Ein schmales weißes Gesicht hinter der Fensterscheibe. Sie hebt die Hand und winkt, unbeholfen, fast reflexhaft, wie ertappt.
Sie fasst die Tüten und die Tasche zusammen, die auf dem Beifahrersitz liegen, öffnet die Tür und steigt aus. Hier oben gibt es eine besondere Luft, die sie von Besuch zu Besuch vergisst. Eismeerluft bei 70 Grad nördlicher Breite. Sie zieht ihren halblangen Daunenmantel fester um sich, stößt die Autotür zu und läuft mit der Tasche und den Tüten in den Händen über den Hof. Sie klingelt nicht, denn schon hört sie auf der Treppe Carols leichte Schritte.
Dann steht die jüngere Schwester plötzlich da, hinten im Treppenhaus, halb versteckt hinter der Tür. Judith lächelt.
Lisbet hält neben Judiths neuem Volvo. Wenn sie an ihre ältere Schwester denkt, krampft ihr Magen sich vor Wärme zusammen. Es ist Carol, die für das Unbehagen sorgt.
Lisbet beugt sich vor, öffnet das Handschuhfach und nimmt den kleinen Fotoapparat heraus. Sie will mit Selbstauslöser ein Foto von allen dreien machen. Sie sieht das Bild schon vor sich: drei Frauen, eine dunkle, eine blonde und eine dunkelblonde. Drei Paar Augen, Judiths braune, ihre eigenen blauen, und Carols trübe mit den dunklen Ringen darunter. Und ihre Münder, kurz vor einem Geständnis.
Sie steigt aus dem Wagen und weiß, dass die Begegnung der Schwestern die Sterne am Himmel nicht verschieben wird. Entfernung und Nähe lassen sich nicht in Zeit messen. In Mutter Berits Haus war das Leben geborgen und gefährlich zugleich. Das hat eine ganz besondere Schwesternschaft wachsen lassen, labil und gefährdet, dann aber wieder voller Fürsorge und Liebe. Plötzlich hat sie ein Bild im Kopf. Einmal durften sie für die Kinder des Pastors auf eine Ratte aufpassen. Die anderen beiden nahmen sie aus dem Käfig und streichelten sie. Lisbet selbst traute sich nicht, die Ratte zu berühren. Sie erinnert sich an das Geräusch des Laufrades in der Nacht. Ein lebendes Tier war im Zimmer, zwar ein kleines, aber kleine Tiere können größer werden. Sie hatte schreckliche Angst, dass die Schwestern sie allein lassen könnten, in der leeren Dunkelheit, mit dem wachsenden Tier.
Im Pflegeheim liegt die alte Berit Marner und schaut zur Decke hoch. Heute hat das Personal sie gezwungen, für zwei Stunden aufzustehen. Jetzt liegt sie wieder im Bett. An der Decke sieht sie ihre Küche. Tief in ihr ist das vielleicht das Einzige, was sie noch hat. Und sie weiß noch, dass die Nachbarskinder sie Mutter Berit mit den Kuchen nannten – weil sie ihnen immer etwas Süßes vorsetzte, wenn sie ihre Enkelinnen besuchten, Judith, Lisbet und Carol. Die Püppchen mit den niedlichen Kleidern. Sie nimmt den starken Geruch von Hirschhornsalz wahr, mit dem sie Sirupecken gebacken hat. Sie weiß genau, wie heiß das Bügeleisen sein muss, damit sie die Puffärmel mit den Rüschen nicht versengt. Sie bückt sich und öffnet eine Schublade. Weiß genau, wo was liegt. Holzlöffel ganz oben, Gabeln und Messer, von der Mutter geerbt, in der zweiten Schublade. Die gelben Tassen mit den Rosen stehen im untersten Regalfach über dem Spülbecken. Und im Fach darüber stehen die hellblauen Essteller von Figgjo, die sie werktags benutzt haben. Um den Rand zieht sich ein Zopfmuster in derselben Farbe.
Das Bild wird von den Schmerzen in den dünnen Armen und Hüften zerfetzt, die beim Liegen wehtun. Die eine Ferse hat sie wundgelegen, und ab und zu wird die Wunde gewaschen. Sie mustert die Zimmerdecke, hält Ausschau nach den kleinen Spuren im Anstrich. Sie navigiert nach den kleinen Unebenheiten, die sie so gut kennengelernt hat. Sie ist eigentlich wie dafür geschaffen, in diesem schlechtbeleuchteten Raum zu liegen. Nur die Nachttischlampe brennt. Aber mehr Licht wäre auch keine Hilfe. Denn hier ist sie notgelandet. Es war ein Schiffbruch, und sie ist nur noch ein Vogel von wenigen Gramm. Sie weiß sehr gut, dass das viel zu wenig ist. Sie bewegt die Hand langsam auf der Decke hin und her. Die Decke ist eine Filmleinwand, wo für alle Zeit am Küchentisch Hektik herrscht. Alle wollen gleichzeitig etwas zu essen, und sie muss für die Pastorenfrau ein Kleid nähen, ehe sie ins Postamt stürzt, um Briefe zu sortieren.
Eine Pflegerin kommt herein. »Bitte, sprich nicht so laut, Berit. Milla muss schlafen.« Eine Hand streichelt ihre Stirn, aber eigentlich nicht sanft, merkt Berit, sondern eher gebieterisch. Milla ist vielleicht ihr Kind? Nein, Milla ist nicht ihr Kind. Milla ist die alte Frau im anderen Bett. Deren Sohn ist offenbar auch umgebracht worden, auf dem Campingplatz, in einem Winter vor langer Zeit. Mutter Berit sieht an der Decke ihre Enkelinnen. Sie sitzen um den sauber gescheuerten Tisch und essen Waffeln mit Marmelade. »Weinst du nie, Mutter Berit?«, fragte Judith einmal, als sie acht oder neun war.
»Das hilft nichts«, antwortete sie.
»Aber was hilft dann?«
»Was hilft, ist böse zu werden«, antwortete sie.
»Wie denn böse, Mutter Berit?«
»So, mein Mädel«, sagte sie, griff zu einem Holzlöffel und hielt ihn demonstrativ hoch.
Wie froh sie war, wenn die Mädchen endlich oben in der Mansardenkammer eingeschlafen waren. Judith auf dem Bauch mit geballten Fäusten, immer mit geballten Fäusten. Lisbet auf dem Rücken, den Kopf eine Ahnung zur Seite. Sie atmete immer so leise. Oft beugte Berit sich über sie, um zu hören, ob sie noch lebte. Und dann Carol, der kleine Troll. Als sie noch ganz klein war, schlief sie auf den Knien und streckte die Hose mit der Windel in die Luft. Als sei sie bereit, jederzeit aufzuspringen. Die dunklen Haare klebten immer schweißnass und verwuschelt an ihrem kleinen Kopf. Die Mädchen waren jetzt groß, aber wo waren sie eigentlich? Wollten sie sie nicht holen kommen? Hatte sie nicht etwas darüber gehört, dass sie sie zu Weihnachten holen wollten?
Egal. Er war ja offenbar tot, der Junge. Es gab einzelne Dinge, an die sie besser nicht denken sollte. Sie wollte lieber an ihr Haus und an den Rasen im Sommer denken. Im Herbst, kurz vor Sonnenuntergang, fielen die Schatten wie Striche über die grüne Fläche. Die Striche bewegten sich, wie die Zeiger einer Uhr. Die Zeit kam auf sie zu, aber der Atem geht noch immer bei ihr aus und ein, während sie wie ein Fossil hier liegt und Abdrücke in der weißen Bettwäsche hinterlässt.
Judith, Lisbet und Carol sitzen in Carols kleinem getäfelten Wohnzimmer und essen Roastbeef mit rohen Zwiebelringen und gekochten Kartoffeln. Es gibt keine Soße und kein Gemüse. Carol sieht es jetzt, etwas fehlt, das Essen sieht farblos und trocken aus.
Die drei Schwestern führen an Carols Esstisch aus den siebziger Jahren mit den passenden Stühlen ein ziemlich angespanntes Gespräch. Lisbet erzählt, dass sie am Vortag bei der Großmutter war. Sie klingt dabei ganz leicht vorwurfsvoll. Carol wohnt viel näher, sie selbst muss vierzig Minuten fahren.
»Bei Mutter Berit gibt es nichts Neues«, sagt sie. »Alles ist so wie immer.«
Das Gefühl, dass sie keine Schwestern sind, überwältigt Carol wieder. Sie haben dieselbe Mutter und natürlich dieselbe Großmutter, aber keine von ihnen hat denselben Vater.
»Wir sind für den dritten Tag zu Michelle und Reidar eingeladen«, sagt Carol und öffnet eine neue Zigarettenpackung. Sie hat bisher nur im Essen herumgestochert und kann es ohne Nikotinzuschuss nicht mehr aushalten. »Ruth und Holger Eliassen kommen wohl auch«, fügt sie hinzu.
Judith sieht überrascht aus. »Eliassen, der alte Polizeichef, du meine Güte. Mit denen haben wir doch noch nie Weihnachten gefeiert.«
»Wisst ihr noch, wie sehr wir uns als Kinder vor Eliassen gefürchtet haben?« Lisbet schaudert es. »Immer wollte er alles im Griff haben. Auf dem Rasen vor dem Versammlungshaus durften wir nicht Fußball spielen. Hinter Viraks Café durften wir nicht auf die Bäume klettern. Die Äste könnten abbrechen. Die Bäume könnten darunter leiden.«
Carol trinkt einen Schluck Rotwein. »Ich weiß nicht, ob ich Mutter Berits Haus besuchen will«, sagt sie. »Das stimmt alles irgendwie nicht, wenn da andere Leute wohnen.« Seit Mutter Berit im Pflegeheim ist, war sie erst einmal da, obwohl es nur fünfzig Meter sind. »Es roch anders«, sagt sie. Nicht wie zu Mutter Berits Zeit, wo starker Seifengeruch, Küchengeruch und Red-Rose-Parfüm die Zimmer füllten. Mutter Berits Gerüche waren verschwunden, wie die Nippesfiguren, die schweren Möbel und die selbstgenähten Vorhänge.
»Jedenfalls haben sie uns eingeladen«, sagt sie jetzt. »Und ich hab es nicht über mich gebracht, nein zu sagen.« Carol schiebt sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Lisbet erhebt sich, geht demonstrativ zum Fenster und öffnet es. »Nur wir drei, oder kommen Erik und die Jungen auch mit?«
»Ich weiß nicht.« Carol gibt sich Feuer und macht einen langen Zug. »Ich glaube, sie haben nur uns drei gemeint. Holger war zweimal im Laden und hat sich nach Onkel Olaf erkundigt.«
»Ach, und warum?« Judith stellt ihr Glas auf den Tisch.
Carol zuckt mit den Schultern. »Er hat behauptet, dass er alte Fälle durchsah. Er hat mich auch nach Millas Sohn gefragt. Ich wollte euch das eigentlich nicht erzählen.«
Lisbet sieht ihre Schwester an. Carol macht einen ängstlichen Eindruck. »Wisst ihr noch, wie er mit seinem Gewehr Möwen erschossen hat? Ich weiß noch, wie ich ihm ein Möwenei gezeigt habe, das ich gefunden hatte. Er sagte, ich solle es auf den Boden legen. Und schon da wusste ich, dass der Vogel in dem kleinen grauen Ei niemals ein richtiger Vogel werden würde. Holger Eliassen hat das Ei zertreten.«
»Ich kann meine Familie am dritten Weihnachtstag nicht verlassen«, sagt Lisbet gereizt. »Das liegt doch auf der Hand, nicht am dritten Weihnachtstag. Erik und die Jungen können dann nicht allein sein.«
Jetzt fühlt Judith sich provoziert. Lisbet klammert sich dermaßen an die Konventionen. »Sicher kannst du das«, sagt sie, erhebt sich und schließt das Fenster.
»Nein.« Lisbet schüttelt energisch den Kopf.
Carol schaut Judith verzweifelt an. »Gehen wir zwei dann allein?«, fragt sie.
Judith zuckt gleichgültig mit den Schultern. »Werden ja sehen«, sagt sie.
»Das geht nicht«, sagt Lisbet genervt. »Sie müssen doch Bescheid wissen. Immerhin haben sie uns eingeladen.«
»Wir antworten morgen.« Judith fährt sich mit der Hand durch die Locken. Sie ist gesund und schön, auch sie hat kurze Haare, ihre aber sind hellbraun, und wenn sie lächelt, sind ihre hübschen gleichmäßigen Zähne zu sehen.
»Erzähl von deinem neuen Mann.« Lisbet schüttelt ihre Verärgerung ab und schaut Judith an, die kurz lächelt.
»Edgar«, sagt sie. »Er kommt aus Chile.«
»Ein Ausländer?« Lisbet ist überrascht. »Das hast du nicht erzählt.«
»Er ist kein Ausländer«, sagt Judith gereizt. »Er wurde adoptiert. Er ist mit zwei Jahren nach Norwegen gekommen. Damals hieß er noch Eduardo.«
Carol grinst und zieht wieder an ihrer Zigarette. Das Valium wirkt. Noch ein wenig mehr Wein, dann ist alles perfekt. Sie öffnet eine weitere Flasche.
Judith erzählt mit leisem Kichern, dass sie den norwegischen, den schwedischen und den finnischen Weihnachtsmann fotografiert hat. »Es heißt, dass die drei Länder sich um das Monopol auf den Weihnachtsmann streiten«, sagt sie. »Kein Wunder, dass es auf der Welt so unruhig zugeht, wenn sich sogar die Weihnachtsmänner fetzen. Genau wie dann, wenn Muslime, Juden und Christen sich um ihr Monopol auf Gott zanken. Auf den echten Gott, meine ich. Und jetzt sind einige Norweger sauer, weil die Finnen den Weihnachtsmann für sich haben wollen und der Welt weisgemacht haben, dass er aus Rovaniemi ist. Wo er doch aus Drøbak stammt«, lacht Judith und stellt ihr Weinglas vorsichtig auf den Tisch.
»Drøbak, also echt.« Lisbet fährt sich mit den Fingern durch die gepflegte Frisur. Sie braucht immer lange, um die Haare so zu sprayen, dass sie perfekt liegen. »Der Weihnachtsmann kommt aus Nordnorwegen. Er kommt von hier«, lacht sie. »Das wissen doch alle.«
»Die Schweden behaupten, dass er aus Schweden kommt«, sagt Judith und lacht ebenfalls. »Und es gibt auch Finnen, die meinen, dass er aus Harriniva bei Muoni stammt. Ich kenn mich da jetzt wirklich aus.«
»Wo ist das denn gedruckt worden?«, fragt Carol. Lisbet hebt ihr Glas, damit Carol nachschenken kann.
»Das stand in der SAS-Zeitschrift«, sagt Judith stolz. »Ich hab den Artikel zusammen mit einer Journalistin namens Tinna Agnesdóttir geschrieben, sie ist Isländerin.«
»Woher kennst du die denn?«, fragt Lisbet.
»Von einem Seminar in Stockholm«, sagt Judith geheimnisvoll.
Carol zieht an ihrer Zigarette. Judith erlebt so viel. Carol erinnert sich an einen lange zurückliegenden Heiligen Abend. Onkel Olaf war Weihnachtsmann. Am Heiligen Abend war er immer Weihnachtsmann. Zwei Tage darauf lebte er nicht mehr.
»Der Weihnachtsmann ist ja ohnehin tot«, nuschelt sie. »Verdammt, er ist doch im ersten Stock in Mutter Berits Bett gestorben, genau über unseren Köpfen. Der Fettsack«, fügt sie hinzu.
Die beiden anderen hören sofort auf zu lachen. Einige Sekunden lang beben diese Worte gefährlich zwischen ihnen. Sie haben ihren Onkel als Leichnam gesehen, alle drei. Als er die Treppe hinuntergetragen wurde, während die weißen Hände schlaff nach unten hingen. Zwei Augenpaare mustern die kleine Schwester. Und Carol nimmt sich in Acht. Sie schließt die Augen. Kleine gelborangefarbene Flecken tanzen hinter ihren Augenlidern. Dann lacht Judith. Lisbet schließt sich an, und Carol öffnet die Augen und lächelt vor sich hin.
Aber dann spürt sie einen Druck im Hals. Das ist so, wie an einer Muschel zu horchen, denkt sie. Alles Geheimnisvolle, was passiert ist, die Zeit, die außerhalb der Reichweite des Gedächtnisses liegt. Der tote Onkel. Das Leben der Mutter mit den vielen Männern, die Zeit, bevor und nachdem sie zu Mutter Berit gekommen sind. Ihre Gedanken streifen die Zeit, die sie mit ihrem eigenen Kind verbracht hat, mit Willy, ehe sie ihn hergeben musste. Wenn sie an Mütter denkt, denkt sie an schlampige Wesen mit Lippenstift. An Mütter, die falsche Wimpern benutzen und ihre Wohnzimmer mit künstlichen Blumen schmücken. Wie Muscheln sind sie. Außen schön, innen finster. Ganz innen enden alle Muscheln in einem Punkt, wo alles einsam ist, grau. Wie das Gefühl, das sie hat, wenn sie am Uferrand watet. Einmal, als sie alle drei klein waren, waren sie draußen auf einer Insel und wollten Möweneier sammeln. Die waren graubraun und hässlich. Zerbrechlich, aber trotzdem schwer von Leben. Und da hatte Carol die Conchylie gefunden. Sie behauptete jedenfalls, das sei eine Conchylie, aber im tiefsten Herzen wusste sie ja, dass es einfach eine ganz normale Muschel war.
Lisbet stochert im Essen. Jetzt sind sie wieder gefährlich nahe gerückt. Dem Punkt, der bei jeder ihrer Begegnungen bedrohlicher wird. Der Punkt erinnert an den klinischen Geruch von Desinfektionsmitteln. An das kalte Neonlicht der Krankenhausgänge. An den Schlüssel zum Medizinschrank, der klein und kalt in ihrer Tasche ruht. An die Angst davor, dass Carol sie noch einmal besucht und den Schlüssel zum Medizinschrank an sich bringt. Lisbet schaut ihre Hände an. Ihr Perlmuttnagellack ist teuer und glatt und lässt sich leicht auftragen.
Jeder Gedanke ist wie eine Berührung, die wehtut. Sie registriert jetzt Details. Ihre Sinne sind um einiges geschärft. Eine Hebammenschülerin hat einen Ring, der an einen Blutstropfen erinnert. Ringe und anderer Schmuck sind auf der Station verboten.
Sie greift zu der aufgeweichten Serviette und zupft sie auseinander, Schicht um Schicht. Als wäre die Serviette etwas anderes. Sie sieht ihre Schwestern an und erinnert sich plötzlich an die kalte Angst von damals, wenn Mutter Berit sich resigniert abwandte, wenn sie müde war.
Es war Sommer, als Judith und Lisbet für immer in Mutter Berits Haus zogen. Sie waren sechs und knapp fünf Jahre alt. Carol war ein Baby und wohnte noch immer bei Lilly im Wohnblock hinter der Fischfabrik. Ehe sie zu Mutter Berit kamen, war alles anders. Mutter Berit war damals einfach nur eine ganz normale Großmutter, die sie ab und zu besuchten. Sie besuchten sie zum Kaffee und zum Übernachten, und es gab Sahnetorte und gelben Saft und Essen auf feinen Tellern. Auf dem Tisch lag immer eine Decke. Und oft durften sie in der großen Badewanne baden, und sie bekamen saubere Wäsche, die Mutter Berit für Lilly gewaschen hatte. Danach gingen sie wieder in die Wohnung im Block. Zusammen mit Lilly. Immer zusammen mit Lilly.
Die Mutter hatte viele Freundinnen, die oft zu Besuch kamen. Und es gab immer ein lustiges Spektakel, wenn die Damen Tee mit Schuss tranken und über Männer und Kleider und schöne Schuhe sprachen. Lisbet und Judith lagen im Kämmerchen hinter der Küche und hörten zu. Aber das Lachen konnte auch gefährlich werden. Später nachts kam es vor, dass es in Johlen und Geschrei umschlug. Und oft kamen dann Männer. Die waren unzuverlässig, blöd und laut. Und Lilly wollte den nächsten Tag dann immer ganz verschlafen.
Nachdem sie zur Großmutter gezogen waren, kam es vor, dass Lisbet nachts in Mutter Berits Haus aufwachte und ihre Mutter lachen hörte.
Das neue Baby hatte Lilly so müde gemacht, dass Lisbet und Judith nicht mehr zu Hause bleiben konnten. Die langhalsige Frau Mork vom Jugendamt war mehrmals zu Besuch gekommen, und was sie dabei gesehen hatte, wollte ihr so gar nicht gefallen, sagte sie. Deshalb mussten sie umziehen.
Lisbet hatte Bauchweh bekommen. Sie stand nachts immer auf und ging hinunter in Mutter Berits leeres Wohnzimmer. Denn sie konnte nicht schlafen, wenn es draußen so hell war, dass die Rückseite der Vorhänge glühte. Aber dann kam der Herbst, und es wurde kälter und kälter, und Lilly und das Baby sollten am Heiligen Abend kommen.
Einige Wochen zuvor hatte Mutter Berit Lisbet gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünsche. Lisbet hatte geantwortet, sie wünsche sich ihre Mutter, aber da war Mutter Berit traurig geworden. Judith hatte die beiden von dem Küchenstuhl aus betrachtet, mit dem sie herumwippte. Sie hatte gesagt, sie wünsche sich eine Spielzeugpistole. Und als die Großmutter Lisbet das nächste Mal nach ihren Wünschen gefragt hatte, hatte sie das auch gesagt.
»Ich wünsch mir eine Spielzeugpistole, Mutter Berit.«
Judith steht auf und geht hinaus ins Badezimmer. Sie will das Gespräch auf etwas Handfestes, Angenehmes lenken. Soll sie den Schwestern vielleicht von ihren neuen Plänen erzählen? Von den Bildern, die sie aufnehmen, und von dem Buch, das sie zusammen mit Tinna herausgeben will?
Carol und Lisbet sitzen da, und jede schaut in eine andere Richtung. Lisbet kann ihre Gedanken nicht losreißen. Immer wenn sie ein neues Leben in Empfang nimmt, steht sie mit fast mathematischer Präzision vor dem mit weißen Laken bedeckten Gebärstuhl, sie sieht Gummihandschuhe und Blut. Und sie denkt an die großen Doppeltüren, die sich zwischen den Stationen öffnen und schließen.
»Noch Wein?« Carol schenkt ein, ehe Lisbet etwas sagen kann. Judith kommt zurück und setzt sich wieder auf ihren Stuhl.
»Ich habe gestern eine Geburt gehabt«, sagt Lisbet. »Und die Mutter war gelb und blau geschlagen worden. Ratet mal, wer der Vater ist!«
»Wer denn?« Judith spürt, dass sie die Antwort lieber nicht hören will.
»Tim Karlsen, Viraks Sohn. Aber ihr dürft nicht verraten, dass ich das gesagt habe.«
»Ist der liebe Virak wirklich schon Großvater«, sagt Judith seufzend.
»Ist sie wirklich misshandelt worden? Ich kenne sie eigentlich gar nicht.« Carol rutscht auf ihrem Stuhl hin und her.
»Sie kommt aus der Stadt. Sehr nett, schrecklich jung«, sagt Lisbet.
»Wie jung?«, fragte Judith ernst.
»Anfang zwanzig.«
»Tim ist genauso alt wie ich«, sagt Carol. »Sechsunddreißig.«
»Trägt er noch immer diesen albernen Cowboyhut?«, fragt Judith und denkt daran, wie Tim Karlsen zwei Jahre zuvor Carols Sohn zusammengeschlagen hat.
»Dreimal darfst du raten«, sagt Lisbet.
»Und Cowboystiefel«, sagt Carol grinsend, aber dann fällt ihr ein, wie der große, kräftige Mann ihren Sohn mit diesen Stiefeln getreten hat.
»Vielleicht sollten wir lieber weiter über die Weihnachtsmänner reden«, sagt Judith lachend. »Oder über das phantastische Buch, das ich herausgeben will. Wollt ihr davon hören?«
»Nein, erzähl weiter über diesen verdammten Frauenschläger.« Carol blickt ihre mittlere Schwester ernst an.
»Da gibf’s nicht mehr zu erzählen. Das ist nur traurig. Die Frau hatte blaue Flecken an den Armen und auf der Brust.«
»Und?« Carol steckt sich noch eine Zigarette an. »Wisst ihr noch, wie Willy damals vor zwei Jahren ausgesehen hat?«
Lisbet mustert ihre kleine Schwester mit ernster Miene. »Sie war natürlich gefallen«, sagt sie ironisch. »Das sagen sie immer.«
»War der Cowboy bei der Geburt dabei?« Judith kratzt an einer kleinen Wunde an ihrem Mund herum.
»Das war er. Er hat geweint, als das Kind in seinen Armen lag. Ein kleiner Junge.«
»O Scheiße«, sagt Carol. »Und kannst du gar nichts unternehmen?«
»Was denn?« Lisbet lächelt ihr mildes Lächeln und schaut Carol an. »Wie geht’s denn übrigens Willy?«, fragt sie. »Wann hast du ihn zuletzt gesehen?«
Carol spürt, wie der Alkohol jede Zelle ihres Körpers füllt und sie leicht und entspannt macht. Aber das, was sie über Tim Karlsen gehört hat, macht ihr gewaltig zu schaffen. Einmal hatte sie selbst etwas mit Tim Karlsen, vor langer Zeit. »Das ist nicht meine Schuld, das mit Willy«, sagt sie abwehrend. »Ich kann nichts dafür, dass Willy ausgeflippt ist. Es ist einfach so gekommen.«
»Aber wessen Schuld ist es, wenn nicht deine?«, fragt Lisbet.
Judith trommelt nervös mit den Fingern auf die Tischplatte.
»Das ist geerbt.« Carol setzt sich gerade. »Denkt an Mama. Denkt an Lilly.«
»Aber dann müssten Judith und ich doch auch ...«, sagt Lisbet.
»Das sind die Gene«, sagt Carol. »Dagegen ist man machtlos. Die einen kriegen mehr Gene als die anderen«, sagt sie und versucht, alles mit einem Scherz beiseite zu wischen. Sie dürfen nicht mit ihren Vorwürfen anfangen. Dann kommt es vor, dass sie einfach ausrastet. Wie vor einer Woche beim Arzt. Carol schnappt sich ihr Weinglas. Was hatte er noch zu ihr gesagt, der Arzt, den sie um etwas Beruhigendes gebeten hatte. Emotional labile Persönlichkeitsstörung, hatte er das genannt. Sie hatte zugegeben, unter starken Stimmungsschwankungen zu leiden, mit dem Sozialen Probleme zu haben, mit dem Verhältnis zu anderen Menschen, zum Jähzorn zu neigen. Sie hatte so getan, als sei sie seiner Meinung, hatte versucht, sich einzuschmeicheln. Trotzdem hatte der Arsch ihr kein Rezept geben wollen.
Judith schweigt. Sie denkt an die Liebe; ein Wort, das in dieser Familie nie benutzt wird. Es ist die Liebe, die dafür sorgt, dass sie sich einsam fühlt. Die Liebe zu ihren Schwestern, Gefühle, die sie nicht vermitteln kann, sie kann sie nicht aussprechen oder zeigen. »Es ist gut, Geschwister zu haben«, sagt sie plötzlich. »Gut, dass wir drei sind.«
»Aber wir sind doch keine Geschwister«, sagt Carol verbissen. »Keine echten Schwestern jedenfalls.«
»Natürlich sind wir Schwestern«, fährt Lisbet sie an.
»Du hast gut reden, wo du Vater und Mutter hast.« Carol hat keine Zigaretten mehr und holt sich eine Packung Drehtabak.
Judith spürt eine einsetzende Übelkeit, die sich langsam in ihrem Körper ausbreitet.
»Irgendwo, ja, aber wo?« Lisbet ist müde.
»In Oslo«, sagt Judith rasch. »Ich habe Walter in Oslo gesehen, Lisbet.«
»Nenn Walter nicht meinen Vater. Irgendwie ist er auch dein Vater. Wir waren doch eine Familie, wir vier, mehrere Jahre lang.«
Judith legt den Kopf in den Nacken und lacht. »Familie hin oder her. Aber ich weiß wirklich nicht, was Walter in der Stadt will, wo er doch immer seinen Rucksack gepackt und sich wochenlang im Gebirge herumgetrieben hat. Und Lilly saß dann mit allem allein da.«
Carol findet es wunderbar, wenn die beiden großen Schwestern aneinandergeraten und sie nichts damit zu tun hat.
»Also nenn Walter nicht meinen Vater«, wiederholt Lisbet beleidigt. »Du warst doch erst ein paar Monate alt, als er auf der Bildfläche erschienen ist.«
»Und was ist mit mir?« Carol sieht sie herausfordernd an. »Wie denkt ihr über mich? Ich hab nie dazugehört, oder was?«
Lisbet bereut es, wie sie sich ausgedrückt hat. »Aber damals warst du doch nicht einmal geboren, Carol. Du bist fünf Jahre jünger als ich. Sechs Jahre jünger als Judith.«
Carol wirft ihre Serviette hin, springt auf und läuft in die Küche. Nach einer Weile kommt sie mit Kaffee zurück.
Judith erhebt sich und nimmt Tassen aus der Vitrine. Sie wirft einen Blick aus dem schwarzen Fenster. Es sind neunzehn Grad unter null, trotzdem schneit es. Die Flocken sind trocken und lautlos. Die Bewegung des gefrorenen Wassers erinnert sie an etwas. Judith sieht, dass das Spiegelbild ihres Gesichts einer Totenmaske ähnelt, und plötzlich fällt ihr das Gebet ein, das sie als Kind ihre Schwestern gelehrt hat. Lieber Gott im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und gib uns unsere Mutter zurück. Amen.
»Jetzt nehmen wir uns zusammen«, sagt sie streng und dreht sich zu den beiden anderen um. »Jetzt haben wir für diesmal genug Wunden aufgerissen. Jetzt machen wir es uns gemütlich.«
Lisbet und Carol wechseln einen Blick, dann drehen sie sich zu Judith um und nicken.
Judith holt Atem. »Bist du für Heiligabend im Plan?«, fragt sie leichthin.
Lisbet nickt. »Die Plätzchen sind fertig, Essen und Geschenke hab ich gekauft. Aber ich muss morgen leider arbeiten. Zum Glück hab ich um fünf Dienstschluss. Und Erik ist ja zu Hause. Er hat die Praxis über Weihnachten geschlossen.«
»Das tun alle faulen Ärzte«, pöbelt Carol.
»Sag Bescheid, wenn ich irgendwas tun kann«, sagt Judith mit einem nachsichtigen Blick auf ihre kleine Schwester.
»Du wirst doch Willy holen?« Lisbet reißt sich zusammen, um ihre Verärgerung nicht zu zeigen.
»Ich hole Willy, und dann wollen wir ja Mutter Berit besuchen«, antwortet Judith.
»Wir schauen morgen Vormittag bei Mutter Berit vorbei, ehe wir in die Stadt fahren«, sagt Lisbet. »Aber ich brauche keine Hilfe, bei mir geht alles nach Plan.«
»Wie immer«, sagt Carol mit sarkastischem Lächeln.
Der pensionierte Polizeichef von Engelsvågen, Holger Eliassen, stand draußen im Schnee und spürte, wie die Kälte durch seine Stiefel drang. Er zog seine Uhr hervor, starrte in der Dunkelheit aus zusammengekniffenen Augen die Zeiger an. Er wusste, dass die drei Marner-Schwestern in der kleinen Wohnung über Sivanders Laden saßen. Beim bloßen Gedanken an die drei Frauen lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Er nahm in seinem Hals einen metallischen Geschmack wahr, wie Galle. Ein Satz aus der Untersuchung, die er gefunden hatte, hatte sich in seinem Kopf festgesetzt: »... ihr Mangel an Bestätigung und ihre ererbten Störungen haben zu vielen destruktiven Reaktionsmustern geführt, und das hat bisher im Mord an zwei Männern resultiert.«
Holger Eliassen war mit fünfundzwanzig fertig ausgebildeter Polizist gewesen. Er hatte sehr gute Noten gehabt, und seinen unfähigen Mitschülern hatte er nur Verachtung und Mitleid entgegengebracht. Im Herbst waren es fünfundvierzig Jahre her gewesen, dass er seine erste Stelle angetreten hatte. Seit damals hatte sich sehr viel geändert. Die neuen Polizisten hielten ihren Beruf für nichts Besonderes mehr, in der Praxis waren sie auf dasselbe Niveau wie Feuerwehrmänner und Sicherheitsleute herabgestuft worden.
Holger Eliassen war ein hervorragender Schütze. Er war auch Kreismeister im Schach. Seine Intelligenz reagierte auf gefährliche Tendenzen in der Gesellschaft. Er konnte sich auf Wellenlängen einstellen, die den meisten anderen unbekannt waren. Deshalb kam er Verbrechern oft zuvor oder war ihnen zumindest dicht auf den Fersen. Oft las er die Gedanken von Lügnern, ohne dass sie das merkten. Er war immer den Lösungen auf der Spur.
Ruth hatte die allerbanalste Frage angebracht, ehe er sie ins Schlafzimmer gejagt hatte. Woher willst du wissen, dass die Marner-Schwestern etwas Besonderes an sich haben, hatte sie gefragt. Ruth verstand ihn nicht. »Ich fühle mich einsam«, hatte sie gesagt und ihn mit den hellen Augen in ihrem runden Gesicht flehend angeblickt. Ihre Dauerwelle war straff, und ihr Körper war in den letzten Jahren gewaltig in die Breite gegangen. Sie war gemein zu ihm gewesen und hatte über sein Alter gespottet. Ruth ahnte nicht, dass es eine andere Luft gab als die, die sie in der Kirche einsog. Er hätte ihr von knallbunten Schaubildern erzählen können, die tote Körperteile und zerlegte Gehirnschalen und Leichen mit aufgeschlitzten Bäuchen zeigten. Aber diese Freude wollte er ihr nicht machen. Jetzt lag sie im Schlafzimmer, eingewickelt in Wolldecken.
Die letzte Stromrechnung war himmelhoch gewesen, und obwohl Ruth zu frieren behauptete, befahl er ihr, abends die Heizkörper auszuschalten. Er arbeitete an einem länger zurückliegenden Fall, den er jetzt wieder ans Licht holen wollte. Der Vorteil des Rentnerdaseins war, dass man langsam und genau sein und das Recht auf Arbeitsruhe geltend machen konnte. Das hatte es zu seiner Zeit bei der Polizei nicht gegeben. Er war sicher, dass die Fälle zu schnell abgeschlossen wurden, eben aufgrund von Zeitdruck. Doch die Vorstellung, dass ein Mörder frei herumlief, machte ihm eine Gänsehaut. Das durfte einfach nicht passieren.