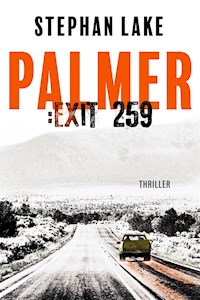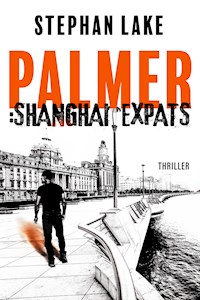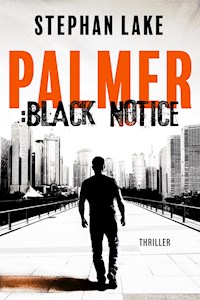Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Elijah Leblanc
- Sprache: Deutsch
Elijah Leblanc ist zurück in Trier. Keine freiwillige Sache, bestimmt nicht. Die Stadt ist untrennbar verbunden mit diesem einen Tag in seiner Jugend, der verdammt schief gelaufen ist. Ein Tag, eine falsche Entscheidung. Bislang glaubte Elijah, das sei Vergangenheit, ein tief in seiner Seele vergrabenes Geheimnis, von dem nur er weiß. Aber er denkt falsch. Der Kerl, der ihn nach Trier gerufen hat, kennt sein Geheimnis. Jedes schmerzhafte Detail. Er will schweigen, falls Elijah ihm einen Dienst erweist. Und falls nicht? Tja, Leblanc, dann wird noch heute mein Anwalt dein BKA informieren und deine eigenen Kollegen werden dich abholen und dein verlogenes Leben da draußen in Freiheit ist zu Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Lake
Layla
Elijah Leblanc - Zweiter Fall
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Impressum neobooks
1
Der Tag, an dem Georg Michael Snydr in die Zelle gebracht wurde, war der glücklichste Tag in seinem Leben.
Die Metalltür hinter ihm fiel ins Schloss.
Der Schlüssel wurde gedreht. Hart. Zwei Mal.
Snydr lächelte.
Er war am Ziel.
Endlich am Ziel.
Zwei Schritte: Snydr ließ sein Paket mit Bettzeug und Wäsche, Rasierer und Zahnbürste neben dem Bettgestell auf den Boden fallen. Zwei Pritschen übereinander. Aufgerissene Matratzen.
Drei weitere Schritte: Snydr blieb vor dem Fenster stehen, hoch oben über der Schüssel und vergittert. Die Luft roch nach Urin.
Kein Problem. Snydr sah ein kleines Stück vom Himmel. Ein kleines Stück Blau. Das würde reichen für seine Zeit. Er schaute nach unten. Die Schüssel würde er sauber machen. Kein Problem.
Snydr drehte sich um und fixierte den Kerl auf der unteren Pritsche.
Der Kerl hielt die Augen geschlossen.
Snydr lächelte.
Amadeus.
Endlich.
Endlich.
Die obere Pritsche frei. Für ihn. Den Neuen.
Snydr warf das Wäschepaket darauf. Die Eisenfedern quietschten.
Der Kerl hielt immer noch die Augen geschlossen. Aber er schlief nicht, da war Snydr sicher. Die Hände hinter dem kahlgeschorenen Kopf verschränkt, Beine angewinkelt, geschnürte Schuhe auf dem Laken? Der Kerl wusste von ihm. Wusste von einem neuen Zellengenossen, den er heute bekommen würde. Er war vorbereitet. Seit Stunden vermutlich. Der Kerl kannte die Regeln. Selbstverständlich. Viele Jahre Erfahrung. Seit seiner Jugend mehr drinnen als draußen. Er kannte die Regeln. Wusste, die erste Begegnung mit dem Neuen klärte die Rangfolge und entschied, wer Hammer war und wer Amboss.
Was der Kerl nicht wusste: wer der Neue war. Dass Snydr kein Gewöhnlicher war. Keiner, der seine Zeit absaß und dann rauskam bevor er wieder einfuhr.
Der Kerl wusste nicht, warum Snydr wirklich hier war. Wusste nicht, dass Snydr ihn kannte.
Ihn jahrelang gesucht hatte.
Jahrzehntelang.
Dass der pensionierte Kripomann Georg Michael Snydr von seinen Taten wusste.
Von allen seinen Taten.
Amadeus.
Snydr ließ ihn nicht länger warten. Er stieß seinen Fuß gegen den Pfosten.
Der Kerl öffnete die Augen.
„Was?“
Leise. Ohne sich zu bewegen. Ohne die geringste Andeutung von Besorgnis.
Eines seiner Augen war blau. Fast wie der Himmel draußen. Das andere war grün. Sehr selten, ein blaues Auge, ein grünes Auge. Sehr ungewöhnlich. Snydr war überrascht. Er hatte so etwas noch nie gesehen. Dazu das Tattoo. Geschlängelt. Wie die Wurzeln eines Baumes. Von der Mitte des Schädels über die Stirn um das blaue Auge herum und über die Wange mit den Aknenarben bis hinunter zum Hals. Wo es unter dem verschwitzten Shirt verschwand. Das gleiche Tattoo auf der anderen Seite. Vom Schädel über die Stirn um das grüne Auge herum und über die Wange zum Hals und unter das Shirt. Fette, schwarze, billige Tinte. Knasttinte.
Snydr lächelte. Lächelte und schwieg.
„Ich hab gefragt, Was?“
Lauter. Immer noch ohne eine Bewegung. Selbst seine Lippen rührten sich nicht.
Der Kerl machte alles richtig. Keine Angst zeigen, sondern Angst verbreiten. Einschüchtern. Dem Neuen zeigen, Ich bin der Boss.
Was bei Snydr nicht funktionierte. Snydr hatte keine Angst. Nicht vor einem kahlen Schädel und nicht vor schwarzer Tinte und nicht vor einem gezischten Wasss.
Nicht vor einem Kerl, von dem er wusste, dass er ein Mörder war.
Snydr lächelte.
Der glücklichste Tag in seinem Leben.
„Ich bin gekommen, um dich zu töten, Amadeus.“
Jetzt drehte der Kerl den Kopf. Seine Augen suchten in Snydrs Gesicht.
„Was sagste?“
Snydr lächelte.
„Zu wem sagste Amadeus?“
„Zu dir natürlich. Amadeus.“
Der Kerl stand auf. Langsam. Kraftvoll. Selbstbewusst. Schaute auf Snydr herab.
Snydr blieb stehen. Schaute hoch. Lächelte. Er war völlig gelassen. Und warum nicht. Snydr war achtundsechzig Jahre alt, und er war am Ziel. Was danach kam, spielte keine Rolle mehr.
Amadeus.
Gleich.
Snydr steckte die Hand in die Hosentasche.
Er spürte die Klinge.
Snydr lächelte.
Jetzt, Amadeus.
Der Kerl verschränkte die Arme. Muskeln wölbten sich. Adern traten hervor. „Okay, du Wichser, jetz hör du zu. Du bis hier bei mir zuhaus. My home. My rules. Hier sind mein Regeln. Nur mein. My fucking rules. You got it? Du tus, was ich sag. Erstes, du hörs auf, mich so zu nennen. Amadeus. What a shitty name. Shitty name, Amadeus. Ich heiß Nevada. Cat Nevada. I’m a Marine. United States Marine Corps. Got it, you sucker? Huh?“ Der Kerl grinste. „Du darfs jetz Yessir sagen. Yessir, Nevada, Sir.“
Snydr guckte.
Nevada?
Marine Corps?
Yessir?
Sein Lächeln versank.
Oh, nein. Nein. Nein. Nein.
2
„Elijah, warum hast du die noch nicht zurückgerufen?“
Elijah Leblanc, seit diesem Morgen neuer Leiter der Operativen Fallanalyse beim BKA und nicht wirklich froh darüber, sah zu Barbara hoch.
„Wen?“
Seine Sekretärin stand auf der anderen Seite des Schreibtischs, die Brille nach oben in ihr graues Haar geschoben. Das Perlenkettchen um ihren Hals schaukelte vor ihrer Brust hin und her, weil sie sich mit beiden Händen abstützen musste. Der Rücken.
„Wen, oh Elijah, wen. Diese Anwältin. Sie hat schon wieder angerufen. Vor einer Minute. Das dritte Mal heute Morgen. Drei Mal, Elijah. Kannst du die denn bitte jetzt mal endlich zurückrufen? Damit ich meine Arbeit machen kann?“
Elijah streckte den Arm aus.
„Was willst du jetzt?“
„Na, die Telefonnummer. Damit ich endlich zurückrufen kann.“
„Vor dir auf dem Haufen dort. Habe ich dir nach dem ersten Anruf schon hingelegt.“
Elijah guckte auf seinen Tisch voller Papiere. „Wo?“
„Weiß ich doch-“ Barbara stieß sich mit einem Seufzen vom Tisch ab und marschierte um ihn herum und hob Papiere hoch und Akten und schob den leeren Kaffeebecher mit FBI darauf zur Seite und hob mehr Akten hoch und mehr Papiere und seufzte wieder, marschierte hinaus ins Vorzimmer und kam zurück.
„Gut, dass ich mir alles zweimal aufschreibe. Hier.“
„Du bist die Beste.“ Elijah nahm den Zettel. „Die ruft aus Trier an?“
„Keine Ahnung. Hat sie nicht gesagt.“
„Die Vorwahl. 0651. Das ist Trier.“
„Na, dann Trier halt. Bitte, Elijah, ruf da an. Endlich. Ja?“
„Ich rufe an, Barbara.“
Was Elijah tat, als Barbara wieder draußen war.
Er sagte seinen Namen und BKA und, „Eine Frau Vianne hat-“
„Ja, Doktor Vianne erwartet bereits Ihren Anruf. Ich stelle Sie durch. Sie bleiben dran, ja? Moment.“
Er hörte drei Takte einer Musik, die er nicht kannte, Violinen, irgendetwas Klassisches, und dachte noch, Warum sollte ich nicht dranbleiben, da sagte eine kräftige, weibliche Stimme, „Vianne.“
„Leblanc, BKA. Ich bin noch dran.“
„Herr Leblanc, ja ... Sie sind noch dran? Was ...?“
„Sie haben angerufen, Frau Vianne?“
„Ja, dann, danke für den Rückruf. Drei Mal bereits.“
„Um was gehts?“
Sie sagte, „Um Herrn Snydr.“
Elijah musste nicht überlegen. „Und wer ist das?“
„Sie kennen Herrn Snydr.“
„Nein.“
„Meine Information ist, Sie kennen Herrn Snydr. Georg Michael Snydr?“
„Frau Vianne, wer ist das? Und warum ist er für das BKA wichtig?“
„Herr Snydr ist nicht für das BKA wichtig.“
Elijah wartete.
„Sondern für Sie, Herr Leblanc. Herr Snydr ist mein Mandant. Er möchte, dass Sie ihn besuchen. Noch heute.“
„Möchte?“
„Verlangt.“
Elijah sagte, „Besuchen wo?“
„Hier in Trier. JVA.“
„Und warum sollte ich das tun?“
„Ich kann Ihnen keine Ratschläge erteilen, Herr Leblanc. Ich bin hier nur ein ... sagen wir: Bote. Die Überbringerin schlechter Nachrichten.“
„Und damit meinen Sie: Überbingerin schlechter Nachrichten an mich?“
„Herr Snydr hat mich angewiesen, Ihnen mitzuteilen, dass er ein Schriftstück verfasst hat. Dieses Schriftstück liegt mir vor. Darin geht es um Sie. Sollten Sie ihn nicht besuchen, noch heute, bin ich angewiesen, das Schriftstück an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Auch heute.“
Elijah schüttelte den Kopf. Ein Schriftstück über ihn an die Behörden? Was sollte das?
Er sagte, „An die zuständigen Behörden. Welche Behörden wären denn zuständig?“
„Die Staatsanwaltschaft natürlich.“
Elijah guckte auf die Uhr an seinem Bildschirm. Kurz vor neun. Für zehn Uhr hatte er die Dienstbesprechung angesetzt. Seine erste als neuer Leiter der OFA.
Die Staatsanwaltschaft natürlich.
Es gab Schlimmeres, als die erste Dienstbesprechung zu verpassen.
„Und um was es geht, das dürfen Sie mir nicht sagen? Oder sollen Sie mir nicht sagen.“
„Nicht im Detail.“
Elijah wartete. „Aber im Groben? Frau Vianne, ich brauche hier schon etwas von Ihnen, um die Fahrt zu machen. Mein Wagen ist alt, ich möchte ihm jeden unnützen Kilometer ersparen.“
„Ich soll Ihnen eine Einzelheit sagen. Ein Datum.“
„Ein Datum. Na, dann mal los.“
„19. März 1983.“
Sie sagte, „Sind Sie noch dran, Herr Leblanc?“
3
„Na, keine Schule heute?“
Elijah blieb stehen. Er guckte auf den Mann hinter dem Gartenzaun, wechselte seine Sporttasche in die andere Hand und schüttelte den Kopf.
„Nur alle zwei Wochen is Samstag Schule. Heute nicht, Herr Lamberty. Nächsten Samstag wieder.“
„Aber du gehs noch zur Schule, gell?“
„Sicher geh ich.“
„Nit wie die andern, die sich nur rumtreiben.“
„Ich geh zur Schule.“
„Du solltest dich von denen fernhalten. Besonders von dem Tschaikowsky. Von dem hört man Sachen. Keine guten. Und von dem Großen, Schweren, der immer bei dem is auch nit.“
Elijah war still.
Herr Lamberty stützte sich schwer auf die Schaufel und nickte. „Wenn heute keine Schule is, dann hättest du ja Zeit. Oder?“
„Zeit? Wofür?“
„Am Montag krieg ich Bäume, zweiundzwanzig Stück. Ich will hier dichtmachen“ – Herr Lamberty deutete mit der Hand den Zaun entlang – „damit uns nit jeder in unser Wohnzimmer gucken kann. Tannen sind dafür am besten. Immergrün, also auch im Winter. Ich hab noch zwanzig Löcher. Zwanzig. Der Boden is ziemlich hart, weißte?“ Als Elijah nicht antwortete, „Ich geb dir für jedes Loch zwei Mark, Elijah. Zwei Mark und ne Limo. Wat meinste?“
„Ich kann nicht zwanzig Limo trinken, Herr Lamberty. Da bekomm ich Bauchweh.“ Über Elijahs Gesicht flog ein Lächeln.
„Wie? Nee, eine Limo, eine insgesamt. Aber für jedes Loch zwei Mark.“
Herr Lamberty hatte eine Glatze und einen dicken Bauch und trug die braune Polyesterweste, die er jeden Tag trug. Sommer, Winter, kalt, warm, Regen, Sonnenschein, Elijah hatte ihn nie anders gesehen als in seiner braunen Polyesterweste. Fünfzig war er vielleicht oder sechzig oder vierzig, jedenfalls über dreißig. Elijah konnte das Alter von Erwachsenen nicht gut schätzen. Aber er sah alt aus und nicht gesund. Seine Frau hatte auch einen dicken Bauch, die Frau Lamberty, aber viele Haare und eine Brille. Beide waren echt nett. Sie waren keine von denen. Nur Elijahs Humor verstanden sie nicht.
Zwanzig Löcher. Der Herr Lamberty könnte einen Infarkt von zwanzig Löchern bekommen. Von zehn. Er rauchte viel. Auch jetzt. Rauchen und Übergewicht und dann dieses Alter, jeder wusste das. Kam im Fernsehen und im Radio, überall, ständig, und Aerobic machte Herr Lamberty bestimmt auch nicht.
Elijah sagte, „Wie tief und wie breit?“
„Na ja, ‘n Meter etwa. Tief. Einer breit. Die Bäum sind schon größer und die Wurzeln dann auch, aber der Boden hier is ja richtig hacht. Gewachsener Boden, weißte? Auf jeden Fall muss ich Mutterboden dazu schütten. Obendrauf. Kommt heut Nachmittag. Also ein auf ein Meter, so ein auf ein, ungefähr. Vielleicht wat weniger. Ich mess nit nach. Oder haste wat vor? Fußball oder so?“
Herr Lamberty nickte auf die Sporttasche.
Elijah schüttelte den Kopf.
Er überlegte. Ein auf ein Meter. Ein Kubikmeter. Mal zwanzig. Zwanzig Kubik Erde.
Zwanzig mal zwei Mark. Vierzig Mark. Und ne Limo.
Er hatte keine Schule, und er spielte kein Fußball, aber er hatte tatsächlich etwas vor. Wenn er die Wohnung bekam, und seine Chancen standen gut, hat Herr Adams gesagt, dann hatte er es geschafft. Der Herr Adams war okay, der wollte ihm helfen. Elijah musste aber den Termin einhalten, er musste pünktlich sein, auf jeden Fall. Zwanzig Löcher, das dauerte zu lange.
„Zehn Löcher heute, zehn morgen.“
Elijah beobachtete, wie Herr Lamberty auf die Kippe zwischen seinen gelben Fingern guckte und sie dann hinter sich in seinen Garten schnippte. Eine geübte Bewegung.
„Gut. Zehn heute. Wann?“
Elijah stellte die Tasche ab und zog seine Jacke aus. „Jetzt.“
Da wusste er noch nicht, dass er die zweiten zehn Löcher niemals graben würde.
4
Leiter der Operativen Fallanalyse beim BKA Elijah Leblanc saß in seinem nicht mehr ganz neuen Geländewagen, als über das Tuckern des Achtzylinders hinweg Whitesnake einen Anruf meldete. I don‘t know, where I’m goin‘, but I sure know-
Er guckte von der Straße weg auf die Nummer und drückte die Taste. „Hi Jo.“
„Hi Baby. Wo bist du?“
„Eifel, in der Nähe von-“ Elijah sah das Schild. „Gerade Abfahrt Daun vorbei.“
„Du hast deine erste Dienstbesprechung als unser neuer Chef, statt deiner kommt aber Wibke rein und fragt nach Kaffee und Schnittchen und fängt an zu reden. Und du fährst in die Eifel. Was gibts in der Eifel, Baby?“
Sie waren noch in der allerersten Phase als Paar, und Elijah war von einem Kosenamen für Jo noch einige Monate und viele Nächte entfernt. Jo war da deutlich schneller. Baby. Elijah war beim ersten Mal irritiert, als sie es sagte, und er war es jetzt. Keine hatte bis dahin Baby zu ihm gesagt. Immer nur Elijah. Oder Leblanc. Manchmal auch Arschloch.
Eine Einzige hatte ihn Eli genannt.
1983.
Der 19. März war-
„Baby, was gibt es in der Eifel?“
-ein Samstag. Zunächst war alles gut. Sehr gut sogar. Dann nicht mehr.
„Elijah?“
Elijah atmete ein und aus, leise, damit Jo es nicht hörte. Er wollte nichts erklären. Nicht jetzt. „Eine Autobahn, die nach Trier führt. Von da habe ich einen Anruf bekommen, eine Anwältin. Dem muss ich mal nachgehen. Wieso fragt Wibke nach Schnittchen? Wir haben nie Schnittchen.“
„Neuer Fall? Ich hätte mitfahren können.“
Jo war gut für ihn, und er, so versicherte Jo ihm ständig, war gut für sie. Darüber hinaus war Jo König eine wirklich gute Polizistin.
Aber das hier war persönlich. Er hatte niemandem davon erzählt. Jemals.
„Weiß nicht, obs ein neuer Fall wird. Vermutlich nein. Hört sich nicht danach an.“
„Wonach hört es sich an?“
Elijah atmete wieder leise ein und aus und sah von der Straße weg auf Hügel, Felder, Wald. Verdorrtes Grün hinter einem dünnen Regenschleier.
Er hatte zehn Löcher gegraben.
Es hatte-
„Elijah, wonach-“
„Jemand hat was zu erzählen, Jo. Sitzt in der JVA. Du weißt, wie die sind, die tun alles, um rauszukommen. Erzählen eine Menge Blödsinn, der uns Zeit kostet. Ich berichte, wenn ich zurück bin, okay? Wie hat sich Wibke angestellt? Außer Schnittchen?“
„Wibke? Was fragst du nach ihr? Sie war vorbereitet wie immer, war ja nicht ihre erste Besprechung. Wann kommst du zurück? Ich könnte uns was kochen. Lukas ist ab heute Abend auch da.“
Lukas, Jos Sohn, der abwechselnd eine Woche bei ihr und eine Woche bei seinem Vater – und Jos zukünftigem Exmann – Thomas wohnte. Jo und Thomas waren sicher, das wäre das Beste für ihren Jungen, der mit seinen fünfzehn Lenzen mitten in seinem persönlichen Umbruch steckte.
Elijah war da anderer Ansicht, aber er hielt sich raus. Thomas war Lehrer.
„Aha. Kommt Eve auch?“
Eve war Lukas‘ Freundin. Noch so eine komplizierte Sache. Denn Eve war die Tochter von Christina, und Christina war die Freundin von Thomas. Christina war im übrigen Lehrerin. Kein Zufall.
„Eve ist Vergangenheit. Eine Neue ist auch noch nicht in Sicht, soweit ich weiß. Lukas hat zumindest noch nichts gesagt. Wie siehts aus, kommst du heute Abend?“
Das würde also wieder auf einen Abend zu Dritt hinauslaufen. Elijah mochte Lukas, hatte ihn sogar ein paar Mal zum Training mitgenommen, aber seiner Meinung nach sollte ein Fünfzehnjähriger nicht die Abende mit seiner Mutter und deren Freund verbringen. Und der Freund der Mutter, ganz ehrlich, hatte dazu auch nicht die richtige Lust. Solche Abende zu Dritt hatte es bereits zu oft gegeben.
Elijah antwortete nicht.
Er hatte zehn Löcher gegraben, und es hatte zu regnen begonnen. Genau wie jetzt, nur stärker. Danach seine eigene Wohnung und ... Alles war gut. Aber irgendwann waren Tschako und die anderen um die Ecke gekommen. Und ab da war alles-
„Elijah?“
-schief gegangen. Eine verdammte-
„Herr Leblanc? Hallo?“
-Katastrophe. „Was, Jo?“
Er musste sich ungehalten angehört haben, denn Jo sagte, „Ob du kommst heute Abend. Sag mal, was ist los mit dir?“
„Ja, ich weiß ... Vielleicht, was meinst du, wärs nicht tatsächlich besser, wenn ihr beiden mal wieder einen Mutter-Sohn-Abend macht? Du könntest Lukas fragen, ob er eine neue Freundin hat. Und wie es mit Eve weitergeht, das wird ihn auch beschäftigen. Und ich bin mir sicher, Lukas will mich bei so einem Gespräch nicht dabei haben. Er-“
„Eve ist Vergangenheit, Elijah.“
„Das habe ich gehört, aber ihre Mutter ist mit deinem zukünftigen Exmann zusammen, und, na ja, Lukas wird also immer wieder Eve sehen. Zwangsläufig jede zweite Woche, wenn er bei seinem Vater ist. Nicht einfach für ihn, oder? Allein schon, weil Christina ja auch in seiner Schule-“
„Lukas ist nicht mehr mit Eve zusammen und, tja, die neueste Neuigkeit, Thomas nicht mehr mit Christina. Ich meinte natürlich mit Chrissi.“
„Oh.“
„Jetzt sag mal, alles in Ordnung mit dir?“
„Ja. Wieso?“
„Du hörst dich anders an. Als würde dich etwas beschäftigen. Ich meine, mehr beschäftigen als sonst.“
„Nichts weiter. Nur Wibke und die Schnittchen. Wir haben nie Schnittchen. Was soll das? Und Trier natürlich, du weißt ja.“
War das jetzt schon gelogen? Also, richtig gelogen? Die Schnittchen schon, ja. Aber er wollte Jo nicht erklären, was los war. Er wusste es ja selbst nicht genau. Und er hatte gelesen, dass Menschen sich jeden Tag ein Dutzend Mal anlügen oder zwei Dutzend Mal oder sogar noch öfter, nur so könnten sie miteinander leben. Andererseits, wäre er richtig eng und vertraut mit Jo, so, wie Jo mit ihm, dann hätte er ihr jetzt schon mehr erzählt.
Oder?
Sie sagte, „Na gut. Du kommst also nicht heute Abend?“
„Sprich du mal in Ruhe mit Lukas, Jo. Wir sehen uns morgen.“
„Okay, Baby ... Bis morgen dann.“
„Ja, dann.“
Elijah drückte die rote Taste.
Er schaltete den Scheibenwischer aus. Es hatte aufgehört zu regnen.
Was Tschako wohl heute machte.
5
„Sieht gut aus, das da, Elijah. Zehn Löcher in soner kurzen Zeit. Du bis echt stark. Echt.“
„Ich muss jetzt los, Herr Lamberty.“
Elijah zog seinen Pullover über das verschwitzte Baumwollshirt und seine Jeansjacke über den Pullover. Noch war ihm warm, aber das nasse Shirt würde ihn schnell auskühlen. Er musste es bald wechseln, aber er hatte Ersatz dabei.
„Bis gerade noch vorm Regen fertig geworden. Fängt schon an zu trüpseln. Wann kommst du morgen?“
„So wie heute?“ Elijah lehnte die Schaufel an den Zaun.
Herr Lamberty nickte. „Gut.“ Er kramte in seiner Hosentasche und zog zwei Zehnmarkscheine hervor und hielt sie Elijah hin. „Mach keinen Unfug damit, Elijah. Kein Alkohol oder so, Zigaretten. Rauchen is ungesund.“
Elijah warf die Tasche über die Schulter und nahm das Geld, sein Blick dabei auf Lambertys andere Hand mit dem frisch angezündeten Stängel.
„Ich weiß, ich rauch und geb dir gute Ratschläge. Aber hör drauf, Elijah. Sei schlau. Rauchen is nix für Jungs in deinem Alter. Später is dat nit mehr so schlimm, wenn du erwachsen bis. Aber wenn du jung bis schon. Spielst du Fußball?“
Elijah wischte seine Schuhe am Gras und schüttelte den Kopf.
„Spiel Fußball, Fußball macht die Lungen stark.“
„Ich rauche eh nicht, Herr Lamberty, und ich geh zum Boxen und zum Judo. Dreimal die Woche.“
„Dat is auch gut, ja. Und hör mal, der Tschaikowsky und die andern. Ich hab dich die Tage mit denen zusammen gesehen, unten bei der Eisenbahnbrück. Halt dich fern von denen, Elijah, wat meinste? Du bisn guter Kerl. Würd mir leid tun.“
Elijah hörte auf zu wischen. Seine Schuhe waren immer noch nicht sauber, aber wenigstens hingen keine Erdklumpen mehr daran.
„Ich muss los. Bis morgen dann, Herr Lamberty.“
Herr Lamberty zog an der Zigarette und nickte.
Ursprünglich hatte Elijah zu Fuß gehen wollen – na ja, gehen müssen – quer durch die Stadt in den anderen Stadtteil, der wie eine neue Welt für ihn sein würde. Kürenz. Wie sonst sollte er dorthin kommen ohne Geld und ohne Fahrrad oder Moped. Aber jetzt hatte er Geld, zwanzig Mark, und der Regen hatte zugelegt. Als er an die Hauptstraße kam, war seine Jacke bereits nass. Er würde einen besseren Eindruck hinterlassen, wenn er einigermaßen trocken ankäme.
Ein Bus hielt an der Haltestelle. Elijah winkte und sprang hinein und legte dem Fahrer einen der beiden Zehner hin. Hinter ihm zischte die Tür zu. Aber der Bus fuhr nicht ab.
„Hast du‘s nicht kleiner?“
„Nein.“
„Nehm ich nicht. Keine Scheine. Keine Zehner. Wenn du‘s nicht kleiner hast, musst du wieder aussteigen.“
„Ich habs aber nicht kleiner.“
„Dein Pech, nicht meins.“
„Es regnet. Ich habe Geld. Sie sind verpflichtet, mich mitzunehmen.“
„Verpflichtet bin ich überhaupt nichts, junger Mann.“ Der Fahrer drückte auf einen Knopf am Armaturenbrett. Die Tür zischte wieder auf. „Und jetzt, entweder Kleingeld oder raus. Meine Fahrgäste wollen weiter.“
Elijah guckte in den Bus. Zwei ältere Damen saßen da, mit Hut, Handtasche auf dem Schoß. Beide guckten gelangweilt aus dem Fenster. Ansonsten war der Bus leer.
Elijah sah den Fahrer an. Ein bärtiger Kerl mit strähnigen Haaren.
„Also, was jetzt?“
Er würde pünktlich nach Kürenz kommen, das schon, er hatte genügend Zeit eingeplant. Aber er würde vor Nässe triefen und mit seiner alten Kleidung stinken wie ein Hund. Und es war kalt.
„Typisch“, sagte Elijah und stieg aus.
„Was hast du gesagt?“
Elijah drehte sich um und sah dem Fahrer direkt in die Augen. „Typisch, hab ich gesagt.“
Aber der Fahrer blieb sitzen und guckte nur und drückte dann den Knopf. Die Tür zischte zu und zugleich fuhr der Bus los.
Elijah sah dem Bus hinterher. „Typisch für euch Erwachsene.“ Hauch wirbelte vor seinem Mund.
Elijah schlug den Kragen seiner Jacke hoch und ging los. Die Hauptstraße entlang, wo in einem Hauseingang ein paar Jungs und Mädels aus seinem Viertel rumhingen und rauchten und eine Bierflasche kreisen ließen. Sie sahen ihn mit seiner Tasche, zwei der Mädchen riefen etwas, aber er antwortete nicht. Dann über die Eisenbahnbrücke, wo er auf der anderen Seite Moppe sah. Moppe war allein, Tschako und die anderen waren nicht bei ihm. Moppe sah nicht sehr glücklich aus mit seinen herunterhängenden Schultern. Vielleicht war er auf dem Weg ins Krankenhaus, wo er wieder seiner Mutter helfen musste, die arbeitete da in der Kantine. Moppe hasste das Krankenhaus und die Kantine, und er hasste seine Mutter.
Elijah guckte vor sich auf den Boden und tat, als wäre er in Gedanken, was ihm nicht schwer fiel. Moppe beachtete ihn nicht; vielleicht erkannte er aber Elijah auch nicht, Moppes Brille hatte sehr dicke Gläser, und dann der Regen.
Über die Moselbrücke gingen sie beinahe parallel, Moppe links auf dem Bürgersteig und etwas vor, er rechts und etwas zurück, dazwischen die Straße und unter ihnen die Mosel, die nach dem ständigen Regen der letzten Wochen über die Ufer getreten war. Danach trennten sich ihre Wege. Moppe bog links ab, tatsächlich Richtung Krankenhaus, Elijah ging geradeaus weiter. So lange, bis er zum alten Bunker kam.
Er drückte die Klinke, aber die Eisentür war verschlossen. Wie immer. Die Tür war immer verschlossen. Tschakos Bruder hatte einmal behauptet, er wäre im Bunker gewesen, die Tür wäre offen gewesen, und er wäre hinein gegangen und wäre durch den gesamten Bunker gelaufen. Elijah glaubte das nicht. Der Bunker war ein Kriegsbunker, die Tür war immer verschlossen. Und Tschakos Bruder saß heute in der Gottbillstraße, was schon alles sagte.
Elijah drückte sich gegen die Tür und tauschte das nasse Shirt gegen das trockene aus seiner Tasche. Er hätte das früher machen sollen, sein Pullover war auch bereits feucht. Aber zu spät. Er besaß keinen zweiten Pullover. Er fragte sich, warum Moppe seine Mutter so hasste, sie hatte einen festen Job im Krankenhaus, das war doch nicht schlecht, und sie war immer nett zu Moppe und zu Elijah und zu anderen im Viertel auch. Elijah hatte sie auch noch nie betrunken gesehen, und er wettete, dass sie Moppe auch einen zweiten Pullover gekauft hatte.
Er ging weiter über den Parkplatz und vorbei an seiner Schule, am Theater, am Markt mit der Frittenbude.
Hinter sich hörte er ihre Stimme.
„Eli, hey, warte. Warte auf mich. Eli!“
Ihre helle, weiche Stimme. Unverkennbar. Einzigartig geradezu. Und nur eine nannte ihn Eli. Nur eine Einzige. Sein Herz raste, noch bevor er sich umgedreht hatte.
„Hey, Layla. Wo ist Tschako?“ Er lächelte Layla an.
Sie trug ihre langen und beinahe schwarzen Haare offen wie immer, und wie immer hatte sie ihre Lieblingsjacke an, die ihr so phantastisch stand. Ein dunkelblauer Seidenblouson mit Schulterpolstern. Sie sah aus wie ein Fernsehstar. In der Hand hielt sie einen Regenschirm, so dunkelblau wie ihre Jacke.
Ihr Lächeln verschwand. „Was fragst du nach ihm?“
Tschako und Layla waren ein Paar, jeder im Viertel wusste das. Und keiner wagte, Layla auch nur anzusehen oder mit ihr zu sprechen, geschweige sie anzulächeln. Keiner, außer Elijah.
Elijah spannte niemandem die Freundin aus, so etwas tat er nicht. Aber wenn Layla mit ihm sprach und ihn anlächelte, und sie tat das ab und zu, dann was? Dann sprach er auch mit ihr und lächelte sie an. Tschako war kein Grund unfreundlich zu Layla zu sein.
„Ich dachte nur. Ihr hängt doch immer zusammen rum.“
„Ich häng rum, mit wem ich will.“
„Schon klar. Wo sind Blondie und CC?“
„Blondie ist mit ihren Eltern unterwegs. CC, keine Ahnung. Wo gehst du hin?“
„Kürenz.“ Elijah ging weiter. Layla blieb neben ihm und hielt den Schirm hoch genug auch für ihn.
„Kürenz? Was willst du da? Das ist weit, willst du da zu Fuß hin?“
„Lass mich.“ Elijah nahm ihr den Schirm aus der Hand. „Wenn Tschako oder einer der anderen uns sieht, dann bekommst du Ärger“, sagte er.
„Du meinst wohl, du bekommst Ärger. Was willst du in Kürenz?“
Elijah sagte, „Ich gucke mir da eine Wohnung an“, und konnte nicht verhindern, dass sich in seinem Gesicht ein Lächeln ausbreitete. „Wenn alles gut läuft, wohne ich ab heute da.“
„Du ziehst weg? Echt jetzt?“ Und als er nickte, „Darüber freust du dich ja gewaltig, so, wie du grinst.“
Elijah korrigierte sie nicht. Er freute sich gewaltig auf Kürenz, auf die Chance, keine Frage. Die Chance, endlich sein eigenes Leben zu beginnen.
Aber der Grund für sein Lächeln war ein anderer. Er lächelte, weil Layla sich bei ihm eingehängt hatte. Sie gingen Arm in Arm, und es fühlte sich großartig an. Als sollte es genau so sein.
Und jetzt sagte sie auch noch, „Kann ich mitkommen?“
6
Elijah zeigte dem Wärter seinen Ausweis und passierte die Schleuse und legte Telefon und Dienstwaffe in die Stahlkassette und zeigte erneut seinen Ausweis, dieses Mal einer Frau in der gleichen beigen Uniform, die bei ihr jedoch Falten warf, so schlank war sie, zierlich geradezu. Sie sagte, ihr Name wäre d’Antonio.
Sie gingen nebeneinander lange Gänge mit vergitterten Fenstern rechts und offen stehenden Eisentüren links. Die Türen führten in schmale Zellen, jede Zelle mit Fenster, ebenfalls vergittert. Elijah sah Männer auf Pritschen liegen und an Tischen sitzen, einer machte Liegestütze, ein anderer lehnte an der Wand und starrte auf den Boden. Die Luft war heiß und stickig. Die Schlüssel in d’Antonios Hand schlugen gegeneinander.
Elijah guckte von der Seite hinunter auf ihren dichten, schwarzen Schopf.
„Seit wann ist Snydr hier?“
Es hatte ihn zehn Minuten gekostet herauszufinden, dass Georg Michael Snydr kein gewöhnlicher Gefangener war. Snydr war ein ehemaliger Polizist. Und auch kein gewöhnlicher Polizist, keiner, der sein Leben lang Dienst auf der Straße geschoben oder in irgendeinem Büro die verstaubten Papierakten der vergangenen Jahrzehnte in einen Computer übertragen hatte. Nein. Georg Michael Snydr war Kommissariatsleiter a.D. bei der Trierer Kripo. Todesermittlungen, Vermisste, Brände, Kriminaldauerdienst.
Snydr hatte etwas gesehen in seinem Leben.
Seitdem Elijah das wusste, machte er sich Gedanken.
Was aber Snydr angestellt hatte, um hier zu landen, und seit wann er hier war, konnte Elijah in der kurzen Zeit nicht herausfinden.
„Vierzehn Tage. Sie kennen Snydr gut?“
Elijah schüttelte den Kopf.
„Aber Sie wissen, was Snydr von Beruf war?“
„Kollege. Kripo.“
Sie nickte. „Die sind hier nicht besonders beliebt. Und Snydr ist nicht mehr der Neueste. Fast siebzig. Noch ganz gut in Schuss, aber trotzdem fast siebzig. Mit den Typen hier kann er nicht mithalten. War zuerst in einem Haftraum mit einem Ami. Ex-Marine, der Typ, und gewalttätig. Einer unsrer Sonderfälle. Danach hat Snydr zehn Tage auf der Krankenstation gelegen.“
„Zehn Tage?“
„Sie werden ihn ja eh jetzt sehen, da kann ichs auch sagen. Wangenknochen rechts angebrochen und Schnittwunde quer über dem Brustkorb. Nicht sehr tief, aber zwanzig Stiche dann doch. Nevada behauptet, Snydr hätte das Messer reingeschmuggelt.“
„Nevada?“
„Der Ami. Ich tendiere dazu, ihm das zu glauben. Nevada braucht kein Messer für einen alten Mann wie Snydr. Was wollen Sie von ihm? Snydr?“
„Kann ich nicht drüber reden, Frau d‘Antonio.“
Sie nickte. „Hier lang.“
Sie führte Elijah in einen Raum mit hoher Decke und einem Dutzend Bänken und Tischen im Boden verankert. Auch hier, keine Überraschung, waren die Fenster vergittert.
„Unser Besuchsraum. Wir haben Regeln, wie lange die Besucher mit den Gefangenen zusammen sein dürfen. Nämlich eine Stunde. Gilt natürlich nicht für Sie. Aber die anderen Regeln schon.“
„Ich weiß.“
„Mir klar, dass Sie das wissen. Ich muss es trotzdem sagen.“
„Ich weiß.“
„Kein Körperkontakt. Der Gefangene darf Ihnen nichts geben und Sie dürfen ihm nichts geben. Sollten Sie doch etwas geben oder von Snydr nehmen wollen, müssen wir das zuerst kontrollieren. Zu dem Zweck werden wir Sie von draußen beobachten.“
Sie sprach ernst und, ohne Zweifel, meinte es.
Elijah nickte.
„Wir haben immer mal wieder Probleme während der Besuchszeit. Also mit wir, da meine ich die JVAs. Bundesweit. Schlägereien bis zum Totschlag, Vergewaltigung, Geiselnahme. Alles während der Besuchszeit. Ist selten vorhersehbar, die Kollegen können schließlich nicht in die Köpfe von denen gucken. Sind monatelang oder sogar jahrelang total brav, sind freundlich zu dir, tun, was du ihnen sagst, dann plötzlich flippen die aus.“
„Die Kollegen?“
D‘Antonio guckte ihn an und sah ihn lächeln und zog trotzdem eine Augenbraue hoch, schwarz und dicht wie die Haare auf ihrem Kopf. „Die Gefangenen. Wir sind hier also strikt. Sehr strikt.“
„Ich werde Snydr weder totschlagen, noch vergewaltigen. Und er ganz sicher nicht mich.“
„Dann is gut. Setzen Sie sich. Wohin Sie wollen, Sie haben ja freie Auswahl, die nächsten Besucher kommen erst um viertel nach eins. Gegen die Hitze kann ich nicht viel machen, die Fenster stehen auf Kippe, mehr ist nicht drin. In den Hafträumen sind die Decken niedriger, da ist es schlimmer. Ich hole Snydr. Wenn Sie fertig sind, heben Sie einfach die Hand. Ich komme dann rein und bringe Snydr zurück und hole danach Sie ab und bringe Sie wieder nach draußen.“
Elijah sagte, „Sagen Sie, bekommen Sie ab und zu Probleme hier? Mit den Kerlen? Also, den Gefangenen?“
Wieder zuckte ihre Augenbraue nach oben. „Manchmal mit den Besuchern. Aber das hab ich im Griff. Ich hole Snydr.“
Elijah setzte sich, zog seinen Hut aus und legte ihn neben sich auf den Tisch und wartete. Eine Schweißperle lief ihm den Rücken hinunter.
Fünf Minuten, dann kam d’Antonio mit einem Mann in ausgebeulten Jeans und weitem Hemd zurück. Da, wo das Hemd nicht durchgeschwitzt war, war es hellblau.
„Herr Snydr, das hier ist der Herr Leblanc vom BKA. Sie haben ihn ja um den Besuch gebeten. Sie sitzen gegenüber.“
Sie wartete, bis Snydr saß. Snydr legte seine Hände auf den Tisch. Die Handschellen klackten auf dem harten Lack.
„Die kann ich Ihnen nicht abmachen, nicht nach der Aktion im Haftraum, Snydr. Regeln sind Regeln. Die gelten auch für Sie.“
Snydr sah sie ausdruckslos an und nickte.
„Sie heben den Arm, wenn Sie fertig sind, Herr Leblanc. Ich komme dann rein.“
Elijah nickte mit einem Lächeln, das unerwidert blieb, wartete einen Moment, bis sie draußen war, und guckte dann auf den Mann.
Der Mann mochte an die siebzig sein mit den tiefen Falten auf Stirn und Wangen und den weißen Stoppeln und den ebenso weißen Haaren an den Seiten und obendrauf kahl, und er mochte erst vor zehn Tagen einen Schlag ins Gesicht erhalten haben oder zwei. Die rechte Gesichtshälfte war dunkel verfärbt, über dem aufgeplatzten Wangenknochen klebten zwei Klammerpflastern, im rechten Winkel zum Cut angebracht. Und jemand mochte ihm auch einen Schnitt über der Brust zugefügt haben, durch das Hemd sah Elijah einen Verband.
Der Mann mochte auch Snydr heißen, Georg Michael Snydr, und pensionierter Polizist sein.
Aber Elijah war sich sicher: er hatte diesen Mann nie zuvor gesehen und nie zuvor von ihm gehört.
„Georg Michael Snydr“, sagte Elijah. „Ich kenne Sie nicht.“
„Und doch bist du hier, Leblanc.“
Die Stimme rau und tief; tiefer, als Elijah bei der Körpergröße vermutet hätte.
„Ich habe viel Zeit, Snydr. Und ich mache gerne mal einen Ausflug nach Trier. Schöne Stadt. Besonders bei so einem Wetter. Vorhin hats ja noch geregnet, aber jetzt wieder die Sonne?“ Elijah nickte nach draußen und lächelte dann sein Cop-Lächeln. Unfreundlich, arrogant, überlegen. „Aber damit wir uns hier richtig verstehen: Ich habe zwar viel Zeit, aber nicht so viel Geduld. Also kommen Sie am besten gleich zum Punkt. Und mit gleich meine ich sofort.“
„Hör auf mit den Grimassen, Leblanc. Du hast dich über mich erkundigt. Du weißt, wer ich bin. Was ich gemacht hab in meinem Leben. Ich kenne alle Tricks. Jeden. Manche hab ich selbst erfunden.“ Snydr beugte den Kopf und wischte die linke Gesichtshälfte an seinem Oberarm und tupfte dann auch vorsichtig über die rechte Wange. Er betrachtete seinen Ärmel, genau wie Elijah. Kein Blut. „Ob draußen die Sonne scheint und es hier drin vierzig Grad hat und nach Pisse stinkt, ist mir scheißegal. Und glaub mir, ich hab auch keine Geduld mit dir. Mit niemandem, wenn du es genau wissen willst.“
„Zum Beispiel nicht mit Nevada, habe ich gehört.“
„Nevada.“ Snydr lachte kurz und trocken. „Die Vianne hat vorhin angerufen. Ihr hast du auch gesagt, du würdest mich nicht kennen.“
„Sie haben Telefon in Ihrer Zelle?“
„Aber das Datum hätte ... Wie sagt sie? Einen gewissen Eindruck bei dir gemacht. Du wärst still gewesen.“
„Warum genau duzen Sie mich, Snydr?“
„Weil ich dich kenne, Leblanc. Von früher. Elijah Leblanc, Sohn des stadtbekannten Gulli Leblanc.“
Elijah guckte.
„Von deinen Akten bei uns.“
„Die Trierer Kripo hat keine Akten über mich.“
„Heute nicht mehr, stimmt. Damals aber schon.“
Elijah atmete aus. „Kleinkram, Snydr.“
Snydr nickte. „Frisiertes Moped und nicht angemeldet, kein Führerschein und zwei Bier intus. Ne ... Kreidler.“
„Zündapp. Und ein Bier, nicht zwei.“
„Zündapp?“
„GTS 50. Und es war nicht meins.“
„Ja, kann auch sein. Zündapp. Die einen Kreidler, die anderen Zündapp, so war das damals bei euch. Lange her.“
Elijah war still. Sein Gesicht so ausdruckslos wie das von Snydr.
„Dann Auto aufgeknackt und Radio geklaut. Danach der erste richtige Bruch, ein Reihenhaus oben auf Maria-“
„Hatte ich nichts mit zu tun. Nichts mit dem Auto und nichts mit dem Haus.“
„-Mariahof. Nicht direkt, stimmt. Aber indirekt. Das waren die vier Jungs, die das gemacht haben. Aber du warst mit denen befreundet, Leblanc. Deine Clique. Und wir-“
„Nicht meine Clique, Snydr. Sie phantasieren sich da was zusammen.“
„Deine Freunde. Und wir haben immer-“
„Auch nicht meine Freunde, Snydr. Ich kannte die. Die kannten mich. Weil wir Nachbarskinder waren, im selben Viertel wohnten. Wofür ich nichts konnte. Ich habe mir die Gegend nicht ausgesucht.“
„Nachbarn, Freunde, Clique, hat für uns keine Bedeutung. Die Vier waren Kundschaft, du kamst daher auch in unser Visier. Deshalb hattest du nicht nur deine eigene Akte, zugegebenermaßen ne kleine Akte. Sondern dein Name stand auch in den vier Akten deiner vier ... meinethalben Nachbarn.“ Er sagte, „Bist dann ja selbst ein Polizist geworden. Hat mich gewundert, als ich das gehört hab, ehrlich, sehr. Der Sohn vom Gulli beim BKA. Die meisten von deinem Schlag und aus deiner ... Nachbarschaft, die wandern ja eher in die entgegengesetzte Richtung.“
„Sie meinen in Richtung Gottbillstraße, so wie Sie, Snydr?“
„Ich bleib nicht lange.“
„Aha. Und warum nicht?“
Snydr antwortete nicht.
„Frisiertes Moped, geliehen, nicht gestohlen, kein Führerschein und ein Bier. Große Sache, Snydr.“
„Was macht dein alter Herr eigentlich? Gulli? Ewige Jagdgründe? Oder weilt er noch unter den Saufenden?“
Elijah sagte, „Meine Geduld geht zu Ende.“
„Der 19. März 83 war ein Samstag.“
„Wow, Sie kennen den Kalender auswendig.“
„Am Morgen wars noch trocken, später hats geregnet. Schauer. Heftig. Es war kühl, so um die sechs Grad.“
„Und das Wetter kennen Sie auch. Ich bin beeindruckt. Wie war das Wetter am 1. Dezember 1970?“
„1. Dezember 1970? Was war am 1. Dezember 1970?“
Elijah antwortete nicht. Snydr sah nicht aus, als würde er sich für die Musik von Clapton interessieren.
Snydr sagte, „Das Wetter spielte eine Rolle am 19. März 83. Der Regen. Eine Rolle für dich, Leblanc.“
Als ob er das nicht wüsste.
Aber woher wusste Snydr das?
„Sie werden etwas für mich tun, Leblanc.“
„Jetzt plötzlich Sie?“
Snydr lächelte. Zum ersten Mal. Aber es sah nicht sehr freundlich aus. Die rechte Gesichtshälfte wollte nicht so recht mitlächeln.
„Ich bin nicht der Typ, der anderen einen Gefallen tut. Fremden zumal. Und Sie sollten das mit dem Lächeln sein lassen, Snydr, sonst platzen Ihnen die Pflaster weg und der Cut springt wieder auf.“
„Soll er aufspringen. Kein Gefallen, Leblanc. Sie fahren jetzt zu der Vianne. Die wartet auf Sie. Die Vianne wird Ihnen eine Akte geben, die werden Sie sich anschauen. Sie sind Polizist, sogar ganz brauchbar, was man so hört. Sie schauen sich die Akte an, wie ein brauchbarer Polizist jeden neuen Fall anschaut. Frisch. Unvoreingenommen. Hungrig. Dann kommen Sie wieder her und sagen mir Ihre Meinung.“
„Meine Meinung zu was?“
„Zu dem, was Sie gelesen haben.“
„Was werde ich lesen?“
„Sie werden sehen.“
„Ich bin nicht der Typ, der anderen einen Gefallen tut“, sagte Elijah wieder.
„Sie werden das für mich tun, Leblanc.“
Der Ex-Polizist Snydr. Ruhig und selbstsicher, überlegen geradezu mit dem leichten Grinsen, das noch um seine Augen lag.
Wie viel wusste Snydr vom 19. März 1983?
Elijah lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.
„Und falls nicht?“
„Tja, Leblanc, dann wird noch heute meine Anwältin dein BKA informieren, und deine eigenen Kollegen werden dich abholen und dein verlogenes Leben da draußen in Freiheit ist zu Ende.“
7
Elijah hob den Arm, und d‘Antonio kam herein und führte Snydr ab. Snydr hatte kein Wort mehr gesprochen. Elijah auch nicht.
D’Antonio kam zurück und sagte, „Ich bringe Sie nach draußen.“
Zusammen gingen sie dieselben Gänge zurück, die sie gekommen waren. Immer noch standen Türen offen, immer noch lagen Männer auf den Pritschen und saßen an Tischen. Der an der Wand gelehnt hatte, lag auf dem Boden und starrte gegen die Decke. Der vorher Liegestütz gemacht hatte, stand jetzt vor dem Fenster und machte Kniebeugen. Zu viel Energie. Oder zu viel Hass. Die Luft war immer noch heiß und stickig. Die Schlüssel in d’Antonios Hand schlugen wieder gegeneinander.
Draußen blieben sie stehen. Elijah lehnte sich gegen sein Auto und setzte den Hut auf. D’Antonio streckte ihr Gesicht in die Sonne und atmete tief ein.
„Auf der Herfahrt hat es noch geregnet“, sagte Elijah.
„Ja, hier auch heute Morgen, aber nur ein paar Tropfen. Wir brauchen Regen, dringend. Die Felder sind staubtrocken. Ich wohne auf dem Dorf. Die Bauern da sagen, die Getreideernte wird dieses Jahr eine Katastrophe. Ich esse ja kaum Getreide, aber trotzdem. Für die Bauern tuts mir leid.“ Sie guckte. „Ist die Karosserie nicht zu heiß zum dagegen Lehnen?“
Elijah schüttelte den Kopf. „Sagen Sie, Snydr, was hat der angestellt?“
„Das wissen Sie nicht?“
„Ich hatte keine Zeit für Erkundigungen. Kann aber nicht viel sein, Sie haben hier ja nur die Untersuchungshäftlinge und die weniger als zwei Jahre bekommen. Snydr hat gesagt, er bliebe nicht lange.“
„Da hat Snydr wohl Recht.“ Sie sagte, „Zechprellerei.“
„Zechprellerei? Snydr hat die Zeche geprellt?“
„Hier mal ein Bier, da mal ne Currywurst, ne Pizza. Kennen Sie die Frittenbude hinter der Porta? Porta Nigra? Kennen Sie die Porta Nigra, das Trierer Wahrzeichen? Die ist von hier aus hinter-“
„Ich stamme aus Trier“, sagte Elijah, „ich kenne die Porta.“
„Ah ja? Also, die Frittenbude hinter der Porta, drei Mal hat er da Currywurst bestellt, drei Mal hat er nicht bezahlt. Ist nicht weggelaufen, sondern hat einfach nicht bezahlt und gewartet, bis seine Kollegen kamen. Ex-Kollegen. Genauso in mehreren Pizzerien. Wurde jedes Mal angezeigt, hat aber nicht damit aufgehört. Und die Post von der Staatsanwaltschaft hat er auch ignoriert. Kam schließlich vor den Kadi.“
„Aber trotzdem, wieso ist er dann hier? Der Richter hat ihn ermahnt und ihm eine Geldstrafe aufgebrummt und fertig.“
„Zweitausend Euro.“
Elijah nickte. Er verstand. „Die hat Snydr also auch nicht bezahlt?“
„Sonst wäre er nicht hier.“
„Wie lange wird er sitzen?“
„Jetzt noch fünfzig Tage.“ D’Antonio lachte und schüttelte den Kopf. „Hat eine Geldstrafe von zweitausend Euro bekommen, bezahlt die aber nicht und wählt stattdessen Ersatzfreiheitsstrafe. Verrückt, nicht? Der ist als Kommissariatsleiter in Pension gegangen, der bezahlt zweitausend Euro wie nix. Und‘n Bier und ne Currywurst und ne blöde Pizza sowieso. Geht aber stattdessen lieber in den Knast, wo garantiert ist, dass er auf Bekannte trifft.“
„Und der Amerikaner“, sagte Elijah, „dieser Marine. Nevada. Warum sitzt der hier und nicht bei seinen eigenen Leuten? Dafür haben die doch ihre Militärgefängnisse.“
„Als der hierher kam, war der kein Marine mehr. Schon lange nicht mehr. Ist ja mittlerweile auch schon älter. Hält sich aber immer noch für einen Marine, einmal Marine, immer Marine und so. War lange in Deutschland stationiert, hat wohl auch eine deutsche Mutter, deshalb spricht er unsere Sprache. Bei dem dreht sich das ganze Leben um Drogen. Vor allen Dingen Handel, weniger Konsum. Das auch, aber weniger. Hat dann in seiner Heimat mehrfach gesessen, zuletzt war er wieder in Freiheit, hat aber die Freiheit falsch genutzt und jemandem im Streit ein Auge rausgeschlagen und ihm anschließend das Genick gebrochen. Chicago, glaub ich, es ging jedenfalls wieder um Drogen. Wurde wegen Mordes per Haftbefehl gesucht, und weil ihm da drüben mit all den Vorstrafen jetzt hundert Jahre Knast winken, hat er sich dann nach hier abgesetzt. Ist dann aber in irgendeinem Puff in der Stadt in eine Schlägerei gekommen. Die Kollegen von der Polizei mussten anrücken und haben auf der Wache gemerkt, wer ihnen ins Netz gegangen ist. Pech. Der wird noch eine kleine Weile hier bleiben und dann ausgeliefert. Und irgendwann drüben in einem Gefängnis sterben.“
„Umso verwunderlicher, dass ihr jemanden wie Snydr mit seinen zweitausend Euro und fünfzig Tagen zu diesem genickbrechenden Nevada steckt, auf den hundert Jahre warten.“
„Wird bereits untersucht.“ Sie schüttelte den Kopf. „Weiß der Teufel, wer das verbockt hat. Unsre Chefin ist so was von sauer darüber, die hat richtig getobt. Weil Nevada schon ein besonderer Problemfall ist, das wussten wir ja alle, und wir haben auch Platz, andere Zelle wär kein Problem gewesen. Der Blödmann, dem das durchgerutscht ist, der kriegt einen auf den Deckel.“
„Weshalb ist Nevada denn gerade hierher gekommen? Nach Trier, meine ich. Von Chicago nach Trier, nicht gerade eine vielbereiste Route. Hat er hier Verwandte oder Bekannte?“
„Kann ich nicht sagen. Also, weiß ich nicht. Aber er war mal oben in der Eifel stationiert, Spangdahlem. Vielleicht deshalb. Ich denke, er kannte die Gegend.“
„Für solche Leute wie den Nevada, da habt ihr doch hier besondere Räumlichkeiten.“
D’Antonio sah Elijah an. „Und?“
„Einzelzelle, Videoüberwachung.“
„Ausgefallen.“
„Die Videoüberwachung?“
Sie nickte. „Wird auch untersucht. Aber das ist nichts Besonderes. Technik, da gibts immer mal Probleme.“
„Lassen Sie mich raten: die Technik ist genau vor vierzehn Tagen ausgefallen. Als Snydr hierher kam, zu Nevada in die Zelle, wo er eigentlich nie hätte hinkommen dürfen.“
„Wir sagen Haftraum, nicht Zelle“, sagte sie und streckte ihr Gesicht wieder in die Sonne.
Elijah sagte, „Ich frage mich, ob das hier wirklich jemandem durchrutschen kann. Snydr zu diesem Genickbrecher Nevada. Was ich gerade gesehen habe, folgen Sie strikt den Regeln.“
Sie drehte den Kopf zu ihm und machte wieder diese Sache mit ihrer Augenbraue. „Was meinen Sie?“
Elijah wartete.
„Meinen Sie, dass jemand den Snydr absichtlich zu Nevada gesteckt hat?“
„Wäre das möglich?“
Sie überlegte. „Möglich ist alles“, sagte sie. „Aber dann müsste es einen Grund dafür geben.“
Elijah tippte an seinen Hut. „Ganz genau.“
Er stieg ein und startete den Motor.
D`Antonio klopfte gegen das Fenster.
Elijah drückte den Knopf, die Scheibe quietschte herunter.
„Was ich Sie fragen wollte, Leblanc. Warum tragen Sie den Hut?“
Elijah lächelte. „Weil er passt.“
Elijah musste Richtung Innenstadt, mied aber den westlichen Stadtteil und bog stattdessen rechts ab über die Brücke. Er warf einen Blick hinunter auf die Mosel. Der Fluss hatte sich tief in sein Bett zurückgezogen. D’Antonio hatte Recht, es wurde Zeit, dass es mal wieder regnete. Aber der Himmel über ihm war ohne Wolken.
Sein Telefon zeigte zwei entgangene Anrufe. Er hörte die Nachrichten ab, beide von Barbara. In der ersten sagte sie, er sollte sich dringend bei der Personalabteilung melden, wegen seiner neuen Einstufung, und es würde ihr leid tun wegen heute Morgen, dass sie so grantig war, ihr Rücken wieder, sie wüsste da nicht mehr weiter und ihr Arzt auch nicht. In der zweiten, zehn Minuten später, die Sache mit der Personalabteilung hätte sich erledigt, ob bei ihm denn alles in Ordnung wäre?
Barbara war eine Gute.
Sein bislang letzter Besuch in Trier war schon eine Weile her, aber das beklemmende Gefühl aus seiner Jugend war bereits zurück. Das Gefühl, möglichst schnell aus der Stadt verschwinden zu müssen.
Er ließ auch die anderen Fenster herunter und atmete tief die heiße Luft ein, bis es in seiner Lunge brannte.
Der Mann hielt so viel Abstand, dass er gerade noch das Kennzeichen lesen konnte.
Eine Berliner Nummer.
Ungewöhnlich. Was machte ein Cowboy aus Berlin in einer JVA in der Provinz? Bei einem Ex-Polizisten, der es ganz offensichtlich darauf angelegt hatte, dorthin zu kommen?
Der Mann fuhr langsamer und nahm sein Notizbuch hervor und schlug es auf. Blätterte, bis er den Namen fand und wählte die Nummer. Er plauderte ein wenig über alte Zeiten und bat um einen Gefallen. Dann las er das Kennzeichen vor.
Kaum zwei Kilometer später wurde er zurückgerufen. Hoppla, Brandner, in was bist du denn da verwickelt?
Wieso?
Das Kennzeichen, mein Freund, ist nicht registriert. Jede weitere Suche wird blockiert. Du weißt, was das heißt.
Der Mann mit Namen Brandner guckte auf den Geländewagen und sagte Danke und legte auf.
An der nächsten Kreuzung ließ er das Cabrio mit den zwei winkenden jungen Frauen einscheren und das Taxi auch noch und sogar noch den schwarzen Van eines Bestattungsinstituts.
Besser Abstand halten.
In der Entfernung war der silberglänzende Wagen immer noch gut zu sehen.
Seine Hand tastete nach dem Briefumschlag in der Konsole neben ihm. Weich, dick. Dreitausend Euro in bar.
Mann, in was bist du da verwickelt?
8
„Glückwunsch, Elijah, du bekommst also die Wohnung. Freut mich sehr, mein Junge, ehrlich. Die Frau Rommelfanger mag dich, wie es aussieht. Hab ich auch nicht anders erwartet. Enttäusche sie also nicht. Hat dir eben sogar das Bett frisch bezogen, das ist alles andere als selbstverständlich.“
Elijah nickte.
Adams‘ Worte hallten durch das Treppenhaus.
„Du musst nur mal deine Klamotten wechseln, so nass, wie die sind, die riechen.“
„Ich weiß.“
„Das sind jetzt deine.“ Adams hielt einen Bund mit drei Schlüsseln hoch. „Der hier ist für die Eingangstür unten, der dicke ist der Kellerschlüssel, und der hier ist für deine Haustür.“ Er hielt Elijah den Bund hin. „Du solltest deine Haustür jetzt absperren.“
Sie standen vor der Tür zu seiner Wohnung, seine Vermieterin war wieder das Geländer entlang nach unten gehumpelt zu ihrer eigenen Wohnung. Eine sehr nette Frau, die Frau Rommelfanger, sie hatte mit Elijah gesprochen, sich die Hände an der Kittelschürze abgewischt und sich dann gestreckt und ihm die Wange getätschelt und gesagt, Ja, der Junge kann hier wohnen.
Elijah lächelte. Du solltest deine Haustür jetzt absperren.
Er steckte den Schlüssel in die Tür und drehte zweimal nach rechts und zog den Schlüssel ab und steckte den Bund in die Hosentasche.
Es fühlte sich gut an. Sein eigener Haustürschlüssel zu seiner eigenen Wohnung.
Er hatte es geschafft.
Zwei Monate zuvor erst war er wieder einmal beim Jugendamt gewesen und hatte erstaunt geguckt, als er die Tür zu der Schneider aufmachte und einen Kerl auf ihrem Platz sitzen sah, kaum zehn Jahre älter als er selbst.
„Komm rein, keine Angst, komm.“
Elijah hatte gegrüßt und seinen Namen genannt und gefragt, wo denn die Frau Schneider wäre.
„Andere Abteilung. Ich bin jetzt für dich zuständig. Ich heiße Peter. Adams. Mach die Tür zu, Elijah. Ich hab schon von dir gehört.“
Adams hatte ihm dann erklärt, dass er ihm helfen wollte, er wüsste von seinen Eltern, von den Aufenthalten im Heim, und Elijah könnte Peter zu ihm sagen.
„Warum bist du denn heute hier?“
Elijah hatte sich gesetzt und gesagt, er würde ja jetzt bei seinen Eltern wohnen, aber er wollte wieder zurück ins Heim, bitte. Und er würde lieber weiter Herr Adams zu ihm sagen.
Adams hatte ihn angeguckt.
Adams hatte sich dann zwei Stunden mit ihm unterhalten, eine Stunde mehr als die Schneider in den vergangenen zwei Jahren.
Ja, und nun standen sie hier, und Elijah hielt den Schlüssel zu seiner eigenen kleinen Wohnung in der Hand.
„Verlier die Schlüssel nicht. Die nachzumachen, kostet viel Geld. Und keine Sache mehr wie neulich mit dem Moped. Hast du mich verstanden? Ohne Führerschein fahren, Moped nicht angemeldet, und ein Bier hattest du auch noch drin. Das mag für dich ein Scherz gewesen sein, aber so fangen Karrieren an. Lass dir das gesagt sein von mir, wie oft hab ich gesehen, dass Jungs so anfangen und dann kommen Schlägereien dazu und mehr Alkohol und Diebstahl, der erste Bruch und Raub, und dann gehts schnurstracks in die Gottbillstraße.“
Elijah war still.
„Die JVA ist in der Gottbillstraße, Elijah.“
„Das weiß ich, Herr Adams.“
„Weißt du auch, dass das hier deine Chance ist? Deine Riesen- und vielleicht deine einzige Chance auf ein anderes Leben? Du bist schlau, du bist fleißig, das sagen alle deine Lehrer, und ich weiß das auch. Und du bist ein guter Kerl, auch das weiß ich, sonst wären wir jetzt nämlich nicht hier. Du musst nur von deinem Viertel wegbleiben, deinen Freunden dort-“
„Ich habe keine Freunde dort, Herr Adams. Da sind ein paar Jungs, aber mit denen hab ich nicht viel zu tun.“
„Ihr werdet gelegentlich zusammen gesehen.“
„Zufall.“
„Dass ihr zusammen gesehen werdet? Mag sein, aber-“
„Nein, Zufall, wenn ich mit denen zusammen bin, Herr Adams. Wir laufen uns gelegentlich über den Weg, mehr nicht. Glauben Sie mir, ich würde das gerne vermeiden.“
„Das kannst du ab jetzt. Hierher kommen die nicht. Das ist ein gutes Viertel, weit genug von denen weg. Hast du noch einmal mit deinem Vater und deiner Mutter gesprochen?“
Elijah nickte. „Heute Morgen. Sie wissen Bescheid.“
Elijah war ins Wohnzimmer gegangen, wo sie beide in den Sesseln lagen, der Tisch voll mit Flaschen Bier und Apfelschnaps und klebrigen Rändern auf der Platte, die Aschenbecher quellten über. Die Luft war grau vom Zigarettenqualm, der Fernseher lief ohne Ton, ein Sexvideo auf dem neuen Videorekorder, und Elijah hatte sich vor den Fernseher gestellt und gesagt, dass er ausziehen würde. Seine Mutter hatte gelallt, warum er sich denn ausziehen wollte, was sollte das denn jetzt, das wäre doch unanständig, er wäre doch ein anständiger Junge. Er sagte, er würde aus der Wohnung ausziehen, er würde von hier wegziehen, und er würde jetzt gehen, jetzt. Gulli hatte dann geflucht und ihn beschimpft, wie er das immer tat, als Hurensohn und Nichtsnutz und Penner, aus dem nie etwas werden würde, und er würde sich noch umgucken. Dann hatte Gulli eine Flasche Bier nach ihm geworfen, aber Elijah machte einen Schritt zur Seite und die Flasche war gegen die Wand geknallt, ohne kaputt zu gehen. Die Mutter hatte die Arme nach Elijah ausgestreckt, aber er war stehen geblieben, da hatte sie angefangen zu weinen, still, in sich hinein, und dann die Beine angezogen und gerülpst und zu jammern angefangen, wie es ihre Art war. Sie wusste, dass Gulli das nicht mochte, dass es ihn aufbrachte, und Elijah wusste es auch, und es kam, wie es immer kam, Gulli schob sich aus dem Sessel, und Elijah sah erst jetzt, dass Gullis Hose offen stand und sein Schwanz herauslugte; Gulli sprang hinüber und riss der Mutter an den Haaren und knallte ihr erst eine, die sie mit den Armen abwehren konnte, dann noch eine, mit dem Handrücken, eine weit ausholende Bewegung, die sie mitten ins Gesicht traf. Gulli war dann getorkelt und auf sie gefallen.
Elijah war hin und hatte Gulli weggerissen und am Kragen festgehalten, auf Armeslänge, und ihn angesehen, ihn, dem der Hass aus den wässrigen Augen schoss und dem unten immer noch was aus der Hose rauslugte und der ihn anschrie, „Wat, du Penner, wat willste, hä? Du wirst dich noch umgucken.“ Elijah konnte die Spucke zwischen den gelben Zähnen sehen.
Elijah hatte ihm eine Ohrfeige verpasst, auch mit dem Handrücken, auch mitten ins Gesicht, und Gulli war mitsamt seinem Geifer und seinem Hass und seiner offenen Hose auf den Boden gerutscht und liegen geblieben.
Elijah hatte sich dann umgedreht, seine Tasche genommen mit allem, was er besaß, und war gegangen. Er konnte nicht mehr für seine Mutter tun.
Adams sagte, „Du hast mit beiden gesprochen?“
Elijah nickte. „Wir haben alles geklärt.“