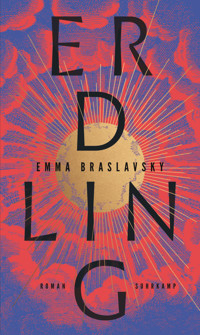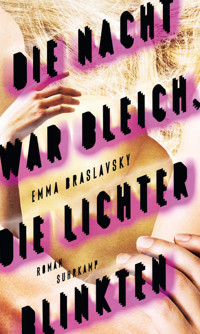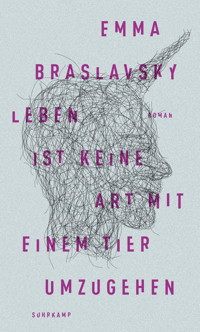
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine gute Geschichte braucht ein Opfer. Eines am Anfang und eines am Ende.« Bessere Menschen. Falsche Tiere. Aussteiger im Paradies. Die einen wollen die Natur retten, den Planeten, die Menschheit. Die anderen nur sich selbst: vor Spielschulden, Ehekrächen, Einsamkeit. In »Leben ist keine Art mit einem Tier umzugehen« erzählt Emma Braslavsky ein großes, packendes Abenteuer – über Fluch und Segen des Menschseins, über unsere Suche nach Erkenntnis und Wahrhaftigkeit. Und nie weiß man, ob man aus Verzweiflung lacht oder vor Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sie lesen: eine große satirische Liebesgeschichte und ein tragikomisches Menschheitspanorama. Die Beteiligten: Jo, eine selbstsüchtige Enddreißigerin, zelebriert die schillernde Fassade einer Möchtegern-Weltverbesserin und lebt vom Geld ihres Mannes; Jivan, ein latent chauvinistischer Mittvierziger, heuchelt als selbstzufriedener Sexist den Feministen, manipuliert seine Frau nach Belieben und wird dabei selbst ahnungsloses Opfer seines Vaters und seiner feigen Selbsttäuschungen. Die blutjunge Roana wird von ihrem Vater nach Südamerika zum einsamsten Vulkan dieser Erde geschickt, damit sie endlich zur Vernunft kommt. Sie macht sich stattdessen auf zu einer gewagten Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Aussteiger No flüchtet mit seiner Freundin Jule vor der Zivilisation in eine abgeschiedene Festlandbucht und versucht mir ihr das Leben im Paradies. Und eine unberührte, staatenlose Insel, die von einem Orkan freigelegt wird, sorgt als vermeintliche neue Welt interna-tional für Schlagzeilen und Hysterie. Das sagenhafte Finale: Nicht alle überleben, aber es gibt Hoffnung.
Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen ist ein Abenteuerroman über Fluch und Segen des Menschseins, eine Farce über notorische Lebensoptimierer und ihren Kampf um eine bessere Welt – oder wenigstens eine bessere Insel. Das Buch ist eine große vergnügliche Reise, und es erzählt die berührende Geschichte unserer Suche nach Erkenntnis und Wahrhaftigkeit.
Emma Braslavsky, 1971 in Erfurt geboren, ist seit 1999 als freie Autorin und Kuratorin tätig. Ihr Debütroman Aus dem Sinn wurde 2007 mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis sowie dem Franz-Tumler-Debütpreis ausgezeichnet und war für den Debütpreis des Buddenbrookhauses nominiert. Ihr zweiter Roman, Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik, erschien 2008. Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen ist ihr erstes Buch im Suhrkamp Verlag. Emma Braslavsky lebt in Berlin.
EMMA BRASLAVSKY
LEBEN IST KEINE ART, MIT EINEM TIER UMZUGEHEN
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe:
Erste Auflage 2016
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung und -illustration: Nurten Zeren
eISBN 978-3-518-74789-6
www.suhrkamp.de
Diese Geschichte ist wahr. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind kein Zufall. Sollten Sie sich darin wiedererkennen, nehmen Sie’s sportlich, oder beschweren Sie sich beim lieben Gott.
HANDELNDE PERSONEN
Jivan Haffner Fernández, Bunkerarchitekt und Hauptfigur
Jo (Jeanna) Lewandowski Fridman, Jivans Frau und Bessere-Welt-Aktivistin
Eddie (Ediz), Inhaber einer Halal-zertifizierten Döneria und Jivans Freund
Kim Fischer und Achim Krüger, Chefs von Animal Rights
Lautaro Álvaro Fernández, Jivans Vater
Dr. Louise Horn, Vorsitzende des Institut Instructif pour le Regain de la Nature (IIRN) in Paris und Leiterin weltbekannter Tantra-Workshops
Thilo, Jos Mitstreiter im Tantra-Workshop
Norman Tanner, Kopf von BetterPlanet
Bernard Bernardi, Vorstandsvorsitzender der Sécurité Suisse (SS)
Die Wohn-Nomaden: eine Ex-Ghanaerin, ein Ex-Italiener und andere
Luis Ángel de Portago, Ex-General und engster Freund von Jivans Vater
Benson, Notar und Nachlassverwalter von Jivans Vater
Fritsche, Jivans Bankberater
Lucia Rosa Fernández, demenzkranke Schwester von Jivans Vater
Benicio Álvaro Fernández, Neffe eines Cousins dritten Grades von Jivans Vater
Ralf Wiegand, Chefplaner des Bunkerkomplexes 17/5001
Yoko Ono
Nils Björsson und Katy Delanneaux, Chefs von Life from Zero (LFZ)
Tamara, eine alte Freundin und Kollegin von Jivan
Mister Sands und Mister Katō, Abgesandte eines milliardenschweren Konsortiums für den Kauf des Bunkers 17/5001
Wurm an einem Haken
Frankenstorm Tony, der Orkan
Die neue, staatenlose Insel
Paul Weissmann, Blogger bei n-global
No (Noah) Hoffmann und Freundin Jule, Aussteiger in einer paradiesischen Festlandbucht
Roana Debenham, eine blutjunge Frau und zweite Hauptfigur
Dr. Jan-Erik Peralta, Philosophieprofessor und Kopf der Bewegung »Sei neu! Sei besser! Sei human!«
Werther (Sarah), noch eine blutjunge Frau
Obdachloser im Spiderman-Kostüm
Alyss Löwengart, Rabbinerin und Leiterin des Zentrums für Kabbalastudien in Buenos Aires
Natalie und Jakob Oppenheim, Wissenschaftlerehepaar
Die Bruderschaft der falschen Gorillas: Tristam, Erik, José, Valeri, Thomas, Lee, Nathan, Ben, Siddhartha, Jean-Paul, Leeroy
Edna, Aktivistin bei den Greenguards
Marie und Josef, geklonte Golden Retriever
Veroniká, Gynäkologin
Kapitän der Ocean Queen, des modernsten Schiffs der Welt
Brian, weißblonder Schönling mit geföhntem Seitenscheitel
Newman, der neue Mensch im Embryonalstadium
TEIL 1
JIVAN UND JO
MENSCHEN KÖNNEN QUARK MACHEN, TIERE NICHT.
Jivan Haffner Fernández macht sich immer viele Gedanken beim Warten auf die U-Bahn.
Mit Daumen und Zeigefinger zieht Jivan behutsam ein rötliches Schamhaar vom Hemdärmel und untersucht es im Licht der Abendsonne. Das muss sich heute Morgen dort verfangen haben. Er ist ein Mann, der sehr auf Details achtet, zumindest auf solche, aber er ist auch ein Mann, der stets auf der Hut sein muss, sich nicht selbst ins Verderben zu stürzen. Für jeden Quark gibt’s ’ne App, denkt er, bloß noch keine, die einen Mann vorm Ruin durch die Frau, die er liebt, beschützt. Was ihn seit Beginn seiner Ehe wirklich unter den Nägeln brennt, ist die Suche nach der Antwort auf eine einzige Frage, zu der auch keine der Schöpfungsgeschichten das fehlende Puzzleteil liefern kann: Warum werden Männer mit den Frauen allein gelassen? Warum hat die Natur ihnen keinerlei Beistand gegönnt? Er nennt sich Jivan, mit fauchendem Ch am Anfang. Sie riecht immer nach Honig und Moschus! Sie – ist Jo, seine Frau! Bereits heute Mittag entdeckte Jivan das Haar während des Meetings mit seinem alten Kontakt bei der Sécurité Suisse. Als er die linke Hand hob und sich mit Zeige- und Mittelfinger versonnen über die Stirn fahren wollte, funkelte der kupfrig schimmernde, gekräuselte Hornfaden an der Naht des Ärmels wie die Venus am Nachthimmel. Er atmet einmal tief durch und sichert das Haar tief in der Brusttasche. Er ist ein Mann, für den solche Details wertvoll sind.
Vor ihm breitet sich der Tempelhofer Airgarten aus. Eigentlich hat er es eilig, doch er schlendert über das Rollfeld, als hätte er keine wichtige Verabredung. Unter einer Laterne setzt er sich auf einen Baumstumpf und tauscht mit einem Seufzer seine uralten, bequemen Lieblingstreter aus geschmeidigem Boxcalf gegen tierleidfreies Schuhwerk aus wasserfester Mikrofaser. Er ist auf dem Weg zum Abendessen mit Jo und ihren neuen Chefs von Animal Rights.
Das Blackbird’s Song ist momentan der letzte Schrei in der Stadt in Sachen veganer Küche, die Leute stehen so hartnäckig Schlange, als würde ihnen dort Absolution erteilt. Links und rechts versucht ein schnurgerades Spalier aus blühenden Hyazinthen zwischen blauen Neonlichtern eine streng überwachte Multikulti-Naturschutzpflanzenwelt daran zu hindern, sich auch den Rest des Areals einzuverleiben.
Die Ledersneakers verstaut Jivan im Beutel. Bei der Gelegenheit überprüft er Hemd und Hose. Das hat er Jo versprochen und dann noch einmal »beim Leben seines Vaters« geschworen, dass er es nicht vergisst. Sein dunkelgraues Leinenhemd geht noch als tierlieb durch. Seine Hose ist allerdings grenzwertig: Wollanteile und vor allem diese Acrylfaser, nach jedem Waschgang verrecken Meeresbewohner an den Mikroplastikteilchen, und für das Rostbraun haben Hunderttausende weibliche Cochenilleschildläuse ihr Leben gelassen. Pardon, Pardon, ich hab’s eben nicht mehr nach Haus geschafft. Jivans Meeting war schneller zu Ende, als er es sich erhofft hat. Er trennt das Etikett ab. Der Zeitrahmen war zu eng, viel zu eng. Dann ging er entgegen seinen Plänen zu Ediz noch einen Döner essen. Na, ich konnte doch nicht mordshungrig hier aufkreuzen! Eigentlich wollte er vorher nach Hause, sich duschen und rasieren, aber er ließ sich noch während des Essens auf ein Online-Poker-Spiel ein. Bitte?!Mein härtester Rivale! Ein Champion, der ihn nie ernst genommen hat. Der amtierende Zwei-Kontinente-Champion hat ihn vor aller Augen herausgefordert, einer, gegen den nur wenige gewinnen. Mit Sicherheit hat er von Jivans letztem Reibach gegen den Europameister gehört. Seitdem hat Nutzer pokermon-key, wie Jivan sich im Netz nennt, fünfmal so viele Follower wie vorher. In den Kommentarfeldern konnte sich keiner pokermon-keys Sieg über den Champion erklären. Wird er doch, was die Wetteinsätze auf ihn und seine Siegpunktezahl angeht, als Null gehandelt. Sogar ein Programmierfehler in der App wurde da erwähnt, was Jivan ziemlich gekränkt hat. Mann gegen Mann stand heute! Da konnte ich nicht kneifen und sagen, Pardon, ich muss duschen, ich geh nachher Radieschen und Tofuwürste essen. Vor den Bildschirmen von fast 10000 Followern hat er das Spiel leider verhauen. Ich hab gekämpft bis zum letzten Blatt! Blamiert hat er sich bis auf die Knochen. War trotzdem ein brillantes Spiel, Loser oder nicht, alle hatten Spaß. Vielleicht hätte er duschen sollen. Dabei hätte er gewinnen können, er hatte keine schlechten Karten. Aber er schien auch nicht ganz bei der Sache zu sein. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, Mann! Andauernd dachte ich, eigentlich wollte ich ja noch duschen, andauernd dachte ich, Mensch, bist du unernst, wenn dich Jo jetzt sehen könnte. Er hat wichtige Details im Spiel übersehen, weil er an Jos Schamhaare dachte. Außerdem hatte er vorher mit Ediz wieder über Titten und Ärsche geredet. Jivan weiß, dass solche Gespräche sein Konzentrationsvermögen um die Hälfte senken. Was soll ich machen?Immer wenn ich eine Weile mit Eddie rede, kommt die Sau aus mir raus. Er wird primitiv. Nein! Nur so unter Männern! Bei Eddie kann ich eben mal locker sein. Heute sind wir sogar zu einer echten Erkenntnis gelangt. Was ist der Beweis dafür, dass sich auch Männer auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren können? … Die Leserinnen und Leser sind gespannt auf die Antwort. Der Fakt, dass Frauen zwei Brüste haben. Er ist ein Sexist. Falsch, ich bin Feminist!Ich fördere Jo doch, wo ich kann! Und, ja, Sex mit Jo ist mir jede Mühe wert. Er meint damit die horrenden Spielschulden, aber deswegen ruft er nachher noch seinen Vater an. Immerhin hat Jivan den Beutel mit den veganen Sneakern noch im letzten Moment vom Garderobenständer im Büro genommen. Sein würziger Körpergeruch trägt die Herznote vom Adrenalin eines mühsamen Arbeitstages. Ich habe wie ein Tier geschuftet.Jedem Veganer sollte das Herz aufgehen. Und die Ledertasche? Hhhhh! Mist!
Jivan bleibt abrupt stehen und blickt sich um. Den Beutel mit seinen Schuhen kann er der Garderobenfrau anvertrauen und sie notfalls am nächsten Tag holen, aber seine abgewetzte Ledertasche will er unter keinen Umständen dort lassen. Er muss sich nur ihre Miene vorstellen. Und Jo könnte sie beim Verlassen des Lokals entdecken. Die brauch ich! Sie hängt schon seit über zwanzig Jahren über seiner Schulter, seit seinem ersten Tag als Architekturstudent an der Universität in Buenos Aires. Jo toleriert sie, sie istquasi meine zweite Haut, mein quasi ausgelagertes Körperteil. Ja, so wie sie da hängt, ist sie ein quasi-organischer Behälter, solange er keine neue kauft. Aber wie oft kauft man sich schon ein neues Organ? Diese Tasche nehm ich mit ins Grab. Jo hat ihn heute Morgen extra dreimal angefleht, sie nur heute ein Mal, nur ihr zuliebe, zu Hause zu lassen. Und er hat es ihr nicht nur versprochen und beim Leben seines Vaters geschworen, er hat es dann noch ein weiteres Mal beim Abschiedskuss, als er mit seiner Zunge ihre Ohrmuschel massierte, auf seinen Schwanz geschworen. Sie wird nun nicht nur nicht mehr mit ihm sprechen. Ich werde Jo nicht enttäuschen! Er sagt immer wortwörtlich, er liebt sie mehr als »seinen Arsch«! Dass Jivans Hintern hierarchisch unter seiner Frau steht, ist die größte Liebeserklärung, die er sich vorstellen kann. Denn er hat immerzu Angst um ihn. Im Arsch steckt seine Stehkraft, er ist sein Scharnier zur Welt. Von dort wandern seine Einfälle den Darm aufwärts, durchlaufen den Magen, gelangen durch saures Aufstoßen in den Schlund-, Mund- und Nasenrachen und werden mit einem Schluck Brandy dissoziiert runtergespült, geraten so direkt in die Blutbahn und werden auf diese Weise ins Gehirn und damit in die große, weite Welt transportiert.
Die Tasche ist außerdem zu groß, um sie im Beutel unterzubringen. Kurzerhand leert er sie aus, klemmt sich die wichtigen Papiere unter den Arm und stopft die Kleinigkeiten in seine Hosentaschen. Jivan schaut sich verzweifelt um. Nur eine ältere Frau mit Spitz ist in unmittelbarer Nähe. Er krempelt Ärmel und Hose hoch, macht einen Satz über die Hyazinthenbarriere und arbeitet sich einige Meter durchs Dickicht. Stacheln und Dornen grapschen mitleidlos nach seinem Fleisch und hinterlassen unansehnliche Striemen. Unter einem Gelben Dickährenstrauch versteckt er die Tasche so, dass man sie vom Weg aus nicht sehen kann. Als er mit einem Seufzer der Erleichterung wieder über die Hyazinthen steigt, verrichtet der Spitz gerade sein Geschäft am Wegesrand. Aber über mich den Kopf schütteln! Eilig streift er Hose und Ärmel wieder runter und läuft den Rest des Rollfelds entlang zum Restaurant. Er ist selten pünktlich, das hat er vom Vater, aber, und das kommt von der deutschen Mutter, er hat seine Verspätung stets minutengenau im Auge. Immerhin, nur zwölf Minuten über der verabredeten Zeit. Ein Intervall, in dem die meisten Menschen infolge Begrüßung, Jacke-Aufhängen und Sondieren der Anwesenden noch nicht einmal richtig Platz genommen haben.
Vom zweiten Rollfeld nebenan ist das ausgelassene Gekreische der Skater zu hören. Seit Neuestem benutzen sie Segelflügel, wenn sie von der langen Rampe herunterfahren, wie bleierne Enten schweben sie über dem Biotop. Zwei Wochenenden hintereinander konnte Jivan sich erfolgreich davor drücken, dann ist Jo endlich die Lust daran vergangen. Wie ein dürrer Affe klammerte sie sich immer ans Segel. Jivan reicht Simulation. Wenn er die Welt von oben sehen will, startet er auf seinem Smartphone das Satellitenauge. Von oben verlieren die Dinge an Detail, sie werden zu Punkten, Mustern oder Flächen, sie verlieren Bedeutung und Eigentümlichkeit, was Jivan nicht sonderlich unterhaltsam findet. Das Blackbird’s Song, zum Beispiel, könnte mit ein wenig Fantasie aus der Vogelperspektive so etwas wie eine aufgeplatzte Bockwurst sein, die von einer Zange gehalten wird. Dabei ähnelt das Gebäude einem Vogel kurz vor dem Abheben und steht drei Meter über dem Boden auf einer Konstruktion aus Beton und Stahl. Für Architekt und Restaurant das reinste Fiasko, findet Jivan. Auch um diesen Enttäuschungen zu entgehen, hat er sich auf Bunkerbauten spezialisiert.
An der Garderobe lässt er den Beutel mit den alten Tretern. Im letzten Moment nimmt er auch seine Lifewatch ab. Die Dame ist so freundlich und verstaut seine Habseligkeiten für ihn in einem Beutel. Am Einlass zieht der Doorman seine Kreditkarte durch den Scanner. »Sie werden an Tisch 14 erwartet.«
»Danke.« Neugierig späht er zum Tisch, der in zweiter Reihe vor dem Fenster steht. Jivan ist ein Mann, der die Menschen, die er trifft, ausgiebig googelt. Er durchforstet Webseiten, Fotos, Videos, Blogbeiträge, Forenbeteiligungen und, und, und. Damit übertreibt er es meistens, aber eine schnelle Recherche reicht ihm nicht. Er sucht immer auch nach so etwas wie einem »Haken«, einem Aufhänger. In Wikipedia durchstöbert er die Diskussionsseiten des Artikels, lokalisiert die IP-Nummern der beteiligten Autoren, um herauszufinden, ob die Darstellung selbst verfasst wurde. Er geht nie unvorbereitet zu einem Termin. Als er einmal so gut wie nichts über eine Person herausfinden konnte, hat er den Termin kurzerhand abgesagt. Er ist ein Mann, der stets wissen muss, mit wem er es zu tun hat.
Jo hat ihn entdeckt und winkt, ein Mann (Achim Krüger) und eine Frau (Kim Fischer) drehen sich um. Mit entspannter Zurückhaltung, tierlieb und mit proteingesättigtem Großmut, mit dem Vorsatz, sich seiner Frau zuliebe charmant und geistreich zu geben, auf keinen Fall über Geld oder Fleisch zu reden, nähert er sich der Abendgesellschaft. Er weiß, Jo will die Position als PR-Chefin bei Animal Rights unbedingt, und er will auch, dass sie sie kriegt. Das Erste, was Jivan damals, als er als junger Architekt nach Paris gegangen ist, von den Europäern lernen musste, war, dass sie es leider gar nicht normal finden, wenn man sie liebevoll zur Begrüßung mit Schwachkopf, Dicker oder Spargel anredet.
»Bonsoir, Señor y Señoras!«, sagt er und berührt seine Frau am Rücken, küsst sie sanft in den Nacken. Jo umfasst zuerst seine Taille, küsst ihn, sie schnüffelt an seinem Hemd. Ein entsetzter Blick trifft ihn mitten ins Herz. »Pardon, hatte keine Zeit mehr zu duschen«, flüstert er ihr ins Ohr.
»Nicht deshalb, du Arsch.« Obwohl ihre Worte lautlos über die Lippen kommen, erwischen sie ihn mit voller Wucht.
Er kneift die Augenbrauen zusammen und zeigt ihr, dass er nicht weiß, was sie hat. Riecht er etwa nach Verlegenheit? An ihm riecht sie doch sonst so gern die Rührseligkeiten, die er oft nicht über die Lippen bringt.
»Kim? Achim? … Mein Mann Ivan.«
Er hasst es, wenn sie ihn so nennt, und sie nennt ihn eigentlich immer so. Jo meint, Ch’ivan klinge, als würde jemand ein Sofa übers Parkett schieben. Mit einigem Abstand, weil er einsehen muss, dass er sich wohl geirrt hat, was die Notwendigkeit einer Dusche anbelangt, schüttelt er Kims Hand.
»Kim Fischer. Grüß dich, Ivan.«
Sie hat einen kräftigen Händedruck, Jivan würde sagen: ein Tier von einer Frau, mit schwarzen Augen, die sich in ihr Gegenüber bohren. Ihr Haar ist derart kurz geschnitten, dass er für eine Sekunde denkt, sie hätte vergessen, sich zu rasieren. Mit ihrer Hakennase wirkt sie wie ein genmanipulierter Greifvogel. Ein Bild von einem General Manager. Wie Jivan bereits weiß, sitzt die Frau auf einem Vereinskapital, mit dem man in Berlin drei internationale Flughäfen bauen könnte. In nur einem Jahr und ausschließlich mit globalen Imagekampagnen, basierend auf mitleid- und grauenerregendem, formvollendetem Hochglanzfoto- und Videopatchwork, für das sich internationale Stars aus lauter schlechtem Gewissen umsonst aufopferten, hat Kim Fischer die Schickeria des Planeten tief bewegt, die Tierschutzbewegung auf die hinteren Plätze verdrängt und Animal Rights zum weltweit wichtigsten und erfolgreichsten Vertreter für Tierrechte gemacht. Jivan hält seinen Blick tapfer über Kims Kinn, versucht, ihre Hühnerbrust zu ignorieren. Die hackt mir glatt die Augen aus.
»Freut mich, Ivan. Achim Krüger.« Er ist das, was man einen Softie nennt, schlaffer Händedruck, salonfähiger Irokesenschnitt in Grün mit Pferdeschwänzchen. Jivan würde sagen: Nett, doch, nett ist Achim. Auf so gut wie jedem Foto mit Kim Fischer ist er dabei, als wäre er ihr Exoskelett. Wie ein tier- und frauenlieber Hahn wirkt er, testosterongedimmt und zahm. Einer, der pickt und nicht schlingt, der zupickt und nicht würgt. Ein Mann, wie Kim Fischer ihn gern an ihrer Seite hat, ein Mann, wie sie ihn vermutlich gern an Jos Seite sehen würde.
»Kim und Achim, großartig, euch endlich kennenzulernen.« Jo zieht Jivan neben sich, auf die andere Seite des Tisches. Sie trägt Dutt und eine dunkelblaue Schlabberbluse, unter der Jivan ihren Körper gar nicht richtig sehen kann. Das bislang teuerste Stück aus ihrer Veganerfashionabteilung, die seit ihrem Einstieg bei Animal Rights die feminine, die Business- und sogar die Kreativcool-Sektion auf die hinteren Stangen verdrängt hat. Aber er kennt sie, er weiß, nichts ist bei ihr von Dauer. Brav setzt er sich neben sie, gegenüber von Kim, deren taxierender Augenausdruck ihn in seiner positiven Haltung stört. Sein Blick wandert zwischen Jo und Achim hin und her, die mit der Menüauswahl beschäftigt sind. Jo wirkt konzentriert. Sie sitzt kerzengerade. Jivan würde sagen, sie ist nicht sie selbst. Sie hat nicht gekifft und spricht in zusammenhängenden Sätzen, sogar ihr rollendes R, das als einziges Erbstück noch an ihre verstorbene russische Mutter erinnert, hört man kaum. Sie presst ihre Lippen aufeinander. Sie stützt ihre Ellbogen auf, sie faltet ihre Hände. Ihre Sinnlichkeit wurde vom tiefdunklen Blau ihrer biederen Leinenbluse verschluckt, sie sieht erschreckend seriös aus, steril geradezu. Wäre sie Jivan damals so begegnet, er hätte sie wohl nicht mal mit einer Arschbacke angeschaut.
»Ich sage: Menü drei«, sagt Jo. »Nur anstelle von Rosmarin nehme ich lieber Salbei und Kümmel.« Sie tippt auf dem Bildschirm herum, er spürt ihre kalte Schulter, sie ist verärgert, sonst mag sie, wenn er verschwitzt ist. Er sieht ein, dass er sich diesmal geirrt hat. Jo macht an diesem Abend auf unnahbare Führermentalität, denn Animal Rights braucht eine PR-Chefin, die »die Welt nicht so hinnehmen wird, die weiß, was Tiere wirklich brauchen und wie sie frei und glücklich werden sollen«. (So hat es Kim Fischer selbst in einem Interview in der Urania formuliert.) Eine PR-Chefin, die »der Welt vermitteln muss, dass nur der Mensch den Tieren helfen kann, dass der Mensch sozusagen der Tiere wegen erschaffen worden ist«. Bis gestern hätte Jo an Rosmarin noch nichts auszusetzen gehabt. Bisher war Jo immer offen für das, was die Welt ihr anzubieten hat.
Für den Bruchteil einer Sekunde denkt Jivan daran, ihr zu widersprechen. Fast wäre er ihr ins Wort gefallen und hätte erwidert: »Hase, aber mit Rosmarin haben wir die Reismilchbrühe noch nicht probiert.« Stattdessen sagt er: »Menü drei klingt hervorragend. Was sagst du, Kim?« Erst jetzt traut er sich wieder, Kim ins Gesicht zu schauen.
Doch sie lässt sich nicht auf Blicke ein, sie macht bloß eine Handbewegung, ihr ist es egal. Kim Fischer ist kein Gourmet, anno dazumal war sie Teil der Anarchoszene im Tacheles und hat sich hauptsächlich von Currywurst und Brötchen ernährt. Jivan beobachtet sie aus dem Augenwinkel.
Immerhin ein Lächeln kann er zu Jo schicken, es rutscht durch zu ihr, obwohl sie gerade Achim bei der Eingabe der Getränkewünsche in den Tischcomputer assistiert. Er klammert sich mit den Augen an ihr Profil, hangelt sich immer mal zum Bildschirm, er will Jo auf keinen Fall auf die Brüste schauen. Er will nicht, dass Kim ihn mit ihren Adleraugen dabei erwischt, er schämt sich regelrecht für diese Reflexe, aber er hält durch. Ich werde gelenkt und geleitet. Er hat es so gewollt. Er hat sie zum Einstieg bei Animal Rights überredet. Sie hat immer mit Tanner rumgemacht, ich konnte diesen BetterPlanet-Stuss nicht mehr hören. Er wollte seine Ruhe haben. Ich wollte, dass Jo weiterkommt.
Der Kellner bringt vier Bier. Achim hebt sein Glas, spricht einen Toast aus auf ein gerechteres Leben für Mensch und Tier. Überhaupt ist er sehr gesprächig. Jivan ist ein Mann, dessen Gehirn, immer wenn jemand in seiner Nähe zu viel redet, von störenden Textketten gehackt wird, die wie Sabotageeinheiten in seine Gedanken einfallen, dann wie Schlangen quer durchs Feld ziehen und sich einen Weg zur Zunge bahnen wollen. Solch eine Kette belagert gerade seinen Gaumen: Eine frisch geschlachtete Aubergine ist auch kein schöner Anblick. Für einen Moment hat Jivan vergessen, dass er mit Animal Rights verabredet ist. In letzter Sekunde kippt er den Bandwurm hinter die Binde und prostet Achim zu. »Schön gesagt. Auf das gerechte Tier im Menschen. Prost, Kim, auf deinen Mumm.« Er stößt mit Kim an, blickt ihr in die Augen. Sie grinst sogar.
»Ivan, der Mensch ist ein selbstgerechtes Tier!«, sagt Jo. Er weiß, dass sie so etwas sagen muss, denn der Mensch ist laut Satzung der Organisation »ein böses Tier«.
»Leider wahr, Hase«, antwortet er. Eigentlich hatte er ihr heute Morgen versprochen, heute Abend nicht »Hase« zu ihr zu sagen? Aber offenbar hat sie es überhört.
»Ich hab einen tollen Bericht gesehen …«, beginnt Jo.
In dem Moment serviert der Kellner kalte Kräutersuppe und ein paar Beilagen in avocadoförmigen Glasschwenkern.
Sie greift sich ein in Rosenblätter gewickeltes Safrantofu-Stäbchen vom Tablett. »… Also, in so einem Dorfteich irgendwo in Europa wurde ein Krokodil gefunden. Wisst ihr, was kurios war? Das Kroko war ein Veggie. Und trotzdem hatten die Leute Angst vor ihm. Ein Krokodil gehört nicht hierher, und solchen Mist redeten sie. Eine Armee von Experten wurde gerufen. Die rackerten sich ab, um das arme Vieh irgendwie aus dem Teich zu locken. Wie die Hirnöden belagerten sie das Ufer. Nachts fuhren zwei Aufklärungsboote herum, für die der See eigentlich viel zu flach war. Das brachte natürlich nichts. Dann legten sie tatsächlich den ganzen Teich trocken, um an das Krokodil zu kommen. Es muss vor Angst geschlottert haben. Fünfzig Leute aus dem Dorf kamen mit einem Netz, damit fingen sie das Kroko ein. Ich weiß nicht, ob sie es töteten, aber ich hoffe, dass es vorher so viele Eier vergraben hat, damit genug Kinder nachwachsen, die die Blödheit und Selbstgerechtigkeit dieser Leute auffressen und ihre Häuser vernichten.«
Das, haargenau das, hab ich Jo erzählt. Er weiß, dass das jetzt keine Rolle spielt. ICHhab das gesehen und mich darüber empört! Jivan fährt konzentriert mit seinem Löffel durch die Brühe und versucht, eine Kaper zu fangen. Er weiß, dass Jo weiß, dass er ihr die Geschichte erzählt hat. Schließlich hat sie ihm, wie es aussieht, den »Hasen« verziehen. Sie hält auch kaum eine Reportage durch, springt mittendrin auf und beginnt etwas Neues. Er dagegen ist ein Mann, der sein halbes Leben beharrlich vor Bildschirmen verbracht hat. Er glaubt von sich selbst, dass es fast nichts gibt, was er nicht gesehen und von dem er nicht schon mal gehört hätte. Oft sieht er Dokus auch ein zweites oder drittes Mal, weil er weiß, dass ihm immer Details entgehen. Laut Aufstellung seiner letzten Mediennutzungsgebührenabrechnung empfängt er jährlich rund 7500 Stunden Nachrichten und Reportagen. Ungefähr 900 Stunden liefen letztes Jahr Bet und Win und Online-Poker über seine Bildschirme. UND er gehört zu den drei Prozent männlichen Usern auf der Welt, die regelmäßig Women TV einschalten.
Kim ist sichtlich angetan von Jos Geschichte, und nur das zählt, das wollte er erreichen. Die Story sollte Bonuspunkte einbringen. »Krass«, sagt sie. »Denkst du, so was könnten wir für einen Spot verwerten?«
Animal Rights kämpft um ein Profil, sie stehen unter Rechtfertigungsdruck. In einer Spiegel-Doku über die Verabschiedung des jüngsten EU-Haushalts wurde die Organisation vor allem aus der Ecke der Sozialministerien angegriffen, sie werfen ihr und ihren Förderern vor, die Kunst- und Medienlandschaft mit Geld zu fluten und teure, aber vollkommen sinnlose Kampagnen zu finanzieren, die »einer Giraffe das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung« versprechen.
Jivan greift nach der Reismilch-Salbei-Kümmel-Brühe und wirft einen Esslöffel in Kokosfett geröstete Schalotten hinein. Er hätte darauf gesagt: Was können denn die armen Tiere dafür, dass wir Menschen unseren Scheiß nicht gebacken kriegen? Jo meinte neulich Abend, bei Animal Rights gehe es um viel größere Fragen, nur fällt es ihr schwer, präzise zu werden, sie meint, das übersteige sowieso unseren Horizont. Jo ist nicht der Typ für Präzision. Sie wiederholte deshalb lieber, dass Animal Rights die Welt verändern und damit alle anderen Probleme mit einem Schlag lösen werde. An dem Abend hatte sie aber auch dermaßen viel gekifft, sie fing plötzlich an zu weinen. Jo wird immer pathetisch, wenn sie kifft. Sie war einfach verzweifelt, weil ihr nichts Gutes einfiel. Ihre Ideen müssen durchschlagend und plausibel sein. Und Jivan hatte keine Lust, noch so eine Nacht zu verbringen, in der sie sich mehr mit anderen Tieren beschäftigte als mit ihm. Er wollte ihr ein Argument liefern, dass sogar auf der bösen Zunge der Menschenrechtsszene wie Honig schmeckte. Aus lauter Verzweiflung hatte er dann einen zündenden Einfall, nämlich, dass Animal Rights auch den Menschen besser machen kann, ihn als Vorbild nutzen, seine Grundrechte zwangsweise durchsetzen kann, indem man dieselben Rechte juristisch auch den Tieren zugesteht. Wer möchte schon schlechter dastehen als ein Affe oder ein Schwein. Quasi eine tierische Menschenrechtsorganisation, die das Pferd von hinten aufzäumt. Er schlug ihr vor, Animal Rights müsse zeigen, wie die Tierrechte dem Menschen nützen können. Das fand Jo richtig inspirierend, und die Nacht war für ihn gerettet. »Kann ich eine Scheibe vom Sesambrot haben?«, flüstert Jivan in Achims Richtung.
Jo will ihre Geschichte nicht als Aufhänger. »Zu viel Tierschutz«, meckert sie. »Damit verlieren wir noch unsere Fans an die.«
»Klar, aber der Aspekt der Freiheit kommt dort trotzdem nicht schlecht«, sagt Kim. »… Mir fehlt Salz.«
Der Kellner bringt schon den nächsten Gang – ein auf Palmenblättern gegrilltes Pilzassortment. Bei dem Duft nach Wildbeeren und Koriander muss Jivan an Rehrücken denken.
»Zu negativ, Kim«, sagt sie. »Da finde ich Zigarettenwerbung wirksamer. Diese neue Freiheit im Tier muss der Mensch spüren. Ich dachte eher an was Mythisches. Menschen müssen sich da leicht reinversetzen können, du musst dich verbinden können.«
Jivan weiß, Animal Rights befindet sich noch in einem weiteren Dilemma. Wenn Tieren ein Recht auf Leidensfreiheit juristisch zugesprochen werden soll, müssten es Menschen auch bekommen. Aus der Satzung von Animal Rights wird nicht klar, ob Tiere sich in der Wildnis frei oder geschützt vor ihr frei fühlen sollen. Ob sie durch Bildung/Zucht frei werden oder davon befreit frei werden sollen. Hier sieht Jivan für Jo noch jede Menge Möglichkeiten, sich einzubringen.
»Jo, du hattest heute Morgen doch diese echt witzige Idee«, sagt er. Er spürt, dass sie keine Ahnung hat, wovon er spricht.
Kim lacht. »Sag jetzt nicht: das Schwein als guter Banker oder das Schaf als guter Politiker? Damit kriegen wir Zustrom von unten, aber verprellen unsere wichtigsten Fürsprecher.« Aus der Rubrik Partner auf der Webseite von Animal Rights geht klar hervor, dass die Organisation das Lieblingsprojekt einiger Energie- und Automobilriesen ist, die sich zum Teil für eine ganze Dekade zu jährlichen Großspenden verpflichtet haben.
»Was hältst du von mir? Auf so einem Niveau arbeite ich nicht! Ivan, diese Idee ist schon witzig, aber noch zu unausgereift, finde ich.«
»Komm schon, Jo. Sei locker. Wir wollen sie trotzdem hören.«
Zum Glück bringt der Kellner gerade eine Karaffe Wein und vier Gläser. Achim schenkt ein, sagt kurz »Prost«, und alle kosten erst einmal vom gerade prämierten Biowein.
Jivan weiß, dass Jo weiß, dass sie heute Morgen gar keine Idee hatte, und er spürt, dass sie nicht weiß, wie sie ihn dazu bringen soll, die Klappe zu halten. Aber jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. »Natürlich hat Jo recht«, beginnt er. »Das ist nur eine Idee. Eine Kampagne muss man erst daraus machen …«
Kim zieht interessiert die Augenbrauen hoch.
»… Jedenfalls für jemanden wie mich klingt sie echt ansprechend. Also, es gibt doch diese aufblasbaren Einhorn-Hörner, die man sich vorn am Kopf befestigt. In einem Spot könnten Menschen und Tiere so ein Ding tragen, das meinte Jo vorhin mit mythologischer Verwandtschaft, die ja sofort dabei entsteht. Beide haben plötzlich einen direkten Draht zueinander durch ein gemeinsames Merkmal. Wer weiß, so könnte man im Lauf der Zeit eine kognitive Revolution unter den Tierarten auslösen, Bedürfnisse wecken. Die Tierfarm 2.0. Sie vergleichen sich untereinander, sie finden, dass sie was gemeinsam haben, sie rücken ein Stück ab vom einfachen Tiersein und wir vom Menschsein. Animal Rights könnte sogar einen weltweiten Einhornfeiertag einführen. Da gibt es dann schon Wochen im Voraus Einhörner aus Schokolade, Einhornbraten aus veganer Kräuter-Tofu-Erbsenpaste, kühle, spritzige Drinks aus einhornförmigen Gläsern und Flaschen. Der Sommer wäre für so was ideal, da kann Mensch und Tier mit dem Einhorn-Horn in den Urlaub reisen. Alles beginnt doch im Kopf, Krankheiten, Ideen, Emanzipation, Menschenrechte, also, wenn Tiere irgendwann in der fernen Zukunft wirklich sinnvoll mit ihren Rechten umgehen sollen, dann müssen sie ein Bewusstsein dafür aufbauen. Warum sie nicht endlich in die technologische Entwicklung einbinden? Vielleicht können wir dann in einer Million Jahren auch Bedürfnisse befriedigen, von denen die Tiere heute noch nichts wissen? Das würde auch potentielle Geldgeber aus der Wirtschaft überzeugen. Konnten wir vor 10000 Jahren wissen, dass wir mal so dringend einen Assistenten oder eine Lifewatch nötig haben? Die technologische Entwicklung war immer unser zuverlässigster Weltverbesserer, deshalb hat mich Jos Idee mit diesen aufblasbaren Einhorn-Hörnern sofort überzeugt. Sie ist so einfach wie einleuchtend. Diese Dinger könnten langfristig einen evolutionären Sprung auslösen. Ich bin sicher, die Herstellerfirma der Hörner steigt da mit ein.«
Achim blickt zu Kim, Kim zu Jo, Jo zu Jivan.
Er zu Kim. »Klingt brillant, oder?«
Sie nickt. Sie grinst wieder. »Imperialer Einfall, Jo. Dazu brauche ich bis zur nächsten Sitzung ein ausgereiftes Exposé.«
Jo berührt ihn dankbar am Arm. Ihre Finger sind kalt. Auch ihre Miene erwärmt sich nicht. Kein Kuss, kein zärtliches Fingerspiel. Vielleicht wäre so ein Einhorn-Horn für Männer und Frauen manchmal ganz gut, um einen besseren Draht zueinander zu haben und effektiver über Probleme reden zu können? Wie oft hat Jivan sich gefragt, wozu der Mensch, bei all den Tieren auf diesem Planeten, auch noch Einhörner erfunden hat – jetzt hat er wenigstens eine Antwort.
Achim wirkt nicht ganz so überzeugt. »Also, ich finde, Tiere sollten Tiere bleiben.« Kim lässt ihn reden. Sie denkt, er redet.
Er hebt noch mal das Glas und sagt: »Auf das Tier im Tier und den Mensch im Menschen!« Der Wein lockert die Zunge.
Mit der Gabel spießt Jivan eine kugelförmige Karotte und einen Steinpilz auf und schwenkt beide durch das muskatschwangere Lauch-Apfelmus. »Ich würde mir auch gerne mal wieder die Eier lecken können«, denkt er laut.
Sie lachen, und er spürt, wie sie denken, dass das Selbstmitleid von Menschen witzig ist.
»Darum geht’s aber nicht bei unserer Sache, Ivan«, sagt Jo.
»Aber wir wissen doch gar nicht, ob wir wirklich Menschen sind. Wir sind die Einzigen im Weltall, die das behaupten. Und wenn einer von uns gern ein Tier bleiben will?«
»Dem Kampf für die Rechte der Tiere wird es wenig nützen, wenn wir jetzt anfangen, an unserem Menschsein herumzuzweifeln«, beginnt Achim. »Wir haben die Verantwortung für sie und müssen alle unsere Kräfte dafür einsetzen, ihr Leben auf der Erde besser zu gestalten. Solange Tiere keine Rechtsträger sind, haben sie auch keine Rechte. Und wenn wir als Rechtsträger jetzt anfangen, unsere Rechte als Menschen in Frage zu stellen, wie sollen wir ihnen dann helfen?« Achim redet und redet, immer dasselbe.
Jivan fragt sich, ob der enttierte Mensch dann so was wie ein guter Computer ohne Hormone ist, aber mit haufenweise Selbstmitleid, und unterbricht ihn. »Sag mal, ist der selbstbestimmte Hund dann also schon fast ein Mensch? Und sollten vielleicht die guten Computer mit den lieben Tieren zusammenleben?«
Darauf will keiner so richtig eingehen. Der Kellner bringt eine zweite Karaffe Wein. Kim ist aufgetaut und redet. Jo und sie entwickeln Spots. Achim ist verstummt, er nickt vor sich hin und lächelt. Dazu hat Jivan keine Lust, aber er streichelt Jo ab und zu über den Rücken, von ganz oben bis zum Steiß.
Achim gießt in großem Maßstab Wein in die Gläser. Wieder lässt er einen Toast ab: »Auf dass die Welt sich zum Besseren wende.«
Jivans Mutter Wilma besaß die Faksimile-Ausgabe einer gezeichneten hebräischen Bibel, die hat Jivan sich als kleiner Junge immer angesehen, auch weil er die Farben so knallig und toll fand. Auf den letzten Seiten feierten vier Tiere das Happy End der Menschheitsgeschichte. So kommt Jivan sich gerade vor. Wie diese vier Tiere an diesem Jüngsten Tag sitzen sie hier: Adler Kim, Hahn Achim, Jo, die Löwin, mit ihrer roten Mähne, und er muss wohl der Ochse sein. Er fragt sich: Sollten am Ende der Menschheitsgeschichte etwa die Tiere die großen Sieger sein? Gibt es eine Rettung der Menschheit durchdie Menschwerdung der Tiere? Aber am meisten beschäftigt ihn seit Jos Einstieg bei Animal Rights: Dürfen wir dann wieder Tiere sein und alles machen, was wir wollen? Ist das dann das Paradies auf Erden? Er hat zu viel gesoffen, und diesmal schläft seine Zunge so schwer im Kiefer, dass von dort so schnell kein Wort herausrutschen kann.
Aufgetürmt in einer Oregano-Pitateig-Schüssel bringt der Kellner zwölf erdnussgroße Eier aus Hafermilchkäse, die mit Granatapfel-Samen, Johannis- oder Heidelbeeren gefüllt sind. Jivan wirft sich eine Kugel wie eine Tablette ein und spült mit Brandy nach.
»Sag mal, Ivan«, Kim legt ihre Hand auf seinen Arm. »Eine Sache irritiert mich an dir. Den ganzen Abend über kämpfe ich schon damit.« Kims Zunge ist offenbar auch schon schwer wie Blei.
»Richtig so, raus mit der Sprache, Kim, legen wir die Karten auf den Tisch.«
»Riechst du nach Döner, sag mal?«
Er blickt kurz zu Jo, die erschrocken zu Kim und Achim und dann zu Jivan blickt, der kritisch an seinem Hemd schnuppert und Kims Einwand erst einmal mit einem genervten Nicken und einer hochgezogenen Augenbraue begegnet. »Wollt ihr was sehen?« Er krempelt den Ärmel an seinem rechten Arm hoch und entblößt eine wirklich unschöne Blessur.
Jo berührt irritiert seinen Arm. »Wie ist das passiert?«
»Ich hatte vorhin eine Auseinandersetzung mit dem Besitzer eines Dönerladens neben meinem Büro. Jeden Tag zieht dieser bestialische Gestank nach totem Tierfleisch in mein Studio. Macht ihr mal einem Türken klar, der tut, was seine Großeltern schon getan haben, und stolz auf sein Halal-Zertifikat ist, dass er grundfalsch handelt. Es tut mir wirklich leid, Kim, aber ich verkehre in solchen Etablissements sonst nie, deshalb war mir nicht bewusst, dass schon fünf, sechs Minuten ausreichen und man das Leid der Tiere sogar an Hemd und Hose mit sich herumschleppt. Ich selbst hab das gar nicht gerochen, das Essen duftet hier so betörend.«
»Ivan, wir sollten die Wunde desinfizieren«, meint Jo.
»Ja, ich hatte leider keine Zeit dafür, sonst wäre ich noch später gekommen. Aber ich denke, klares Wasser wird reichen.«
Aber Jo besteht darauf, die Wunde einem Arzt zu zeigen. Kim drückt am Tischbildschirm »Menü beenden«.
In letzter Sekunde zieht Jivan noch seine Kreditkarte durch den Scanner. »Der Abend geht selbstverständlich auf mich. Es war mir wirklich ein Vergnügen und eine Ehre, euch kennengelernt zu haben.«
Endlich bekommt Jo rote Wangen von der Euphorie, und er weiß, wenn Jo euphorisch ist, werden ihre Schleimhäute von Feuchtigkeit durchflutet. Er drückt Achim kurz an sich und klopft ihm wie unter Männern auf die Schulter. Kim haucht er charmant einen Kuss auf die Hand, er könnte schwören, auch ohne hinzuschauen, dass ihre Brustwarzen hart wurden und sich spitz wie Nägel von ihm verabschiedeten. Aber er wird einen Teufel tun und den gelungenen Abend kaputtmachen.
Auf dem Weg zur U-Bahn-Station wirft Jivan einen verstohlenen Blick ins Dickicht. Dann fasst er Jo an der Taille, zieht sie zu sich heran und küsst sie. Er spürt eine Zickigkeit in diesem Kuss, ihre Zunge hält sich zurück. »Was ist los?«
»Ivan, ich habe seit heute einen Coach. Er wird mir helfen, mein kognitives Bäläns neu einzustellen. Wenn ich weiterkommen will, muss ich an mir arbeiten. Ich muss an meinem Typ arbeiten. Ich muss wissen, wer ich wirklich bin.«
»Und was heißt das?«
»Du denkst immer nur ans Ficken.«
Bis jetzt stand es da so fünfzig, fünfzig. »ICH? Also nur ich, oder was?« Er schätzt sie als »Fachmännin im Tantrasex«. Deshalb hat er sie überhaupt geheiratet.
»Ja, ich auch, aber das will ich jetzt ändern. Ich muss mir andere Seiten antrainieren, ich muss taffer werden, cooler, härter, selbstbewusster. Ich muss wirken wie jemand, dem man etwas zutraut. Ich möchte ernst genommen werden, Ivan. Sonst krieg ich nie solche Jobs wie bei Animal Rights. Das hast du heute ja gesehen, oder?«
Er hat es gesehen und fragt sich, ob sie deswegen den Job bekommen hat.
»Mein Coach sagt, ich soll erst mal für eine Weile auf Sex verzichten, ich soll mich mehr kontrollieren, ich soll mich mehr fokussieren. Und es wär echt super, wenn du mich dabei unterstützen würdest.« Sie streicht über die Knopfleiste seines fleischduftgetränkten Hemdes.
Fast bekommt Jivan einen Asthmaanfall, als reagierte er allergisch auf diese Buchstabenkette. Er fragt sich sofort, ob sie diesen Coach mit seinem Geld bezahlt. Schweigsamkeit und eine Schlange aus gescheiterten gedanklichen Formulierungen begleiten Jivan und Jo auf ihrem Nachhauseweg. Und nur die Hoffnung, dass das Tier in ihr stärker sein wird, hält ihn davon ab, sie noch in der U-Bahn auf Knien anzuflehen und sich vor aller Welt lächerlich zu machen. Aber er kennt ja Jo, sie hält nie lange durch.
Wäre die Reinigungsfirma nicht zufällig gerade gekommen, hätte Jivan seine Papiere und seine Schuhe aus dem Schließfach nicht vor dem Nachmittag zurückbekommen. Wenn er bloß wüsste, auf welcher Höhe er seine Tasche suchen sollte, er hätte die Stelle markieren müssen. Fast eine halbe Stunde lang irrt er durch den Dschungel auf dem Rollfeld und dreht jedes Blatt um. Mit Schrecken muss er feststellen, dass die Tasche nicht mehr unter dem Gelben Dickährenstrauch liegt. Er fragt sich: Welcher vegane Blödhammel klaut hier schon eine alte Büffelledertasche? Panisch gräbt er sich durchs Unterholz, reißt sich den Hemdärmel ein, schon drängen sich ihm Erinnerungsbilder auf, im Stil von: der frischgebackene Architekturstudent Jivan Haffner Fernández mit Papa Lautaro Álvaro Fernández und seiner neuen Ledertasche am ersten Tag an der Uni in Buenos Aires … Immerhin, keine fünfzig Meter weiter ertastet er sie schließlich im Bauch eines Berberitzenstrauchs. Doch kaum hat er sie in der Hand, bemerkt er, dass ein Tier, vielleicht ein Fuchs oder ein Wildschwein, sie vollkommen zerbissen und bepinkelt hat. »Ach was, ein Fuchs!«, schimpft er laut vor sich hin. »So ein selbstgerechter Köter, der nur seine Grundrechte ausgeübt hat.« In dem Moment erklingt ein Piepton aus seiner Lifewatch, und eine Kurzmeldung erinnert ihn daran, seine Spielschulden von gestern umgehend zu begleichen.
1
Dort, wo auf dem Kontinent die Welt aufhört und die Wildnis beginnt, jenseits der letzten Zuckungen menschlicher Zivilisation, hinter Abertausenden von Hektar eines hermetisch wirkenden Urwalds, genau dort, wo das Festland endet und das Meer beginnt, liegt eine einsame, paradiesische Bucht.
Die Wellen schieben sich in einem chronischen Koitus vor und zurück. Die Mittagssonne stichelt. An einem schattigen Plätzchen zieht sich ein Mensch einen Hut aus Palmenblättern tief ins Gesicht, seinen nackten Leib verhüllt er mit einer gegerbten Alligatorenhaut. Ein Floß mit hängendem Flügel schaukelt nah am Ufer, angebunden an den Stamm einer Palme wie ein versehrter Pegasus. Und das Meer schwitzt und wispert vor sich hin.
Fünfhundert Seemeilen weiter nordöstlich lösen sich unterdessen Schwärme von Wassermolekülen aus dem brütenden Ozean. Sie taumeln und steigen dem warmen Brodem nach, der sie immer weiter nach oben lotst, sie drehen sich und kreiseln über der aufgeregten Wasserfläche des Ozeans. Kühle Winde umzingeln sie, schwingen ihre Klingen in alle Richtungen und versuchen, diesen geschwätzigen Wirbel zu zerlegen. Immer mehr Moleküle schließen sich an, sie bäumen sich zu einer zornigen Streitmacht auf, und die kalten Böen werden zu schneidenden Windstößen, die den Luftkessel aufzuschlitzen beginnen.
Derweil schickt der Ozean Wellen wie liebestolle Botschaften in alle Richtungen, so weit, dass sie sogar die nackten Zehen des Menschen in der paradiesischen Festlandbucht erreichen. Dieser nimmt mit einem Gähnen den Blätterhut vom Gesicht, blickt zu seinem schwankenden Floß, dann zur verfinsterten Stirn über dem Horizont und zieht sich den Hut wieder übers Gesicht.
Gut fünfhundert Seemeilen nordöstlich davon saugt währenddessen der mächtige Sog weiter Hitze aus dem Meer, einer außerirdischen Invasion gleich schiebt sich weißer Dunst vor jedes Objektiv, kein Satellit hat mehr Durchblick. Als der geisterhafte Titan mit dreihundert Kilometern in der Stunde über den molligen Bauch der See wirbelt, bekommt er endlich einen Namen. Sie nennen ihn Frankenstorm Tony.
Erste Regentropfen fallen auf die paradiesische Festlandbucht, sie landen wie Fallschirmjäger auf dem heißen Sand, der Hut aus Palmenblättern wird von einer Böe mitgerissen. Der Mensch erhebt sich und sieht ihm nach. Tony kündigt seinen Besuch an. Eine metallisch glänzende, türkisfarbene Plastiktüte aus Coca-Colas letzter Weihnachtspromotion schleudert der Sturm ans Ufer, ein erstes Präsent zur Begrüßung. Eine Windhose schnappt sie sich und tanzt mit ihr über den Strand. Die Plastiktüte klammert sich am Mast des Floßes fest. Einer von Tonys langen, weit ausschwingenden Armen will sie an sich reißen, er wirbelt sie herum. Die Tüte klammert sich weiter am Segelmast fest. So lange zerrt er an ihr, bis die Spitze des Pfahls sie durchbohrt, er sie in zwei Stücke gerissen hat und einen Teil mit sich auf die hohe See nehmen kann.
Der Mensch erhebt sich, läuft ins Wasser, um sein Floß zu sichern, an einer geflochtenen Liane zieht er es über den Strand und übergibt es dem Schutz der Baumkronen.
Der Regen landet inzwischen wie schwere Munition auf dem Sand, als fordere Tony Respekt für sich ein. Der Mensch hält sich die Alligatorenhaut schützend über den Kopf und bringt sich in seiner Hütte in Sicherheit.
In der Zwischenzeit hat es sich Tony anders überlegt, er dreht ab und bittet tausend Seemeilen nordöstlich der Festlandbucht eine kleine Insel zum Tanz. Erst bläst er seinen megalomanen Atem über sie hinweg, dann drischt er so lange auf sie ein, bis sie weich und gefügig wird. Mit seinem kraftstrotzenden, feuchten Sog leckt er ihr begierig alles an loser Materie ab, was zu seinem großen Walzer bereit ist: gebrochene Äste, Einzeller, Bakterien, Pilzsporen, Zygoten, Gameten, alles Ungebundene versammelt er um sich in wirbelnder Begeisterung.
Auf den Satellitenbildern protzt Tony mit seiner Statur. Seine ausladenden Hüften sind furchterregend und lassen die Gewalt erahnen, mit der er sich seiner Beute nähern wird. Und die Insel – liegt nun dürr und spröde unter ihm, beraubt ihn jeglicher Lust, bis er sich leicht abgekühlt, aber noch immer voller Euphorie von ihr abwendet und mit neuem Schwung über den wallenden Ozean hinweg auf seine nächste Eroberung, das dicht besiedelte Festland, losstürmt.
NO IM PARADIES
1 Ich wollte nichts schreiben. Bin Sind seit 5 Monaten hier. Aber ich krieg meinen Kopf nicht leer, deshalb kratz ich das Zeug jetzt auf Palmenblätter. Ich hoffe, dass die Natur das für mich irgendwann entsorgen wird. Mühsam. Hab viele gesammelt, getrocknet und geölt. Schreibe nur, was muss. Eigentlich ist Jule schuld. So sieht es aus.
2 Ich heiße No. Eigentlich Noah Hoffmann. Mein Name ist nicht wichtig, aber falls doch mal. Ich bin der Oberspinner hier im Paradies, ich bin der Einzige, der lacht und heult. Der Schwanz, mit dem ich wedeln kann, wirkt auf die Bewohner hier befremdend. Ein Tier ohne Schwanz ist ein Sender ohne Antenne.
3 Nicht mit Gewehr und Kamera bin ich los. Nein, richtig. Die ersten richtigen Aussteiger. Wir waren nackt. Ich und Jule. Ich bin noch nackt. Jule wäre es im Prinzip auch noch. Sie wollte erst auf eine Insel. Aber ich hasse Inseln. Hier ist es viel geiler. Es wird schon irgendwie. Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch.
4 Trotzdem ist alles perfekt. So sehe ich das. Das hier ist das verdammte Paradies. Ich schwinge im totalen Einklang mit der Umgebung. Ich bin zurückgekehrt in Mutters Schoß. Im Prinzip bekomme ich ja alles, was ich mir wünschen kann. Hallo, Natur, hier bin ich.
5 Die Welt ist chronisch. Mein Kopf ist voll, zum Platzen voll. Meister Proper ta-ta-tanzt den Scha-wanensee. Aber sonst grenzenlose Freiheit. Niemand versucht mich zu beruhigen. Mich erreicht kein Kommando, meine Antenne ist sowieso im Arsch.
6 Am Anfang war der Speer, das Gewehr, das Heer. In der Hölle ist es voll. Im Himmel ist es leer. Die Jule macht’s mir schwer. Was sich reimt, ist scheiße. Ich brauch nur Steine, Hölzer und Hände. Wenn ich reden muss, schwimme ich zu den Delfinen.
7 Bin ich etwa ein Chroniker? So ein Oberspinner? Lass ich mich hier von dieser insektenhaften Mechanik der Oberspinner da draußen kaputtmachen? Die ihre Drähte bis in unsere Katheter einführen. Wir sind so was von in-in-inkontinent.
8 Diese Stürme hier wollen an mein Floß. Ich kämpfe lieber nicht. Ich baue lieber ein neues. Jedes Floß wird schöner. Das nächste werde ich nicht mehr Jule taufen, glaube ich.
9 Tschaikowski gepfiffen. Wiehieder Schwanensee. Ich kann nicht mehr! Und immer die gleichen Sprüche in meinem Kopf. Jule ist mir manchmal richtig auf die Nerven gegangen. Einfach mal Klappe halten, hab ich gesagt. Und die Sprache der Natur sprechen. Wenn ich nicht bei den Delfinen bin, spreche ich mit Steinen.
Jule: Was machst du?
No: Chillen.
Jule: Ohne mich?!
No: Häng dich hin …
Jule: Ist alles okay?
No: Alles okay.
Jule: Klingt aber nicht so.
No: Ist aber so. Komm, leg dich neben mich.
Jule: Dann rutsch mal, sonst kann ich nicht richtig liegen.
No: …
Jule: …
No: …
Jule: Weichst du mir aus, sag mal?
No: Quatsch.
Jule: Und vorhin? Du gehst einfach aus der Bude, ohne mir guten Morgen zu sagen oder mich mal zu fragen, ob ich gut geschlafen habe.
No: Guten Morgen, Julchen! Hast du gut geschlafen?
Jule: Sehr witzig! Ich mein’s ernst. Das ist doof.
No: Okay, verstanden.Ich denk dran.
Jule: …
No: …
Jule: Und wenn ich einen Albtraum gehabt hätte, dann brauch ich jemanden. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
No: Für dich. Für mich ist es dann doppeltes Leid.
Jule: Wieso das?
No: Hab auch noch meins.
Jule: Spinner! Siehste, das meine ich. Nicht, wenn du’s mit mir teilst.
No: Dann haben wir beide zweimal halbes Leid, dann können wir’s auch gleich für uns behalten.
Jule: Egoist!
No: War nur Spaß. Hast recht. Nächstes Mal, versprochen. Jetzt lass uns chillen.
Jule: Sag mal, nimmst du mich überhaupt ernst? …
N-Global
DEINE NACHRICHTEN RUND UM DEN GLOBUS
Sprachversion des Artikels auswählen
Queen’s Bay. Frankenstorm Tony hat wieder an Stärke zugenommen und Kategorie 5 erreicht. Mit einem Durchmesser von 1000 Kilometern und 280 km/h bewegt er sich auf die Küste von Queen’s Bay zu. Fast zwei Millionen Menschen müssen evakuiert werden. Die Meteorologen hoffen, dass der Wirbelsturm sich während seiner Reise über dem weiträumigen Riff austobt und an Stärke verliert, bevor er das kontinentale Festland erreicht. Es ist der dritte Wirbelsturm in Folge, dessen Kurs nördlicher als sonst verläuft. Er bedroht weite Teile der Ballungsräume.
New York/Vandenberg. Der UN-Wirtschaftsrat hat die Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung weltweit verschärft. Vorgestern Nacht wurde vom Stützpunkt Vandenberg in Kalifornien eine Trägerrakete mit einem neu entwickelten Erdbeobachtungssatelliten ins All geschickt. Die Kosten von insgesamt umgerechnet 100 Milliarden Euro sollen gemeinsam von NASA, ESA, Roskosmos und CNSA getragen werden. UN-Finanzsekretär Wolfson sagte in einer Stellungnahme: »Jetzt können wir jeder Hochseeyacht bis unter den Kiel schauen.«
Wien. In einer Filiale von Toys''R''Us explodierte vor einer Stunde ein Sprengsatz, der offenbar in einer Trivial-Pursuit-Verpackung versteckt worden war. Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt.
Brüssel/Lublin. Die UNRIC begrüßt den zehnmilliardsten Menschen auf der Erde, der heute im polnischen Lublin geboren worden ist. Auch Papst Innozenz XV. hieß den neuen Erdenbürger in einer Videogrußbotschaft willkommen.
Rio de Janeiro. Wie aus dem heute veröffentlichten Bericht des Weltklimarats hervorgeht, verlagern sich durch die globale Erwärmung die warmen Meeresströmungen und Sturmfronten. Während der letzten zwölf Monate erreichten die Orkanstärken neue Höchstwerte und kosteten fast einer Viertelmillion Menschen das Leben.
Dresden. Der »Dresdner Stollen« ist auf der diesjährigen Gastronomieweltausstellung zum Weltkuchen des Jahres gekürt worden. Ein besonderer Glückwunsch kam aus dem Kanzleramt.
Brüssel. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Europaparlaments plant eine zunächst auf fünf Jahre befristete Vermögensabgabe in Höhe von zehn Prozent für Sparguthaben zwischen 10000 und 50000 Euro, heißt es aus Brüssel. Mit den zusätzlichen Einnahmen will die Staatengemeinschaft Investitionen im Bereich innere Sicherheit und zur Stabilisierung des Bankensystems vornehmen.
Moskau. Der Computerspiele-Magnat und Erfinder der Simulationsplattform »MyLife« Jevgeni Sukin hat heute überraschend bekanntgegeben, seit Jahren intensiven Kontakt zu vermeintlichen Außerirdischen auf Exoplanet Kepler-62e zu haben. Übermorgen will er mit seiner privaten Raumfähre zu persönlichen Gesprächen dorthin aufbrechen.
Buenos Aires. Ein als Gorilla verkleideter Aktivist hat gestern während des Weltwirtschaftsgipfels in der argentinischen Hauptstadt die Dienstwagen der internationalen Regierungsmitglieder mit Graffiti beschmutzt. Sätze wie »Ihr Machtmenschen seid psychisch krank!« oder »Wer herrschsüchtig ist, braucht eine Therapie!« waren dort zu lesen. Auf dem Wagen des amerikanischen Präsidenten stand: »Menschen sind entartete Schimpansen!« Wie er die Wachposten umgehen, auf das Gelände kommen und wieder fliehen konnte, ist bislang noch ungeklärt. Das Videomaterial der Überwachungskameras wird gerade ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires hat Anklage erhoben und sucht den Verkleideten per internationalem Haftbefehl.
LAUTARO ÁLVARO
WENN MAN BEDENKT, WELCHEN EINFLUSS DIE VERGANGENHEIT AUF DAS LEBEN DER NACHGEBORENEN HAT, IST ES UNVERANTWORTLICH, DIE WAHRHEIT ÜBER DIE GESCHICHTE UNSERER VORFAHREN NUR AUF FAKTEN BERUHEN ZU LASSEN.
Noam Braslavsky
Der Wind pfeift über die nahe gelegene Avenida Circunvalación 25 de Mayo, dass man es noch im Umkreis von einem Kilometer hören kann. Lautaro Álvaro Fernández hat seine Wohnzimmerfenster im zweiten Stock in der Avenida Eduardo Carrasco in Rosario sperrangelweit geöffnet, sonst hält er die Fieberattacken nicht aus. Das zehnte Mal surrt schon das Anrufsignal seiner Lifewatch, laut genug gegen das Tosen des Windes, zum zehnten Mal ertönt eine freundliche weibliche Ansage: »Anruf von Jivan«, doch er tut weiter so, als wäre nichts. Ja, ja, denkt Lautaro Álvaro, ich ruf ihn später an. Aber was gibt es schon Wichtigeres in seinem Leben als seinen Sohn?
Lautaro Álvaro Fernández gehört zu den schwarzen Schafen in der heroischen Chronik der Familie. Wie schon sein Vater und dessen Vater hat er mit der Tradition gebrochen, sein Leben der beständigen Vermehrung von Ländereien und anderen Wertgegenständen zu widmen. Das war hart! Das ist wahr! Also, im Grunde hat er nichts falsch gemacht, das war schon Brauch geworden. Ich hab mich geändert! In der Schule hat er den Mädchen unter den Rock gefasst, die kleineren Jungs hat er verprügelt, er war die große Petze. Fußball, Judo, Klavierunterricht, Tango – alles hat er hingeschmissen, seine Mutter hat er angelogen, den Unterricht so oft geschwänzt, dass er beinahe von der Schule geflogen wäre und man von einem Wunder sprechen muss, dass er überhaupt schreiben kann. Die fundierteste Ausbildung bekam Lautaro Álvaro in einer Gruppe pubertierender Kleinkrimineller. Er lernte dort blitzschnell, wie man unbemerkt an Daten kommt und Leuten alles Mögliche klaut, wenn auch mehr aus Jux und Tollerei. Diese Veranlagungen könnten natürlich auch direkt vom andalusischen Urahn Álvaro Lautaro de Fernández auf ihn übergegangen sein, der im 16. Jahrhundert als Gewinner aus den Eroberungs- und Enteignungsfeldzügen auf dem südamerikanischen Kontinent hervorgegangen war. Jedenfalls wäre ohne die großzügige Investition seiner unverheirateten Tante in den Aufbau der digitalen Schulbibliothek Lautaro Álvaros Schulabschluss nicht denkbar gewesen. Überhaupt waren es die pflichtbewussten alten Jungfern, die die Zügel auf dem argentinischen Großgrundbesitz stramm zu halten versuchten, trotz der stetig ausbrechenden Rindviecher wie Lautaro Álvaro oder Pablo Lautaro Álvaro und davor schon Sergio Álvaro Lautaro. Zu irgendwas mussten die Weiber janütze sein! Dennoch ist das prächtige Latifundium de Fernández in Santa Fe seit der Zeit des Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters um glatte zwei Drittel geschrumpft –, aufgezehrt von den »neuen Bedürfnissen« der letzten Gutsherren, von fast einhundertjähriger Lotterwirtschaft und den scheibenweisen Veräußerungen diverser Ländereien zur Aufrechterhaltung eines ruinösen Lebensstils. Schuld seien die Drogen, allen voran Marihuana, und dieses naive linke Studentenbewegungsgelaber anno dazumal, damit habe der Untergang angefangen, meint Lautaro Álvaros Schwester Lucia Rosa Fernández, das hätte den Männern die Knochen weichgekocht. Zu Recht fragt man sich da, warum die guten Jungfern eigentlich nicht selbst zur Erhaltung der Fernández’schen Keimbahn beigetragen haben. Die Antwort lautet – und es fällt nicht leicht, das so deutlich zu sagen: Sie sind hässlich und, wie auch im Fall von Lucia Rosa, darüber hinaus unfruchtbar. Lautaro Álvaro meint, und damit steht er in der Familie nicht allein da, alle sehen aus wie Makrelen.
Das Beste in seinem Leben vollbrachte Lautaro Álvaro im Alkoholrausch während eines World Social Forums in Buenos Aires, in das er eher zufällig geraten war: Er schwängerte eine deutsche Doktorandin der Kulturwissenschaft namens Wilma Haffner. Lautaro Álvaro war und ist ein attraktiver Mann. Wilma hätte ihn sogar geheiratet, aber er betrog sie einmal zu oft. Einen Monat vor Jivans Geburt verließ sie ihn. Und nur auf Drängen seiner Schwester Lucia Rosa und unter deren Drohung, ihm den Geldhahn abzudrehen, begab sich Lautaro Álvaro am Tag nach der Geburt seines Sohnes ins Krankenhaus, um die Vaterschaft zu erklären. Da wurde ihm unvermittelt der kleine Jivan in den Arm gelegt, und als der ihn so vorurteilsfrei und unschuldig anblinzelte, entdeckte Lautaro Álvaro in den Gesichtszügen sich selbst wieder. In so vielen Weisen spiegelte er sich darin und noch mit allen Optionen, mit all den Hoffnungen und Alternativen. Die markanten abfallenden Furchen um den Mund, die heruntergezogenen Winkel, die harten Kanten gab es noch nicht. Er war derart tief berührt, dass er beschloss, einen dicken Schlussstrich zu ziehen, seinem Sohn ein Vorbild zu sein und mit ihm eine neue Ära in der Fernández’schen Sippe einzuläuten. Bis zum tragischen Unfalltod von Wilma Haffner vor fünfundzwanzig Jahren zahlte Lautaro Álvaro seiner Fast-Ehefrau jeden Monat einen Bonus dafür, dass sie nur gut über ihn sprach. Und Wilma war eine gute Mutter, ein »echt tolles Weib«, sagte Lautaro Álvaro immer über »seine Wilma«, sie hielt den Mund, hat nie ein schlechtes Wort über ihn verloren und Jivan nie die Wahrheit über seinen Vater, die Trennung und seine Familiengeschichte väterlicherseits erzählt. Jivan wusste nichts von deren jahrhundertelanger Blutrünstigkeit und Raffgier, die erst durch die beharrliche Einwirkung von Marihuana und linken Parolen so gut wie gestoppt worden war, nichts von der darauffolgenden, nennen wir es: Orientierungslosigkeit und nichts davon, dass die Familie durch eine neu erfundene Chronik und eine dementsprechend neue Selbstdarstellung vor dem vollständigen Untergang bewahrt werden soll. Nur dass Wilma dem Jungen keinen seiner beiden Vornamen geben wollte, hat er ihr krummgenommen, aber das war eben Wilmas Bedingung: neuer Name, neues Spiel, neues Glück. Außerdem konnte man sogar aus so einem spirituellen Hindi-Namen, sie sprach ihn auch immer so ätherisch aus: Schiiiwan, etwas Spanisches machen. Aus jedem Quark kann man was Spanisches machen, hat es bei den Fernández immer geheißen. Ch’ivan – ganz einfach war das. Was dieser Name bedeuten soll, hat Lautaro Álvaro vergessen, obwohl Wilma beteuerte, wie wichtig die Bedeutung des Namens für einen Menschen sei. Doch an so etwas Ätherisches glaubt ein Fernández nicht. Er glaubt an die richtige Sortierung und Darstellung von Fakten.
Niemand war in Lautaro Álvaros Leben jemals wichtiger als Jivan, und er war seinem Sohn gegenüber streng, wenn es darum ging, sich der Konsequenzen des eigenen Handelns für die nächsten Generationen bewusst zu sein, denn da kennt er sich aus. Wenn man die Dinge wieder ins richtige Licht rücken muss, darf man nichts dem Zufall überlassen, und man darf nicht zimperlich sein. Spielsucht, Raffgier, Grausamkeit, Verschwendung und Völlerei – das kann einen in der Tat deprimieren, das macht einen nur pomadig, das erdrückt einen am Ende. Wie soll man danach noch etwas ausrichten? Und dann noch der ganze gequirlte Nazi-Mist von Ur-Urgroßvater Albert, in den sich seine Ur-Urgroßmutter Juanita Rosa verlieben und von dem sie auch noch einen Sohn auf die Welt bringen musste. Das einzige Kind von einer weiblichen Fernández. Wilma trieb das Ganze noch auf die Spitze und behauptete immer, die Argentinier wären schlimmer als die Deutschen, dabei hat sie den malignen Narzissmus in den Genpool der Familie mitgebracht. Aber muss man darüber reden? Muss man das seinen Kindern antun? Das ist passé. Man muss an die Zukunft der Familie Fernández denken. Man muss Verantwortung für sein Erbe übernehmen, man muss sich überlegen, was man weitergibt. Wer vererbt schon seine dreckigen Unterhosen? Warum sonst brachte Lautaro Álvaro den kleinen Jivan zu einem Ernährungscoach, der behauptete, dass individuell angepasstes Essen einen besseren Menschen aus jedermann machen könne. Seitdem isst Jivan mehr Hase und Reh und weniger Rind und Schwein. Wie Lautaro Álvaro immer sagt: »Gene sind ja auch nur Basenpaare, und wenn man sie nicht unnötig provoziert, dann lassen sie einen in Ruhe.«
Wenn der Name Fernández eine neue Bedeutung bekommen soll, dann muss man die Auswahl der Ereignisse sorgfältig treffen und die Formulierung selbst in die Hand nehmen. Was gäbe Lautaro Álvaro darum, wenn man den ranzigen Quark aus der Vergangenheit einfach rausschmeißen könnte … Also, wieso geht er nicht ran, wenn sein Sohn anruft?
Lautaro Álvaro rinnt eine Schweißperle an der linken Schläfe entlang, die rechte kühlt der Föhn, der von draußen hereinweht. Er schwitzt vor Anstrengung, er schwitzt im Kampf mit seinen Vorstellungen, er schwitzt auch vor Traurigkeit. Er schwitzt aber vor allem, weil das Fieber wieder da ist. Er braucht ja bloß eine Tablette zu nehmen, die den Blutkrebs schon seit einigen Jahren erfolgreich in Schach hält. Und er raucht wie ein Schlot, als wollte er so die übermächtigen Regimenter weißer Blutkörperchen in seinem Leib weiter aufstocken. Mit dem behaarten rechten Unterarm wischt er sich über die linke Wange. Er sitzt am Tisch, vor ihm liegt ein Stapel weißes, säurefreies Papier, daneben neun übereinandersteckbare, silbrigglänzende Zylinder mit einer Lebensdauer von bis zu 300 Jahren, Superkleber mit methusalemartigem Haltbarkeitsdatum und ein Spitzhammer samt Halterung. Konzentriert blickt Lautaro Álvaro auf das leere Blatt vor ihm, er ist eben kein Mann der vielen Worte. Dennoch, mit einem Federhalter, gefüllt mit blauer, säurefreier und nicht eisenhaltiger Tinte, und mit leicht zusammengekniffenen Lippen, als wären sie Türsteher, die jedes Wort musterten, schreibt er auf ein Blatt Papier:
An meinen Enkelsohn persönlich (zur heiligen Kommunion)!