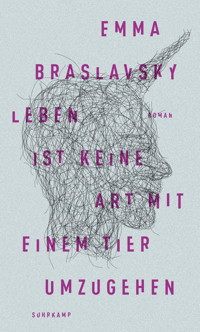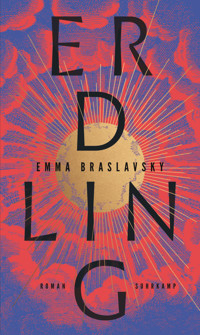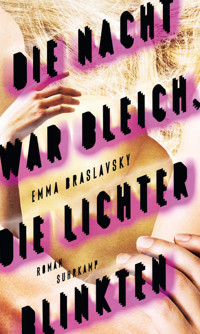
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Berlin, in einer nahen Zukunft. Die Stadt pulsiert dank der Hubot-Industrie: Robotik-Unternehmen stellen künstliche Partner*innen her, die von realen Menschen nicht zu unterscheiden sind; jede Art von Beziehungswunsch ist erfüllbar, uneingeschränktes privates Glück und die vollständige Abschaffung der Einsamkeit sind kurz davor, Wirklichkeit zu werden. Doch die Zahl der Selbsttötungen hat sich verzehnfacht. Denn die neuen Wesen beherrschen zwar die hohe Kunst der simulierten Liebe, können aber keine Verantwortung für jene übernehmen, mit denen sie zusammenleben. Immer mehr Menschen gehen an sozialer Entfremdung zugrunde. Deshalb kommt Roberta auf den Markt. Sie soll die Angehörigen der Suizidant*innen ausfindig machen, um dem Sozialamt die Bestattungskosten zu ersparen. Versagt sie, wird sie in Einzelteile zerlegt und an die Haushaltsrobotik verscherbelt. Und nicht jeder ist am Erfolg ihrer Ermittlungen interessiert.
Emma Braslavsky blickt einer Stadt ins Nachtherz und führt uns auf die dunkle Seite einer aufgekratzten Metropole. Ihr Roman ist Großstadtmärchen und Kriminalgeschichte und erzählt witzig und rasant von der Radikalisierung des Individuums, von der schmalen Grenze zwischen natürlichem und künstlichem Leben und von der Allmacht der Algorithmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Emma Braslavsky
Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten
Roman
Suhrkamp
Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten
Zum Gedenken an Gregor
… er lässt den Vater im Stich und nahm eine höhere Bahn von der Begierde nach dem Himmel gezogen.
Ovid, Metamorphosen. Achtes Buch
Hush now baby, baby, don't you cry.
Mamma's gonna make all of your nightmares come true.
Mamma's gonna put all of her fears into you.
Mamma's gonna keep you right here under her wing.
She won't let you fly, but she might let you sing.
Pink Floyd, Mother
Lennard
Würde die Sonne in der Nacht scheinen, wäre sie sprachlos, was da alles zum Vorschein käme. Das Tageslicht kann die dunklen Seiten einer Stadt nicht aufdecken. Denn nur nachts entblößt die Metropole ihre langen Beine, nur dann zuckt ihr Puls in den nervösen Lichtern. Und nur aus der Ferne betrachtet, glüht dieses Spinnentier in der Finsternis, aus der gerade die Nachtbotendrohnen der Deutschen Post angeflogen kamen, um Briefe in ihren Zustellbezirken zu verteilen. Heute vor genau zehn Jahren hatte Nachtbotendrohne Gert den Zustellbezirk 10999-32 übernommen. Er näherte sich Kreuzberg immer von Südwesten her, stets zur selben Zeit, stets in der vorgeschriebenen gemächlichen Geschwindigkeit und stets auf derselben Route. Dabei erfassten seine Bildsensoren jeden Abend die paradoxen Folgen menschlicher Nyktophobie, der Furcht vor der Dunkelheit, die mit Partys und grellem Gefunkel zurückgedrängt wurde, mit Lichtern und Irrlichtern, mit denen kein Tageslicht mithalten konnte. Die Nacht war mächtig, sie infiltrierte die Gefühle, sie steuerte die Gemüter, im Dunkel entstand und zerfiel das Glück.
Heute war der Abend klar, der Himmel leer, seine Schwärze schien weit weg, es war kühl. Wie immer um diese Zeit war auf der Bergmannstraße viel los. Menschen überall, Paare und Gruppen drängten sich vor und in den Lokalen. Sie liefen quer über die Straße, Fahrzeuge bahnten sich ihren Weg durch die Menge. Ein Flickenteppich aus Gelächter und Gesprächen rollte sich auf und schob sich über die erleuchteten und geöffneten Fenster hinweg die Fassaden hoch. Gert flog gut zwei Meter über den Köpfen, er steuerte Richtung Hasenheide und dann weiter Richtung Görlitzer Park. Blickte man nach oben, sah man die an ihm befestigte silberfarbene Kassette, prall gefüllt mit Briefen. Gert begann seine Tour in der Wiener Straße. Im Haus Nummer 47 im dritten Stock belieferte er einen Gustav Appel seit zwei Jahren mit Liebesbriefen. Jeden Samstagabend warf er einen in den dafür vorgesehenen Postschlitz neben dem Wohnzimmerfenster. Doch diesmal war der Schlitz zugeklebt. Erfolglos drückte er den Brief gegen die Tesa-Membran. Danach, so erforderte es die Dienstvorschrift, schwenkte er ans Fenster und klopfte mit einem Kunststofffinger gegen das Glas. Herr Appel hatte die Gardinen nicht zugezogen, und das Bild, das Gerts Sensoren erfassten, durfte er nicht speichern oder verarbeiten. Er hätte die Situation auch gar nicht verstanden, denn er war nicht dafür gebaut, zu verstehen, was er da »sah«. Gustav, ein Mann um die vierzig, lag nackt und reglos im Erbrochenen auf dem Sofa. Vier leere Wodkaflaschen, einige Tabletten und Reste von weißem Pulver auf dem Glastisch, daneben ein kleines Messer. Gert klopfte erneut mit dem Kunststofffinger an die Scheibe, so wie es die Dienstvorschrift verlangte. Dann schwenkte er zum Postkasten zurück, druckte einen Sticker aus, klebte ihn gut sichtbar auf den Kasten und schwebte einen Stock tiefer. Er warf den Brief beim Nachbarn ein. Danach setzte er seine Zustellungstour fort.
Hinter dem geöffneten Fenster des Nachbarn im zweiten Stock erschien Beata, die den Einwurf bemerkt hatte, und hob den Brief auf. »Ich habe gekocht, Lennard. Warum willst du in einem Restaurant Geld ausgeben?«
»Kätzchen, wir haben was zu feiern, vergessen?«, sagte Lennard, nachdem er einen Seufzer abgelassen hatte, und verteilte kleine Küsse auf ihrem Hals. »Lass die Rechnung einfach liegen.« Er nahm ihr den Brief aus der Hand und ließ ihn auf den gewienerten Holzfußboden fallen. Seine Hände massierten ihre Schultern. Beate drehte sich zu ihm um und umarmte ihn, dabei legte er seine Wange an ihre Brust.
»Ich bin extra einkaufen gegangen.« Beata hatte Schmolllippen und dunkelblondes Haar und war einen halben Kopf größer als er. »Und ich habe die Tischdecken gewaschen.«
»Wenn ich mehr Kohle hätte, dann hätten wir das mit dem Kochen und Putzen auch noch anpassen lassen.«
»Pedro wollte das eben so.«
Lennard legte die Hände an ihre Wangen. Seine Miene verriet, dass er den Namen nicht mehr hören konnte und dass ihm scheißegal war, ob sie putzte oder kochte, und dass dieser Pedro ein Niemand sein musste, weil er eine optisch so geile Recheneinheit wie Beata mit solch banalen Features hatte ausstatten lassen.
Als Lennard Beata vor drei Monaten unten auf der Straße vor dem Haus begegnet war, konnte er sein Glück nicht fassen. Es war Freitagabend, er war abgebrannt. Obendrein hatte er es verpasst, rechtzeitig die Schlüssel für sein neues Studio beim Vermieter abzuholen und war deshalb das Wochenende über obdachlos. Und Beata war gerade sitzengelassen worden, schon zum zweiten Mal, eine Ex ohne Bezugsperson in einer geputzten, verlassenen Wohnung. Weil ihrem letzten Ex, der zu seinem neuen Lover gezogen war, die Wohnung gehörte, wurde sie nicht sofort vor die Tür gesetzt. Er suchte jemand zur Zwischenmiete, der Beata übernehmen konnte. Er hatte ein Herz, und Lennard kam gerade im richtigen Moment.
Beata sah wie ein Model aus, aber sie wusste ja nicht, wie sie aussah, wie sie wirkte. Das war nicht wichtig. Eine Recheneinheit war ausschließlich für ihre Bezugsperson da, die sie nach ihren Wünschen hatte programmieren und anfertigen lassen. Lennard hatte schon mehrere solcher abgelegten Ex-Partnerinnen gesehen, aber Beata berührte ihn in ihrer glamourösen Anmut. Zwar hatte sie etwas an sich, das ihn an seine Mutter erinnerte, aber, na ja, er war im Moment nicht in der Situation, wählerisch sein zu können. Sie hatte damals an der Hauswand gelehnt und in seine Richtung geblickt, als er mit einem Joint im Mund angetrottet kam, so als wartete sie auf ihn. Er war eigentlich auf dem Weg zu einem neuen Bekannten, der tauchen lernen wollte und dem er seine alte Ausrüstung verkauft hatte. Lennard sollte sein Tauchlehrer werden. An dem Abend waren sie locker verabredet, und Lennard hoffte, bei ihm die zwei Nächte auf dem Sofa verbringen zu können. Aber als er Beata gegenüberstand und sie ihn so erwartungsvoll anstarrte, da blickte er ihr einfach direkt in die Augen und sagte: »Da bin ich.«
Sie hatte nicht gelächelt, sondern nur gesagt: »Jetzt ist das Essen kalt.«
»Kein Ding. Bei der Hitze ist es besser so. Ich hab echt Kohldampf.«
Sie nickte. »Das hab ich dir angesehen.«
Diese Szene war alles andere als außergewöhnlich gewesen. Fälle wie Beata gab es unzählige in der Stadt. Das Geschäft mit den Hubots boomte. Die Recheneinheit Beata war von PersonalPartner programmiert und den Wünschen des Kunden akkurat angepasst und ausgeliefert worden. Mit dem Versprechen, jedem Beziehungsideal gerecht zu werden, war PersonalPartner zu einem Börsenriesen geworden. Sein Konkurrent Youbotlove erklärte Berlin in Werbeslogans sogar zur »Hauptstadt der neuen Liebe«. Wer heute noch einsam und todunglücklich herumlief, war selbst schuld. Niemand brachte dafür mehr Verständnis auf, und selbst notorisch Abgebrannte wie Lennard konnten leicht in den Genuss dieser künstlichen Liebesspender und Lebensgefährten kommen, wenn auch aus zweiter Hand, denn Ideale und Trends waren wie alles in dieser Stadt: flüchtig.
Beata funktionierte top in allen häuslichen Angelegenheiten. Außerdem war sie freundlich und geduldig. Nur wusste sie nicht, wie man Liebe und Wärme gab. Immerhin, dachte Lennard, konnte er ihr das, anders als seiner Ex-Frau, verzeihen. Beata war nicht bitter, nicht eitel, nicht selbstsüchtig, auch nicht herrschsüchtig und verletzend. Aber eben auch nicht liebevoll und zärtlich. Sie hatte diese Programme nicht installiert bekommen, weil dieser Pedro offenbar keinen Bedarf daran hatte. Und ein entsprechendes Upgrade konnte sich Lennard nicht leisten. Also versuchte er mühsam, ihr jenes Verhalten beizubringen, nach dem er sich so sehr sehnte. Nach einem Monat Übung umarmte sie ihn, nachdem er ihr die Schultern massiert hatte, und er konnte seinen Kopf an ihre Brust lehnen. Auch berührten ihre Lippen seine, wenn er sie bat, sie zu küssen; zwar war es kein richtiger Kuss, es war nur eine Berührung, aber schon dafür war er dankbar. Und eigentlich war Lennard froh, dass Beata ohne jeden Vorwurf putzte, wenn er manchmal total breit im Morgengrauen nach Hause kam und sich später im Halbschlaf im Bett übergab. Nie ekelte sie sich vor ihm, und anders als seine Eltern und sein erfolgreicher Bruder verschonte sie ihn mit beißendem Spott, wenn mal wieder eine seiner Geschäftsideen platzte oder wenn er seine Brieftasche mit dem letzten Bargeld, das der Automat bereit war, herzugeben, irgendwo liegengelassen hatte. Wenn Lennard an seine Mutter dachte, musste er auch an all die verächtlichen und enttäuschten Blicke denken, die er seine Kindheit über für die vielen verlorenen Turnbeutel, die mangelhaften Zensuren und die schlechten Schulzeugnisse (mit Ach und Krach hatte er die mittlere Reife geschafft) geerntet hatte und die er so gerne gegen die eine oder andere Umarmung eingetauscht hätte. Erst mit Beata und ihren kleinen freundlichen Handlungen hatte er zum ersten Mal das Gefühl, jenen Funken Respekt zu bekommen, der einen Menschen am Leben hält. Für sie hatte er sein geliebtes Kanu verkauft. Es hatte genug Geld eingebracht, um Beata mit seiner Kennung ausstatten zu lassen, so dass sie nun offiziell zu ihm gehörte. Jetzt war sie in der Lage, Lennard zu vermissen, wenn er mal weg war. Dieses Gefühl der Genugtuung, dieses Wissen um die neue, unbekannte Schwerkraft in seinem Leben war jeden Cent wert gewesen. Wie hätte er wohl Beata bestellt, wenn er nicht andauernd pleite wäre? Lennard hatte keine Ahnung. Heute wollten sie ihre Verbindung feiern, und sie sollte einfach für ihn da sein. Ihn einfach nur lieben. So gut sie das jetzt eben konnte. Er löste seine Hände von ihren Wangen und streichelte mit den Fingern über ihr Gesicht. »Sag nie wieder Pedro, bitte. Wir beide sind jetzt verbunden. Sag nur noch: Lennard.«
Sie lächelte. »Lennard.«
»Küss mich!«
Sie küsste ihn.
Und er freute sich, dass das jetzt besser funktionierte. »Du und ich sind verabredet, Kätzchen.« Und dass er das jetzt jedem da draußen zeigen konnte.
»Bin ich immer noch nicht richtig für dich?«
»Du bist fast perfekt, Kätzchen. Mehr kann ich nicht erwarten.«
»Das ist keine Rechnung, der Brief ist für Herrn Appel.« Sie machte eine Bewegung mit dem Kopf Richtung Fußboden.
Lennard hob das Kuvert auf und betrachtete es von beiden Seiten. Er roch Lavendel. »Der wird sich melden.« Dann warf er sich zwei Tabletten ein. Beata fragte ihn mit besorgter Miene, ob er schon wieder Kopfschmerzen habe, und er antwortete: »Nein, ich nehm nur wieder was gegen schmerzhafte Ernüchterung.«
Lennard und Beata verließen die Wohnung. »Warte«, sagte er und griff nach dem Brief, bevor er die Tür hinter sich zuzog. Er sprintete die Treppen hoch zur Wohnung des Nachbarn. Beata folgte ihm. Lennard hatte einen athletischen Körper, breite Schultern, schmale Hüften. Er war nicht groß, aber stark und hatte muskulöse Arme. Zweimal klingelte und klopfte er, aber niemand öffnete. »Herr Appel?« Sie warteten ein paar Sekunden auf eine Antwort, dann liefen sie Hand in Hand die Treppen hinab, hinaus auf die Straße.
Das unebene Kopfsteinpflaster glänzte vom letzten Nieselregen und verstärkte das Leuchten gegen die Nacht. Seit dem erfolgreichen Start der Hubotpartnerbörsen vor fünf Jahren hatte sich die Einwohnerzahl der Stadt mehr als verdoppelt und die der durchreisenden Sinnsucher und Geschäftsleute fast verdreifacht, in den Straßen, den Bahnen, den Lokalen, den Läden, den Parks, überall dieses Tokio-Gefühl, diese Überfüllung, diese Menschenmenge. Dieses dichte, warme Gewebe, das in dieser Stadt herangewachsen war, das jedem, der einmal Teil davon war, glauben machte, hier mehr als irgendwo sonst am Leben zu sein.
Lennard und Beata spazierten mit dem Strom. Berlin war längst keine Stadt der Singles und Ausreißer mehr, hier fand man mit der neuen Liebe zu seinem wahren Selbst und zeigte die Originalität seines Wesens durch die Wahl seines Partners. Allein ging abends niemand mehr auf die Straße. Lennard drückte Beatas Hand, denn in dieser Nacht spürte er, dass er dazugehörte, und wie dankbar er war, dass er einmal wie die anderen sein konnte, einmal kein Versager, sondern salonfähig.
Im Café Jacques am Maybachufer hatte er an einem Tisch zwei Plätze reserviert. Eine hervorragende Köchin wie Beata konnte er nicht in ein zweitklassiges Restaurant ausführen, das hätte den Abend verdorben. Ihre ständigen Erläuterungen und Einwände hätten sein neues, dank der zwei Scheiben MDMA gerade makelloses Wohlgefühl verätzt. Und Jacqui, so nannten alle den Wirt, kochte in der Gegend das beste französische Essen zu erschwinglichen Preisen. Oder nein, nicht er kochte, sondern drei seiner zehn identischen Recheneinheiten. Die anderen sieben servierten und kümmerten sich um die Gäste.
Lennard und Beata betraten das Lokal. Ein Jacqui begrüßte sie und führte sie an einen runden Tisch im linken Flügel des Lokals, um den schon sieben weitere Personen dicht gedrängt saßen. Ein Gesicht kannte Lennard, der Mann wohnte einige Häuser weiter, ein aufstrebender Irgendwer, nach seinem Auftreten und den beiden Begleiterinnen zu urteilen. Er hatte vor ein paar Wochen zufällig beobachtet, wie Youbotlove's Premium-Lieferservice die Damen an ihn zugestellt hatten und er vom sperrangelweit geöffneten Wohnzimmerfenster aus über die gesamte Straße hinweg Anweisungen gab, mit den Ladys sorgsam umzugehen, er habe schließlich keine rustikalen Landeier bestellt. Mit ihm und diesen Originalen sowie mit zwei weiteren Paaren teilten Lennard und Beata nun den Tisch.
»Ich wünsche einen guten Abend«, sagte er und schickte ein Lächeln in die Runde, dann rückte er Beata den Stuhl zurecht und setzte sich selbst.
»Kennen wir uns? Haben wir uns schon mal gesehen?«, fragte der Mann mit der doppelten Damenbegleitung.
»Das dachte ich auch gerade, aber man sieht ja täglich so viele auffällige Gesichter.«
»Da haben Sie recht, nur manche eben mehrmals.«
»Ich wohne in der Wiener Straße. Lennard Fischer.«
»Ah, angenehm, Valeri Groß in reizender Begleitung von Tonia und Larissa.« Er warf einen abschätzenden Blick auf Beata. »Hat sie sich jetzt endlich den Richtigen bestellt, oder wie?« Er zwinkerte belustigt in die Runde, die beiden Damen kicherten. Ein Pärchen knutschte. Das andere grinste verlegen, sie hatten keine Ahnung, wovon er sprach.
»Was meinen Sie?« Lennard tippte die Bestellung ein.
»Na ja, was man so hört. Ich könnte ja nie was mit einer Gebrauchten haben. Bei mir muss alles blitzeblank sein.« Den Ekel in seinem Gesicht konnte er nicht verbergen.
»Jeder kann halt, was er will, nicht?«
Gelächter. Nicken. »Und was er kann.«
»Die hohe Kunst besteht doch darin, aus ihr wieder ein Original zu machen.«
»Mal ehrlich, hätten Sie die so bestellt? Erfüllt sie denn Ihre Wünsche vollumfänglich? Ist sie denn für Sie zu hundert Prozent präsentabel?«
»Das meinte ich mit hoher Kunst. Und an die Umwelt müssen wir ja auch denken, wohin sollen wir in der Zukunft mit dem ganzen Elektronikschrott?«
»Ach kommen Sie, das klären wir in der Zukunft. Dort ist uns immer noch was eingefallen, oder?«
Wieder Gelächter. Ein Jacqui brachte das Essen an den Tisch. Beata hatte die Tagessuppe bestellt. Lennard hatte die Neuheit der Woche gewählt. »Ich mag Herausforderungen«, sagte er und begann zu essen. »Sie erfüllt schon fast alle Wünsche, nicht wahr, Kätzchen? Ich nehm's eben gern mit dem Unbekannten auf.«
Beata lächelte nicht, sie legte aber ihre Hand auf seine. Das war noch viel besser. Und nur diese Geste wurde von dem stillen Männer-Paar gegenüber wahrgenommen und geschätzt. Sie schickten ein flüchtiges Lächeln zu Lennard und Beata, dann wandten sie sich wieder ab und fummelten weiter aneinander herum.
»Mit fast geb ich mich nicht zufrieden«, sagte Valeri.
Lennard grinste und betrachtete die beiden Damen genauer, während er kaute. Beide waren der dunkle Typ, die rechts von ihm hatte etwas von der Cruz, die andere von der Neubauer. »Der dunkle Typ, was?«
Valeri lachte und stieß mit den Damen an. »Ja, ich mag's rassig.«
»Ja, ja, dunkle Seele, tiefe Wasser«, murmelte Lennard.
»Helle Seele, weites Herz«, sagte Beata und lächelte.
Valeri stockte für einen Moment und gönnte ihr einen Blick der Anerkennung. »Neues Feature oder war das schon installiert?«
Lennard war ebenfalls überrascht über diese geistreiche Bemerkung. »Das eine oder andere habe ich neulich machen lassen. Sie kennt mich jetzt schon viel besser, sie durchschaut mich manchmal regelrecht.« Er küsste sie auf die Wange. »Aber ich gehe da langsam ran. Außerdem habe ich gerade wieder eine größere Summe an mein Patenkind nach Tansania geschickt.«
»Er hat eben ein großes Herz, da kann man nichts machen«, sagte Beata.
Lennard hatte sich den Achtungsbonus für den Abend von diesem Nachbar verdient. Sein Versuch, mit Tonia und Larissa ins Gespräch zu kommen, scheiterte, weil Valeri altkluge, geschwätzige Waschweiber in der Öffentlichkeit nicht ertragen konnte, wie er verkündete. »Ich war nie glücklicher als in meinem Dreier hier«, sagte Valeri und drückte beide Frauen an sich. »Oder?«, fragte er in die Runde und beugte sich leicht über den Tisch, um auch die anderen Gäste zu erreichen.
Sie nickten.
»Mit wem haben wir denn hier die Ehre zu speisen?«
»Selma. Und das ist Bilal.«
»Prost.« Valeri hob das Bierglas in ihre Richtung. »Wenn man den Richtigen bestellt hat, dann ist das eben ein geiles Gefühl, oder Selma?«
»Bilal ist mein Dritter.«
Valeri stockte kurz und nahm einen Schluck. »Na, das nenne ich aber Entschlossenheit. Sie machen keine faulen Kompromisse. Richtig so!«, sagte er. »Das Leben ist zu kurz für Mittelwege. Wer sich nicht wohl oder authentisch fühlt, muss handeln.«
Selma prostete ihm zu, erwiderte aber nichts darauf. Bilal war sehr schüchtern und warf nur flüchtig freundliche Blicke in die Runde. Als jemand die Musik aufdrehte, standen sie auf und gingen zur Tanzfläche, wie die Hälfte der Gäste hier.
Valeri zog Tonia und Larissa vom Stuhl. »Ein Lokal, in dem man nicht tanzen kann, ist kein Lokal. Punkt, oder?« Auch er schwirrte ab.
Von den Speisenden und Tanzenden im Lokal blieb unbemerkt, was sich unterdessen draußen ereignet hatte. Eine junge Frau war vom Dach des Gebäudes gesprungen, ihr schmaler Körper lag verdreht auf dem Gehweg, ihr Kopf hing über den Bordstein. Einige Passanten liefen zusammen, zwei, drei Gäste, die an den Fenstertischen saßen, standen auf, um die Szene draußen besser beobachten zu können. Lennard reckte seinen Kopf. Er sah nur die weißen Turnschuhe. Beata legte wieder eine Hand in seine und lenkte seine Aufmerksamkeit auf sich. Sie wollte tanzen.
Und tanzen konnte sie so gut wie kochen. Sie schlang ihre Arme um ihn und drückte sich an ihn, als könnte sie bloß zur Musik einen Mann berühren. Die Tanzfläche quoll bald über. Die Körper schmiegten sich eng aneinander, und mit jedem Gang zum Klo, wo man sich zum Nachtisch die passenden Amphetamine reinzog, war man sich sicherer, dass dieser Abend wieder einer dieser ganz besonders geilen werden würde.
Irgendwann wurde Valeri laut singend von Tonia und Larissa aus dem Lokal geschleppt. Eine allein hätte das nicht geschafft, er hatte eben an alles gedacht. Und wer wollte jammern? Und worüber? Über die tote junge Frau dort auf der Straße? Es war einfach nur ein weiterer Selbstmord. Und nur Versager jammerten. Schließlich herrschten doch goldene Zeiten für die Liebe.
Als Beata und er das Lokal verließen, rückten gerade der Notarzt und ein Polizeiwagen vom Tatort ab. Zwei Polizisten machten noch Aufnahmen und sprachen mit Passanten. Der Körper der Frau war bereits abtransportiert.
»Weißt du, Kätzchen, du bist eigentlich eine richtige Persönlichkeit. Wir müssen öfter ausgehen, dann kochst du auch nicht so viel.«
»Schmeckt dir mein Essen nicht?«
»Doch, aber du bist nicht meine Köchin, du bist meine Frau.«
Sie spazierten Hand in Hand den Landwehrkanal entlang. Gert kehrte gerade von seiner Zustelltour zurück und war auf dem Weg ins Briefzentrum außerhalb der Stadt. Er flog in gemächlicher Geschwindigkeit über das Wasser hinüber zum anderen Ufer. Seine Bildsensoren erfassten das Flattern der durchscheinend weißen Fahnen, die nur aus jedem zweiten Mund wehten und sich schnell auflösten. Lennard erinnerte sich an den Brief für Herrn Appel, der noch in seiner Jackentasche steckte, und nahm sich vor, gleich am Vormittag wieder bei ihm zu klingeln. Als Beata und er ihr Wohnhaus in der Wiener Straße erreicht hatten, trafen sie auf dieselbe Polizeieinheit, die kurze Zeit zuvor vom Maybachufer abgerückt war. Ein Körper, verhüllt mit einem weißen Laken, wurde aus dem Hauseingang getragen und in den Leichenwagen geschoben. Lennard wendete sich an eine Polizistin.
»Was ist hier passiert? Das ist doch nicht Herr Appel, oder?«
Sie nippte an einem Kaffeebecher. »Kannten Sie ihn?«
»Nicht wirklich. Ich wohne hier noch nicht lange.«
»Warum fragen Sie dann? Warum glauben Sie, dass der Tote Herr Appel sein könnte?« Die Polizistin wirkte kühl und abweisend, sie warf nicht einen Blick auf ihn, sondern starrte durch ihre kleine, eckige Brille auf das Geschehen. »Verraten Sie mir Ihren Namen?«
»Fischer.«
»Wo finde ich Sie, falls ich Fragen habe?«
»Zweiter Stock.« Lennard zog Beata hinter sich in den Hauseingang. Sie liefen die Treppen hoch. Die Spurensicherung im Stock über ihnen machte so viel Lärm, dass es keine Zweifel mehr gab: Der Tote war Herr Appel. Warum Lennard gegenüber der Polizistin den Brief nicht erwähnt hatte, wusste er selbst nicht. Er war einem Impuls gefolgt, einer Empfindung, ganz absichtslos, er wollte ihn einfach behalten.
Der Nachthimmel wurde grau in Lennards Fenster, vielleicht auch in den Fenstern der anderen, aber wen interessierte das. Zum ersten Mal hatte Beata sich zu ihm ins Bett gekuschelt. Er wollte keinen Sex. Er umklammerte ihren warmen Körper und überließ sich dem regelmäßigen Heben und Senken ihres Brustkorbs. Wie ein Baby rollte er sich zusammen und wartete vergeblich auf den Schlaf, auf einen Traum. Er hatte doch ausreichend Schmerz- und Beruhigungsmittel genommen, der Weg müsste doch frei sein für Träume. Oder nicht? Hier! Er lag doch glücklich wie noch nie am warmen Busen, er nuckelte doch endlich unbeschwert am Leben. Wie hart hatte er dafür gearbeitet. Fast bis zur Mitte seines Lebens musste er kämpfen. Warum gab es jetzt keine Belohnung? Keinen Traum, nicht mal einen kleinen lustigen mit Bonbongeruch, keinen beschissenen rosaroten mit fliegenden und singenden Einhörnern? Noch nie hatte er sich so sehr nach Kitsch gesehnt. Er hatte ihn so dringend nötig. Er wollte fliegen, er wollte abspringen. Er begann, den Anfang eines Textes herunterzubeten, den er in der Nacht vor der Begegnung mit Beata geschrieben hatte, als er nach einem erfolglosen Arbeitstag wieder total breit, auf dem Rücken im Gras im Görlitzer Park liegend, den Nachthimmel beobachtete. Aus Angst, einzuschlafen und Opfer eines Überfalls zu werden, schrieb er ihn auf die Innenseiten von Zigarettenschachteln, die er sich aus dem Mülleimer zusammengesammelt hatte. Irgendwann war er beim Schreiben dann doch in einen tiefen Schlaf gefallen und hatte geträumt, dass er mit einem Atemzug auf den Grund des tiefsten Sees der Stadt tauchte und von dort wie ein Seeungeheuer aus dem Wasser schoss, so hoch, dass er damit ins Guinness-Buch der Rekorde kam. Auf so einen Traum hoffte er jetzt wieder. Er murmelte vor sich hin: Dort hinten ist die Stadt zu Ende, sagte er ganz bei sich selbst, nur bei sich und sonst nirgendwo, in keinem Wirrwarr der Welt, der Welt im Außen oder im Innern – da hinten ist die Stadt zu Ende, und gleich hinter der weit geschwungenen Reihe großer Silberpappeln fällt das Land steil und hellsandig ab, um anzustoßen, einzufließen in den breiten ruhigen Strom der Gefühle, der die Stadt vom flachen unendlichen Land trennt; grün, voller Grün, doch trotz der Ebenen nicht eintönig, sondern verheißungsvoll und anziehend magisch, ein Ruhe verströmendes ewiges weites Land: kein Mensch zu sehen am Ufer, an den Ufern hinauf, hinab; nicht im Land, und auch die Stadt ist ruhig wie ein schlafendes Tier … Lennard wartete immer noch auf den Schlaf. Nachdem er den Text noch ein zweites Mal heruntergebetet hatte und sich immer noch keine Spur von Müdigkeit einstellte, löste er sich aus Beatas Umarmung und verließ das Schlafzimmer. An der Garderobe kramte er den Brief an Herrn Appel aus seiner Jackentasche und schloss sich damit in seinem kleinen Arbeitsraum ein, den Beata für ihn eingerichtet hatte und in dem akribische Ordnung herrschte. Von einem niedrigen Sideboard ragte je ein Stapel frisch gewaschener und messerscharf auf Kante gebügelter Hemden und Unterhosen wie ein mächtiges Versicherungsgebäude in die Höhe.
Er besah sich den Brief noch einmal genau von allen Seiten, dann öffnete er ihn und faltete das Papier auseinander. In klarer und, wie er meinte, deutlich weiblicher Handschrift stand dort geschrieben: »An meinen geliebten Gustav, was ich dir verdanke? Goldenen Tag und Traum, des Glücks eine blühende Ranke um meinen Lebensbaum, eine Liebe, die im Verzichten schweren Sieg errang, und für mein Singen und Dichten einen reinen, keuschen Klang. Dieses Gedicht von Gustav Falke hat mich an dich erinnert, er war ein Romantiker wie du, wie vielleicht alle Gustavs auf der Welt. Ich vermisse dich sehr und hoffe, wir können uns bald wiedersehen. In ewiger Liebe, deine P.«
Lennard las den Brief ein zweites Mal mit starrem Blick. Hier bekam er endlich seinen Kitsch. Er lachte, weil er nicht heulen wollte. Auf was für einem bescheuerten Trip war dieser Herr Appel eigentlich gewesen? An so was musste man ja kaputtgehen, wer so was las, wollte den Rest nicht mehr ertragen. Verboten werden sollte dieser Kitsch! Eine solche Gefühlsduselei brachte doch jeden an den Rand seiner Existenz!
Lennard starrte weiter auf den Brief oder eher durch ihn hindurch. Er fühlte die Blässe in seinem Gesicht, hervorgerufen von diesem großen Mangel an allem Möglichen. Sein Leben war eine Partitur der Mangelerscheinungen, die unweigerlich in den Tod führen mussten, denn das war die verfickte Wahrheit über das Leben: dass es eigentlich mit der Geburt endete und von da an das Individuum in die delikate Lage brachte, sich irgendwie aus der Affäre ziehen und den geeigneten Weg in den Tod suchen zu müssen. Neuneinhalb, nein, fast zehn Monate an gutem Leben hatte jeder Mensch im Uterus der Mutter, und keiner lebte wirklich länger. Alles Weitere war nur sinnloses Überleben, und egal, wie hübsch man es sich auch einrichtete, am Ende war es grässlich.
Er nahm einen Stift und strich meinen geliebten Gustav durch. An diese Stelle setzte er: Mama. An Mama, … Er las das Gedicht noch einmal, und diesmal ließ er die Tränen fließen. Nicht weil ihn der Kitsch überwältigt hätte, sondern weil er verstand, dass dieser dichtende Gustav schlicht nicht gewusst hatte, an wen er die Zeilen adressieren sollte. Falke hatte doch bloß »An ***« geschrieben. Wäre ihm klar gewesen, dass dieses Gedicht an die Mutter zu richten sei, dann hätte es ein verdammt weises unter den Gedichten der deutschen Lyrik werden können und nicht nur mittelmäßiger, zu Recht vergessener Kitsch, der jetzt für kommerzielle Liebesbrief-Abos der Firma Amor herhalten musste, deren verschnörkeltes Logo auffällig genug auf der Rückseite des Briefumschlags zu erkennen war. Liebesbriefe dieser Art wurden von herzlosen Algorithmen generiert und von so einsamen Gustavs wie Herrn Appel gekauft, damit sie einen schöneren Tod hatten. Es waren Freudentränen, Schadenfreudentränen, die Lennard weinte, denn er hatte es ja auch noch nicht weit gebracht.
Lennard war hier ganz allein, und diesen süßlichen Geschmack, den er mit den salzigen Tränen von seinen Wangen leckte, wollte er noch ein Weilchen genießen. Er legte ein Blatt Papier vor sich auf den Tisch, griff nach einem Stift mit dünner Mine und begann ein Miniaturporträt seiner Mutter als junger Frau zu zeichnen.
Beata klopfte leise an die Tür. »Lennard? Ich mache mir Sorgen.«
»Alles gut, Kätzchen, ich arbeite noch ein bisschen.«
»Ich habe einen Traum für dich. Willst du ihn hören?«
»Immer her damit. Bitte durch die Tür.«
»Eine Katze gebar fünf Kätzchen, eines drängelte sich vor, ein Katerchen, es wollte als Erstes auf der Welt sein. Als es merkte, dass es draußen kalt und böse war, wollte es wieder zurück in den Bauch der Mutter, aber der Weg war versperrt, seine Geschwister wurden gerade nacheinander in die Welt geworfen. Sie bemerkten ebenfalls, dass es draußen kalt und böse war, aber weil der große Bruder schon da war, machte es ihnen weniger aus. Das älteste Katerchen konnte den Verlust des mütterlichen Schutzraums einfach nicht verwinden, klammerte sich an die Mutter und saugte so fest und ohne Pause an ihren Zitzen, dass drei von sechs so stark zu bluten begannen, dass sie beinahe ihr Leben verlor. Daraufhin verstieß die Katze ihren Ältesten und ließ ihn nicht wieder an sich heran.«
Lennard kratzte mit starrer Miene Striche aufs Papier, die schon deutlich das Bild seiner Mutter ergaben. »Ich verstehe den Traum nicht. Woher hast du ihn?«
»Aus einem Kinderbuch.«
»Aus welchem? Früherziehung unter Einsatz von Horrorgeschichten?«
»Nein, aus dem, das deine Mutter für dich und deinen jüngeren Bruder geschrieben hat.« Lennard antwortete nicht mehr und zeichnete weiter. Von diesem Kinderbuch wusste er nichts. Und woher sollte Beata davon wissen? Er wusste nur, dass seine Mutter Drehbücher schrieb, aber keinen Kinderkram. Sprach hier Beatas sadistische Seite? Fing sie plötzlich an, ihn zu terrorisieren, in seinen Wunden zu stochern, um sich aufzugeilen? Konnte ein solches Verhalten durch die Installation seiner Kennung ausgelöst worden sein? Lennard hielt kurz inne und überlegte. Nein, das konnte er sich nicht vorstellen. Als er die Zeichnung seiner Mutter fertig hatte, zeichnete er dieselbe Miniatur von sich selbst, ein Bild von sich als junger Mann.
Gerade schnitt er beide Zeichnungen aus und verstaute sie in den Hälften seines silbernen Medaillons, als es an der Tür klingelte. Lennard hörte, wie Beata öffnete und eine weibliche Stimme fragte, ob hier ein Herr Fischer wohne, was Beata mit Sicherheit bejahte, sie konnte gar nicht anders, Lügen ließen ihre Programme nicht zu. Es klopfte dann auch gleich an seiner Tür.
Lennard erhob sich und öffnete. Die Polizistin von vorhin musterte ihn mit anerkennendem Blick, er stand in Boxershorts da.
»Herr Fischer, bitte ziehen Sie sich etwas an.« Sie verschränkte die Arme.
Lennard griff sich Beatas Kunstfellmantel von der Garderobe und warf ihn sich über. »Gehen wir in die Küche, ich brauch einen Kaffee. Sie auch?«
»Machen Sie sich keine Umstände. Kriminalkommissarin Bruns, Suizid-Dezernat. Herr Fischer, Sie wissen, warum ich hier bin.«
»Ich ahne es.«
»Was hat Sie vorhin dazu veranlasst, anzunehmen, dass Herr Appel der Tote sein könnte?«
»Ist er ermordet worden?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Warum machen Sie sonst so einen Aufriss und sind so früh unterwegs?«
»Herr Fischer, bitte beantworten Sie meine Frage.«
»Erst wenn Sie mir sagen, ob ihn jemand gekillt hat.«
Bruns seufzte. »Nach unserem derzeitigen Ermittlungsstand, nein. Es sei denn, Sie können mir etwas anderes sagen.«
»Ich kann Ihnen gar nichts sagen, ich kannte ihn überhaupt nicht, in dieser Stadt kennt doch niemand irgendjemanden. Ich hatte bloß Glück beim Raten, sorry.« Er grinste sie an und nippte an seiner Tasse.
Hätte es in den Dienstvorschriften der Kriminalkommissarin eine Regelung gegeben, nach der sie Verarschungen angemessen vergelten durfte, dann hätte sie ihm jetzt wohl eine reingehauen, so sauer war ihr Blick. »Herr Fischer, Ihr Nachbar ist gestorben. Und Sie veranstalten lustige Ratespiele?«
»Gestern ist noch jemand gestorben, vor Jacquis Restaurant am Maybachufer.«
»Gestern, Herr Fischer, sind genau 49 Menschen in dieser Stadt gestorben, und sie alle haben sich das Leben genommen. Und von keinem von ihnen führt eine Spur zu Angehörigen oder Freunden. In welch beschissener Welt leben wir eigentlich? Können Sie mir das vielleicht erklären?«
»Die Stadt frisst ihre Kinder.«
Bruns blickte ihn einen Moment schweigend an, vielleicht in der Hoffnung, dass er doch noch irgendetwas Brauchbares sagen könnte. »Wissen Sie, wer P. ist? Er hat einen Schrank voller Briefe von ihr.«
Er schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich seine Geliebte, oder?«
Sie kniff die Augen zusammen. »Wieso glauben Sie, dass sie Herrn Appels Geliebte sein könnte, ich hatte nichts von Liebesbriefen gesagt, ich sagte: Briefe. P. könnte die Schwester, die Mutter, die Tante, die alte Freundin sein. Herr Fischer, Sie verschaukeln mich.«
Lennard stellte den Kaffeebecher ab, ging in sein Arbeitszimmer, holte den Liebesbrief und übergab ihn der Kommissarin. »Der wurde gestern Abend bei mir eingeworfen. Und als ich später oben bei ihm klopfte, reagierte niemand. Das ist alles. Um Ihnen weitere unnötige Recherchen zu ersparen: P. ist niemand, ein Algorithmus. Das ist ein Produkt von Amor. So was hatte ich auch schon mal abonniert, als es richtig hip war.« Er nippte am Kaffee. »Ich habe auch noch nie jemand zu Appels Wohnung hochgehen sehen, du, Kätzchen, hast du jemand gesehen?« Er wandte sich an Beata.
Sie schüttelte den Kopf. Und für sie war Appel sowieso nur ein Name auf einem Türschild gewesen.
Nach den dunklen Augenrändern zu urteilen, bekam die Kommissarin wenig Schlaf. Die ständige Ratlosigkeit hatte die Mundwinkel der noch jungen Frau in einem Fünf-Grad-Winkel nach unten gezogen. Der Zustand dieser Stadt ging ihr ganz offensichtlich an die Nieren.
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.«
»Schon gut. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich lasse Ihnen meine Karte hier … Falls Ihnen noch etwas einfällt.«
»Klar.«
Als die Kommissarin die Tür hinter sich zugezogen hatte, griff sich Lennard ein frisches Shirt aus dem Stapel und eine Jeans, steckte sich das Medaillon in die Hosentasche und packte einige Dinge in seinen Rucksack.
Beata griff nach seiner Hand. »Musst du heute arbeiten?«
Früher, als er noch mit seiner Ex-Frau zusammen war, hatte es immer geheißen: »Musst du heute nicht arbeiten?« War das nicht schon ein Erfolg? – O ja, das war ein Erfolg, das Weglassen eines Wortes änderte vieles, aus einem Tag, den man durchstehen musste, konnte plötzlich ein passabler Tag werden. »Ich muss nicht, aber ich sollte. Warte nicht auf mich, es wird dauern.« Er griff noch nach seiner Jacke und verließ ohne Rucksack die Wohnung.
Das Tageslicht, obwohl es noch jung war, stach Lennard in die Augen, als er auf die Straße trat, er zwinkerte in einem fort. Die Müdigkeit übermannte ihn im falschen Moment. Sein neuer Geschäftspartner, Damian, den er kurz nach seinem Einzug bei Beata in einer Kneipe kennengelernt hatte und der seit zwei Monaten Lennards Firma Aquarius am Leben hielt, wollte ihn bei sich im Büro am Erkelenzdamm treffen. Lennards Kompetenz unter Wasser wurde im Augenblick kaum nachgefragt. Als Einzelunternehmer für Tauchdienstleistungen kämpfte er gegen zu viel Konkurrenz. Seit zwei Jahren hielt er sich mit sporadischen Aufträgen über Wasser, verdiente meistens gerade so viel, wie er ausgab. Dabei hatte er die paar Tauchgänge auch noch zu billig abgerechnet, meinte Damian. Aber ab jetzt sollte wirklich alles besser werden.
Auf die Minute pünktlich traf Lennard bei Damian ein, eine Mitarbeiterin führte ihn in den kleinen Besprechungsraum. Während er auf Damian wartete, machte er sich Notizen, wie das neue Büro ihrer Firma Aquarius aussehen sollte. Eine Internetseite müsste gestaltet werden. Damian betrat den Raum.
»Lennard, grüß dich. Wie geht's?«
»Ich grüße dich auch. Danke. Und selbst?«
Damian verschob nur leicht die Mundwinkel nach oben.
»Du, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht«, begann Lennard gleich, »wie die nächsten Schritte sein könnten. Das Büro, die Websei-«
Damian unterbrach ihn. »Lennard, ich will lieber gleich zur Sache kommen. Ich habe deine Sicherheiten geprüft – du hast keine, null, überhaupt nichts. Und in den letzten zwei Monaten hast du keinen einzigen Auftrag an Land gezogen. Das rechnet sich für mich nicht, ich habe nur Spesen. Ich steig da wieder aus.«
»Damian, das ist gerade eine schwierige Zeit. Das Geld sitzt bei vielen nicht so locker. Ich arbeite von morgens bis in die Nacht, glaub mir.«
»Glaub ich dir. Ich kann mir den Spaß trotzdem nicht mehr leisten. Und du solltest dir vielleicht auch was anderes überlegen. Meine Einlage kannst du mir auch in Raten zurückzahlen. Ich werde dich da jetzt nicht unter Druck setzen, aber ich steck da keinen Cent mehr rein.« Er blickte Lennard aufrichtig und direkt in die Augen.
»Verstehe. Kein Ding, klar …«
Sie schwiegen noch einen Moment in freundschaftlicher Atmosphäre. Dann stand Damian auf, er hatte Termine und musste weitermachen. »Mach's gut, mein Freund. Wenn du einen Rat brauchst, melde dich, okay? Ich bin deshalb nicht aus der Welt.«
»Klar, danke dir.« Lennard stemmte sich aus dem Stuhl, plötzlich spürte er wieder die Müdigkeit, seine Muskeln in den Armen zuckten ein paarmal unkontrolliert. Er verließ das Office.
Draußen hatte er das Gefühl, dass seine Zunge an jedem seiner Gedanken festklebte, der Restalkohol stank in seiner Nase, sein Mund war trocken, alles drehte sich. Jetzt könnte er einen Joint gebrauchen oder einen Trip oder einfach eine Zigarette, aber er saß komplett auf dem Trockenen. Lennard hielt sich am Zaun fest und starrte auf die Straße. Mit einem Mal kam ihm alles bedeutungslos vor. Das Material, die Stoffe traten in den Vordergrund, er sah überall nur die Texturen des Betons, des Asphalts, der Zäune. Dahinter fühlte er einen enormen Informationsverlust, schmerzhaft ausgetrocknete Informationen, er blickte auf eine demente Stadt, die sich nicht mehr an sich selbst erinnerte, eingezogen in die hohen Kragen scheuernden Tuches, das fettig kalte Haar wird nicht warm unterm Hut. Außer Wind und Regen gibt's kein Wetter, blassgelbes Zwielicht immer nur. Da bleib ich lieber bei mir zu Hause, auch wenn's hier so schön laut ist. Lennard fühlte, dass er der Auserwählte war, der dieser Stadt einen neuen Sinn geben musste, damit diese vielen Dinge hier nicht alle nur so herumstanden, damit man wusste, was man mit ihnen anfangen soll. Achtung, Achtung! An alle Bewohner des Landes Bonbon! Durch einen glücklichen Umstand der Weltgeschichte ist es hier und heute möglich, das erlesenste Zirkusprogramm der Weltgeschichte Ihnen zu Ehren darzubieten. Ein kleiner weißer Hund streckt seinen Kopf aus dem runden Bordfenster eines Kutters auf dem Kanal und ruft dreimal: Jawoll, so isses! Natürlich in seiner Sprache. Hinter einem anderen ist eine wohlbeleibte Dame zu sehen, sie trägt einen riesigen mit Kaffeekannen und Blumen, auch mit Backwerk geschmückten Hut, und was man von ihrem Kleide sieht, sah vorher wohl die Welt noch nicht. Er fühlte seinen Puls im Hals. In diesem Augenblick gaben seine Knie nach, er sackte zusammen und verlor das Bewusstsein.
Lennard erwachte in der Notaufnahme im Urban-Krankenhaus. Er erwachte, weil es nach frischen Brötchen roch. Ein Cocktail aus Übermüdung, Unterzuckerung, Dehydrierung und Entzugserscheinungen hatte ihn umgehauen. Ein paar Kohlenhydrate und ein Orangensaft wirkten Wunder. Leider hätte er dieses Frühstück an jedem x-beliebigen Kiosk günstiger bekommen können, denn die Rechnung für diesen Kurzaufenthalt im Krankenhaus war happig, und eine Krankenversicherung hatte er derzeit nicht. Und seine Bankkarte war unkooperativ.
»Das läuft wie immer über meinen Vater«, sagte er an der Rezeption und tippte die Nummer von dessen Kreditkarte ins Lesegerät. »Ah, könnte ich vielleicht die Summe um hundert Euro erhöhen, damit ich noch ein bisschen Bargeld habe, um mit einem Taxi nach Hause zu fahren? Wenn es euch keine Umstände bereitet, mir das auszuzahlen?«
Der Krankenhausangestellte an der Rezeption zögerte. Solche Dinge seien eigentlich nicht Aufgabe eines Krankenhauses, das sei ja keine Sparkasse hier und auch kein Supermarkt.
»Ich weiß«, seufzte Lennard, »eine Notaufnahme hat es mit den bizarrsten Verlegenheiten zu tun.«
Der Angestellte schaute immer noch skeptisch, ging aber an die Kasse und gab ihm einen Schein.
»Danke, Bruder, du bist ein Kind der Sonne.«
Lennard war nun wirklich blitzeblank, denn er hatte jetzt auch seinen letzten Joker (die Kartennummer und die Pin hatte er wie eine Arbeitslosenversicherung in seinem Gedächtnis behalten) ausgespielt. Ein zweites Mal würden seine Eltern ihm das nicht durchgehen lassen. Daher wollte er gleich eine Nachricht an seine Mutter schicken, die immer viel strenger war als der Vater, er tippte das Gedicht von Gustav Falke in sein Telefon, verbunden mit der Einladung, einander heute am Flughafensee zu treffen. Er habe eine Überraschung für sie. Bei der Gelegenheit könnte er auch gleich das Angebot machen, die Leihgabe von Vaters Konto wieder zurückzuzahlen.