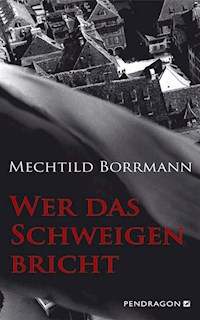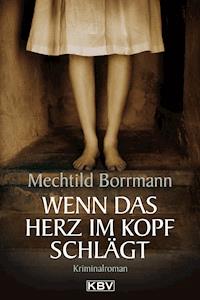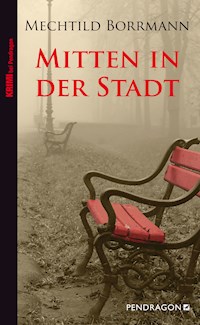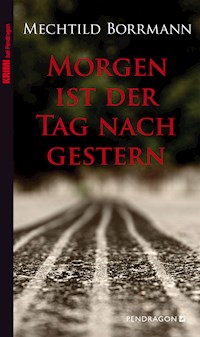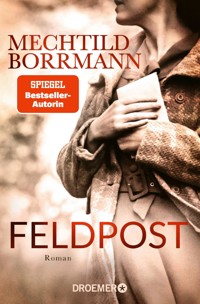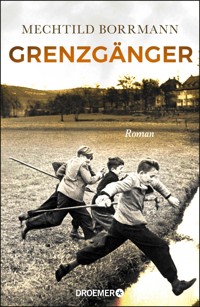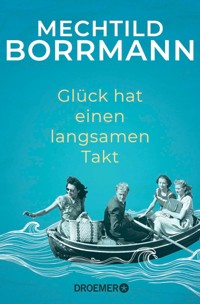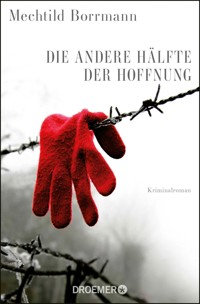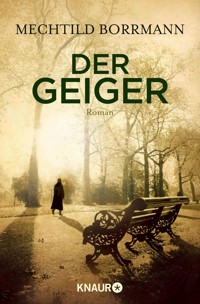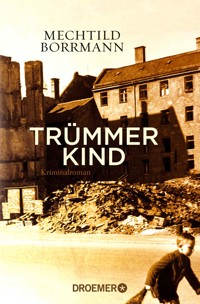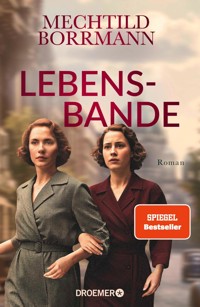
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitgeschichte trifft auf die verwobenen Schicksalsfäden dreier Frauen: Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann in ihrem großen zeitgeschichtlichen Roman »Lebensbande« die Lebensgeschichten dreier Frauen, deren Schicksale sich zwischen dem 2. Weltkrieg und dem Fall der Berliner Mauer kreuzen. Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Mauerfall verbinden die Fäden des Schicksals Lene, Nora und Lieselotte: Obwohl sie sich in einer Zeit der Angst und des Terrors als Fremde begegnen, werden sie zu Freundinnen, die einander Halt geben und große Risiken auf sich nehmen. Krankenschwester Nora tut alles, um Lene zu helfen, das Leben ihres kleinen Sohnes Leo zu retten. Denn wegen eines leichten Handicaps gilt Leo als »Reichsausschusskind«. 1942 lernt Nora Lieselotte in Danzig kennen. Drei Jahre später werden die Frauen in einen Gulag der Sowjetunion verschleppt – als Teil der 900.000 Arbeitskräfte, die Stalin unter anderem im Rahmen der Reparationszahlungen zugesichert worden waren. Als Adenauer 1949 beginnt, diese Deutschen zurückzukaufen, gibt Lieselotte alles auf, was sie noch hat, um Nora die Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen. Viele Jahre später, kurz nach dem Mauerfall, erhält diese einen verstörenden Brief, der sie schlagartig in die Vergangenheit zurückkatapultiert ... Zeitgeschichte, inspiriert von wahren Ereignissen und Schicksalen und so spannend erzählt wie ein Kriminalroman Mechtild Borrmann versteht es meisterlich, zutiefst menschliche Geschichten ohne Pathos zu erzählen. Auch in »Lebensbande« lässt die Bestseller-Autorin auf zwei Zeitebenen große Spannung entstehen. Erschütternd und trotzdem voller Hoffnung zeigt sie, wie eng große Tragik und zartes Glück beieinander liegen können. Entdecken Sie auch Mechtild Borrmanns andere zeitgeschichtliche Spannungsromane: - Der Geiger (Russland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Deutschland 2008) - Die andere Hälfte der Hoffnung (Tschernobyl 1986 bis 2010 und Deutschland 2010) - Trümmerkind (Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1992) - Grenzgänger (Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1970) - Feldpost (Kassel, ab 1935, während des 2. Weltkriegs und 2000)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mechtild Borrmann
Lebensbande
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vom Zweiten Weltkrieg bis zum Mauerfall verbinden die Fäden des Schicksals Lene, Nora und Lieselotte: Obwohl sie sich in einer Zeit der Angst und des Terrors als Fremde begegnen, werden sie zu Freundinnen, die einander Halt geben und große Risiken auf sich nehmen. Krankenschwester Nora tut alles, um Lene zu helfen, das Leben ihres kleinen Sohnes Leo zu retten. Denn wegen eines leichten Handicaps gilt Leo als »Reichsausschusskind«. 1942 lernt Nora Lieselotte in Danzig kennen. Drei Jahre später werden die Frauen in einen Gulag der Sowjetunion verschleppt – als Teil der 900000 Arbeitskräfte, die Stalin unter anderem im Rahmen der Reparationszahlungen zugesichert worden waren. Als Adenauer 1948 beginnt, diese Deutschen zurückzukaufen, gibt Lieselotte alles auf, was sie noch hat, um Nora die Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen. Viele Jahre später, kurz nach dem Mauerfall, erhält diese einen verstörenden Brief, der sie schlagartig in die Vergangenheit zurückkatapultiert ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Nachwort
Danksagung
Man bereut nie, was man getan, sondern immer, was man nicht getan hat.
Marc Aurel
Der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Ralph Waldo Emerson
Prolog
Freundschaft beginnt still mit Blicken und Gesten, dann erst kommen die Worte. In Kindertagen schließen wir Freundschaften leicht, finden sie auf Schulhöfen oder in der Nachbarschaft. Später im Leben sind sie seltener, und wenn sie von Wert sind, wachsen sie, werden stark und verbinden uns mit unsichtbaren Fäden über Zeit und Raum. Freundschaft ist Treue, die nicht einfordert, der einzige Mensch im Leben des anderen zu sein, sie braucht keinen Schwur vor einem Altar. Freundschaft ist gemeinsames Jubeln und Feiern, Trauern und Schweigen. Ihre Bewährungsprobe besteht sie in der Not.
Hier soll die Rede von drei Frauen sein. Von Freundschaften, die sich im Schatten der Geschichte beweisen mussten, die Geheimnisse gehütet, sich in Gefahr begeben und die eigene Freiheit für die anderen aufs Spiel gesetzt haben.
Und von Liebe soll die Rede sein. Liebe, die sich über Landesgrenzen und Völkerfeindschaften hinwegsetzt.
Aber lassen Sie uns von vorne beginnen. Zeichnen wir die Wege anhand der mündlichen Überlieferungen und schriftlichen Aufzeichnungen nach. Folgen wir den Fäden über sechzig Jahre bis in das Jahr 1993.
Kapitel 1
Das kleine Haus liegt geduckt auf einer Anhöhe. Vor hundertzwanzig Jahren gebaut, wird das Mauerwerk der Zeit weiterhin trotzen, aber die Fensterrahmen sind undicht und die Bretter in den Läden morsch. Im Winter verhängt sie die Küchentür mit einer Decke, damit der Ostwind die Kälte nicht ungehindert ins Haus schiebt.
Ihr ganzer Stolz ist der große Garten mit den Gemüsebeeten, den Apfelbäumen und Himbeer- und Johannisbeersträuchern. An der Umzäunung aus grobem Maschendraht blühen von Frühling bis Herbst Akelei, Fingerhut, Rittersporn und Stockrosen.
Fast dreißig Jahre wohnt sie hier oben. Im Kreiskrankenhaus Kühlungsborn hat sie gearbeitet und im Schwesternwohnheim gewohnt, bis sie Gustav kennenlernte. Mit Blinddarmentzündung war er eingeliefert worden, und sie hatte seinen Humor und seine optimistische, direkte Art sofort gemocht.
Schon einen Tag nach seiner Entlassung hatte er mit Blumen auf der Station gestanden. Einige Strandspaziergänge und Tanzabende später machte er ihr einen Antrag, und sie war zu ihm in diese alte Katstelle gezogen, die früher zu einem großen Hof gehört hatte. Damals stellte man das Häuschen einem fest angestellten Landarbeiter zur Verfügung, der sich mit dem kleinen Stück Land selbst versorgte oder mit dem Verkauf von Gemüse ein kleines Zubrot erwirtschaften konnte.
Gustav arbeitete als Landmaschinenmechaniker in der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft der DDR, die es heute nicht mehr gab, und sie fuhr die acht Kilometer zum Kreiskrankenhaus in den ersten beiden Jahren mit dem Rad. Dann besorgte Gustav ihr einen Pitty-Motorroller.
Sie steckten Zeit, Arbeit, Geld und gute Kontakte in ihr kleines Zuhause. Zunächst noch mit Brunnen und Pumpe im Garten, bekamen sie 1970 einen Wasseranschluss, und Gustav baute mit Freunden ein Bad mit Sitzwanne und großem Boiler an.
Den Boiler muss sie bis heute mit Holz befeuern, ein Aufwand, den sie nur noch selten betreibt.
Es war eine gute Ehe gewesen. Sie hatten einander vertraut und ein Leben mit vielen glücklichen Momenten geführt.
Dann war vor acht Jahren Gustavs Krebsdiagnose gekommen. Neun Monate hatte er noch durchgehalten.
Wochenlang lebte sie unter dem schwarzen Tuch der Trauer. Wie betäubt saß sie Tag für Tag am Küchentisch, sah zu, wie der Garten verwilderte und das Haus verwahrloste. Trude, ihre ehemalige Kollegin und beste Freundin, war es, die sie aus diesem Dämmerzustand herausholte.
»Gustav würde sich im Grabe umdrehen, wenn er dich und sein kleines Häuschen in diesem Zustand sehen könnte«, schimpfte sie.
Sie war in Tränen ausgebrochen, hatte endlich um Gustav und auch um sich geweint.
In den Tagen danach brachten sie zusammen erst das Haus und anschließend den Garten in Ordnung.
Die Instandhaltung des Hauses ist mit ihrer kleinen Rente nicht einfach. Größere Reparaturen kann sie sich nicht mehr leisten.
Vor drei Jahren war das Reetdach undicht gewesen. Eimer und Schüsseln standen in der Küche und im Schlafzimmer, um das Wasser bei Regen aufzufangen. Alfons, Trudes Mann, hatte Reetbündel organisiert, und Bernd Scholten, der im Dorf wohnt und in einer Dachdeckerei in Kühlungsborn arbeitet, hatte ihr den Schaden repariert.
Sie sitzt am Küchentisch mit der karierten Wachstuchdecke. Die braunen Brandspuren von vergessenen Zigaretten liegen wie Würmer rund um den Aschenbecher. Von hier aus hat sie einen freien Blick auf die Ostsee.
Seit es die Mauer nicht mehr gibt, hat sich viel verändert, und im ersten Jahr war sie sehr verunsichert gewesen. Was würde jetzt kommen?
Inzwischen fahren auf den schmalen Straßen und Alleen große Westautos, in Kühlungsborn und Rerik wird gebaut, renoviert und saniert. Baumaterial ist für die, die es sich leisten können, keine Mangelware mehr, und überall herrscht diese unruhige Geschäftigkeit.
Alfons hatte bei seinem letzten Besuch von Investoren aus dem Westen gesprochen.
»Bald gibt es hier nur noch Hotels und Ferienanlagen. Dann wird es vorbei sein mit deiner Ruhe und dem schönen Blick aufs Wasser. Wirst schon sehen, die machen dir bald ein Angebot für dein Grundstück«, hatte er gesagt.
»Die sollen nur kommen mit ihren Angeboten. Ich geh hier nicht weg«, hatte sie trotzig geantwortet.
Wenn sie in ihrem Garten beschäftigt ist oder auf der Bank unter den beiden Apfelbäumen sitzt und auf die Ostsee schaut, kommen ihr manchmal Bilder von Hotelklötzen am Wasser, die ihr den Blick auf das Meer verstellen, oder von einer Ferienhaussiedlung, die die Anhöhe hinaufkriecht und bis an ihr Grundstück reicht.
Sie schiebt die graue Strähne hinters Ohr, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hat, und zieht die bauchige Porzellankanne zu sich heran. Das Sieb mit den getrockneten Hagebutten lässt sie kurz abtropfen und gießt sich Tee ein.
Pepe liegt neben ihr auf dem abgetretenen Fußboden aus Eichenbrettern. Den großen Mischlingshund hat sie vor vier Jahren, halb verhungert und mit einer Glasscherbe im Hinterlauf, neben ihrem Geräteschuppen gefunden. Sie hatte die Wunde versorgt und ihn aufgepäppelt. Seither ist Pepe, der wohl zur Hälfte von einem Labrador abstammt, treu an ihrer Seite.
Sie rührt Zucker in ihren Tee.
»Weißt du, Pepe, vielleicht hat Alfons übertrieben. Ich meine, in den FDGB-Erholungsheimen, den Pensionen und auf den Campingplätzen unten am Wasser waren schon immer viele Sommergäste, wenn die Gewerkschaft die Angestellten und Arbeiter in den wohlverdienten Urlaub schickte. Wahrscheinlich wird sich gar nicht so viel ändern.«
Sie nimmt einen Schluck Tee und zündet sich eine Juwel an.
Im Westfernsehen hatte sie zugesehen, wie die Menschen vor zwei Jahren in Berlin auf die Mauer geklettert waren. Sie hatte an den Aufstand von 1953 gedacht und Pepe zugeflüstert: »Das wird nicht gut gehen. Da werden die Panzer nicht mehr lange auf sich warten lassen.«
Erst später, als die Beobachtungstürme am Wasser nicht mehr besetzt, die Lastwagen mit den Suchscheinwerfern und die Patrouillenschiffe fort waren, hatte sie den Fernsehbildern geglaubt.
Wochenlang schlief sie schlecht. Was würde jetzt passieren? Wie würde es weitergehen? Aber ihr abgeschiedenes Leben hier oben veränderte sich kaum. Inzwischen zahlte sie mit D-Mark, und die Kaufhalle in Kühlungsborn hieß jetzt Supermarkt. Sie musste nicht mehr anstehen, und die Regale waren randvoll mit Waren, die sie sich nicht leisten und bis auf einige Konserven auch nicht brauchen konnte. Ihr Alltag war unangetastet geblieben.
Nur manchmal, wenn der Gedanke auftaucht, dass sie jetzt ungehindert in den Westen reisen kann, wird sie unruhig und sucht nach Ablenkung.
In all den Jahren, in denen eine solche Reise unmöglich gewesen war, hatte sie gedacht, dass sie gerne noch einmal nach Hause fahren würde.
In ihrer Vorstellung war der kleine Ort bei Bonn noch genauso, wie sie ihn verlassen hatte. Selbst die Menschen lebten dort, ohne gealtert zu sein, wie vor über fünfzig Jahren. Fachwerkhäuser, die sich um Kirche und Dorfplatz drängten, verstreute Höfe, die sich zwischen Hügeln duckten. Ihrem Elternhaus gegenüber die Schule, johlende Kinder stießen mittags das Portal auf, rannten über den Hof und verschwanden in Hauseingängen oder in Richtung Nachbardorf und Bauernhöfe. Sonntage, an denen die Familien in ihren guten Kleidern über den Dorfplatz gingen und sich in der Kirche versammelten. Sie bekreuzigten sich, knieten in den Bänken nieder, und wenn sie sich erhoben, füllten Orgelmusik und Gesang das Gotteshaus. Im Winter roch es nach Weihrauch und feuchten Mänteln, und im Spätsommer, wenn die Predigt sich allzu lange hinzog, scharrten die Bauern unruhig mit den Füßen und husteten demonstrativ, weil sie – heiliger Sonntag hin oder her – die Ernte einbringen mussten.
Stillgestandene Zeit! Bilder, mit Weichzeichner nachbearbeitet, in die sie sich so manches Mal geflüchtet hatte, die sie wie einen Schatz gehütet hatte.
Aber jetzt waren Mauer und Grenzzäune gefallen, und mit ihnen die fantasierte Idylle. So würde es nicht mehr sein.
»Und überhaupt, was soll ich dort?«, fragt sie Pepe. Sie drückt die Zigarette im Aschenbecher aus, beugt sich hinunter und streicht dem Hund über den Kopf. »Besser, man lässt die Vergangenheit ruhen.«
Mit der Teetasse geht sie zur Spüle. Das Becken ist aus Steingut. Gustav hatte zwischen Gasherd und Spüle einen Arbeitstisch aus einer Furnierplatte montiert, und an der hinteren Wand, neben der Tür zum Wohnzimmer, stehen der Kohleofen und der alte Küchenschrank. Der Kamin liegt zwischen Küche und Wohnraum, sodass er im Winter beide Zimmer beheizt.
»Na komm, wir haben zu tun!«, ruft sie dem Hund zu und zieht ihre Strickjacke über.
Es ist früh am Tag. Im Garten haben sich Tautropfen auf den feinen Spinnennetzen zwischen den verblühten Stockrosen gesammelt. Diamantensplitter, die im Morgenlicht funkeln. Rosenkohl, späte Kartoffeln, Rote Bete und die letzten Zwiebeln stehen noch im Gemüsegarten.
Sie zieht die Strickjacke enger um ihren dürren Körper, verknotet den Gürtel und holt aus dem Schuppen die Schubkarre und einen kleinen Weidenkorb.
Der Wind hat in der Nacht gedreht und kündigt den ersten Herbststurm an.
Sie lehnt die Leiter an einen der Äste, steigt hinauf, hängt den Korb mit einem Metallhaken an die obere Sprosse und pflückt Apfel für Apfel. Sie ist immer noch beweglich, arbeitet behänd und konzentriert. Regelmäßig legt sie eine kleine Pause ein, setzt sich auf die Gartenbank, raucht und trinkt von dem kalten Tee. Gegen Mittag ist die Schubkarre voll mit Äpfeln.
»Die letzten überlassen wir dem Sturm und kochen Apfelmus«, erklärt sie Pepe, der unter dem Baum geduldig gewartet hat.
Vor dem Abendessen nimmt sie den Briefkastenschlüssel und geht mit dem Hund ihre tägliche Runde. Der Postbote hatte sich vor Jahren beschwert, weil der schmale Weg zum Haus bei Regen und Schneeschmelze nicht befahrbar war, und Gustav hatte den Briefkasten an der hundert Meter entfernten Straße aufgestellt.
Werbung! Das war auch neu, dass man ihren Briefkasten mit all diesen Kaufangeboten befüllte. Ihr ist es recht, das Papier kann sie zum Anfeuern gebrauchen. Heute ist auch ein Brief dabei. Von der LVA Mecklenburg-Vorpommern. Davon hat sie noch nie gehört.
»Was habe ich denn mit denen zu schaffen, und wer sind die überhaupt?«, knurrt sie und öffnet ihn. Sie steht ganz still, liest immer wieder, ohne zu begreifen. »Zusammenführungen der Rentensysteme … liegen uns keine Nachweise zu Ihren Tätigkeiten vor 1953 vor … bitten wir Sie, diese nachzureichen.«
Ein weiteres Blatt mit einer Aufstellung über ihre Berufsjahre ab 1953 ist dem Schreiben beigefügt. Sie überfliegt die Seite und lehnt sich an den Stamm der alten Birke, versucht, ruhig gegen den aufkommenden Schwindel anzuatmen.
Oh Gott! Wie sollte sie …? Jetzt war es also so weit. Jetzt holte die Vergangenheit sie ein.
Pepe, der dicht neben ihr steht, spürt, dass etwas nicht stimmt, und fiept.
Als sie sich gefangen hat, steckt sie die Post zurück in den Briefkasten und überquert die Straße in das angrenzende Waldstück.
Sie muss nachdenken. Im Gehen kann sie am besten denken. Pepe läuft voraus.
Kapitel 2
Es war der Sonntag nach Kreuzerhöhung, und in wenigen Stunden würde die jährliche Prozession durch die Straßen von Kranenburg ziehen. Magdalene Gertens lief aufgeregt die steile, schmale Treppe hinunter in die Küche. Nach einer verregneten kalten Woche hatte der Sommer sich vor zwei Tagen noch einmal zurückgemeldet, und der Umzug würde unter einem makellos blauen Himmel stattfinden. Wie jedes Jahr waren bereits viele Pilger in der Stadt und die Häuser am Vortag mit Fahnen und Blumen geschmückt worden.
Aber nicht wegen der Prozession war Lene voller Vorfreude. Heute war auch ihr siebzehnter Geburtstag, und am Abend durfte sie zum ersten Mal mit ihrem Bruder Karl ins Hotel De groote Musschenberg in Wyler zum Tanz.
Die Eltern waren seit fünf Uhr im Kuhstall, und es war ihre Aufgabe, den Küchenherd anzufeuern, Wasser vom Brunnen zu holen, die Hühner zu versorgen und die morgendliche Milchsuppe aufzusetzen.
Sie hockte vor dem Herd und blies die schwache Glut unter den Spänen an, als ihr Bruder Karl mit einem kurzen verschlafenen »Morgen« an ihr vorbeiging und die Hosenträger über die Schultern zog. An der Küchentür schnappte er die Jacke vom Haken, schlüpfte in die Holzpantinen und machte sich auf den Weg zum Schweinestall.
Karl war drei Jahre älter und seit einigen Wochen mit Elisabeth vom Hesselhof verlobt.
Das Frühstück an dem schweren Küchentisch verlief wie immer wortkarg. Der Vater sprach das Tischgebet, und dann löffelten alle schweigend die Milchsuppe. Lene dachte enttäuscht, dass sie ihren Geburtstag wohl vergessen hatten, aber dann stand die Mutter auf und reichte ihr ein kleines, in braunes Papier gewickeltes Päckchen.
»Für dich zum Geburtstag«, sagte sie und setzte sich wieder an ihre Suppe. Lene bedankte sich, wickelte das Papier vorsichtig auf und hielt einen zwanzig Zentimeter breiten Streifen schwarzen Samt in Händen.
»Du hast es nicht vergessen«, rief sie, drückte das Geschenk ans Gesicht, fühlte den weichen Stoff an der Wange und saugte den fremden Geruch ein. »Danke! Ich danke euch ganz herzlich!«
Im Sommer war sie mit der Mutter in Kleve gewesen und hatte in einem Schaufenster ein Kleid mit einem breiten, eckigen Samtkragen gesehen.
»Der ist aber schön«, hatte sie gesagt, »mit so einem Kragen würde mein gutes Kleid bestimmt auch so fein aussehen.«
Jetzt legte sie sich den Samtstreifen um die Schultern: »Ich nähe ihn gleich heute Nachmittag auf das Kleid.«
Nach dem Frühstück zogen sie sich alle für die Prozession um. Die drei Kilometer von Newing bis Kranenburg gingen sie zu Fuß. Die Häuser der kleinen Stadt standen geduckt zwischen der Kirche St. Peter und Paul und der Mühle. Der Kirchplatz war überfüllt, die Menschen standen an den Straßenrändern, um sich nach und nach hinter einem der Altäre, die von sechs Männern auf den Schultern durch die geschmückten Straßen getragen wurden, einzureihen. Ganz vorne, direkt hinter dem großen Holzkreuz, schritt der Pfarrer. Die goldenen Stickereien auf seinem Gewand glitzerten in der Sonne. Neben ihm trugen Ministranten Rauchfässer, und der süßliche Duft von Weihrauch füllte die Straßen. An mit Astern und Dahlien geschmückten Hausaltären vorbei ging Lene zwischen ihren Eltern und dem Bruder, murmelte die angestimmten Lieder und Gebete mechanisch mit und war in Gedanken mit ihrem ersten Tanzabend beschäftigt.
Nach dem Mittagessen schneiderte sie aus dem Samt einen Kragen und nähte ihn auf ihr tannengrünes Kleid. Sie brauchte sehr viel länger, als sie erwartet hatte, und als ihr Bruder sie ermahnte: »Lene, Elisabeth wird gleich hier sein. Dann wollen wir los!«, war sie mit den letzten Stichen beschäftigt.
Eilig zog sie das Kleid über, flocht ihr braunes Haar zu einem dicken Seitenzopf. Zu dritt fuhren sie mit den Fahrrädern von Newing nach Wyler.
Vor dem Hotel standen junge Leute in kleinen Gruppen zusammen. Die Männer rauchten, hier und da hörte man helles Lachen, und aus dem Saal drang leise Musik auf den Vorplatz. Einige Bekannte aus den Nachbardörfern und Kranenburg waren da, von denen sie fröhlich begrüßt wurden.
»Die kleine Lene«, rief Heinrich vom Nachbarhof neckend, »darfst du denn schon zum Tanz?«
Das Hotel lag unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden und wurde von Holländern und Deutschen besucht. Am Grenzübergang gab es Zöllner, aber man kannte sich und konnte ohne Passkontrollen in beide Richtungen passieren.
Als sie den Saal betraten, blieb Lene andächtig stehen. Die hohen stuckverzierten Decken, die Musiker in schwarzen Anzügen auf dem Podest, die schweren Brokatvorhänge an den großen Fenstern, der blanke Parkettfußboden. Eingeschüchtert und erwartungsvoll blickte sie sich um.
Karl fasste sie am Arm und führte sie an einen langen Tisch, abseits der Tanzfläche, wo einige Nachbarn und Freunde saßen. An der Theke holte er ein Bier und Limonade für Lene und Elisabeth.
Lene entdeckte ihre Freundin Dorothea Bürger mit ihren älteren Geschwistern an einem der Tische und winkte ihr zu.
Es dauerte nicht lange, da wurde sie von Gerhard Bürger zum Tanz aufgefordert. Unsicher sah sie ihren Bruder an, der wohlwollend nickte.
Gerhard hielt sie eng an sich gedrückt, redete ununterbrochen und zeigte wenig Gespür für die Musik. Lene hatte zu Hause mit Karl geübt, aber jetzt wurde sie in den Armen von Gerhard immer steifer, versuchte, sich führen zu lassen, und war froh, als die Kapelle eine Pause einlegte und er sie an den Tisch zurückbrachte.
Als die Musik erneut einsetzte, tanzte Karl mit Elisabeth.
Ein junger Holländer kam an ihren Tisch, verbeugte sich und bat Lene um den Tanz. Sie zögerte, wusste nicht, ob es sich gehörte, mit jemandem zu tanzen, den ihr Bruder nicht begutachtet und für würdig befunden hatte, ging dann aber mit.
Unsicher machte sie die ersten Tanzschritte, doch der junge Mann, der sich als Joop de Jong vorstellte, führte sie wie selbstverständlich über die Tanzfläche. Er redete nicht, wie Gerhard es getan hatte, sondern gab sich ganz der Musik hin.
Es gelang Lene, ihre Angespanntheit abzustreifen und sich voll und ganz auf Joop und den Tanz einzulassen, und bald genoss sie die Schwerelosigkeit der Drehungen.
Zur Pause brachte er sie an ihren Tisch zurück, nur um sie beim erneuten Einsetzen der Musik sofort wieder aufzufordern.
Später stand sie mit ihm vor dem Hotel. Es war bereits dunkel, aber der Abend war noch angenehm mild. Er rauchte, sagte, dass er aus Groesbeek käme, Schreiner sei und in der Werkstatt seines Vaters gearbeitet habe.
»Maar nu werk ik in die Margarinefabrik van den Bergh in Kellen«, mischte er Deutsch und Holländisch.
Er war einen ganzen Kopf größer. Sie mochte seinen angenehmen Bariton, mochte den holländischen Akzent, sah, wie er mit den Händen nach der passenden Umschreibung suchte, wenn ihm das deutsche Wort nicht gleich einfallen wollte. Sie hörte sein unbekümmertes Lachen, mochte seinen konzentriert fragenden Blick, wenn er ihr ein holländisches Wort anbot und sie versuchte, es zu übersetzen. Da war eine neue, unbekannte Leichtigkeit, und sie wollte hier neben ihm stehen bleiben oder ins Hotel zurückkehren und immer wieder mit ihm tanzen.
Als sie den Saal wieder betraten, reichte Karl ihr ihre Strickjacke.
»Wir müssen los. Morgen ist um fünf Uhr Tag«, sagte er, bedachte Joop mit einem kurzen Nicken und ging mit Elisabeth voraus zum Ausgang.
Sie hielt sich an ihrer Jacke fest und trat unsicher von einem Bein auf das andere. Sie wollte ihn fragen, ob sie sich wiedersehen würden, aber das schickte sich nicht für ein Mädchen. Sie sollte jetzt besser gehen. Steif streckte sie ihm die Hand entgegen, und als er sie nahm, zog er sie näher zu sich heran.
»Darf ich dich wiedersehen?«, flüsterte er, und Lene stieg die Röte ins Gesicht vor Freude.
Sie verabredeten sich für den kommenden Samstag. Er bot an, sie zu Hause abzuholen, aber sie schüttelte den Kopf.
Nein, sie würde mittags in Kellen am Werktor sein.
Auf dem Weg zu ihrem Fahrrad dachte sie, dass eine solche Verabredung im Anschluss an einen ersten Tanzabend für ein junges Mädchen sicher nicht passend war, aber da war diese unbändige Freude in ihr, die alle Regeln außer Kraft setzte.
Auf dem Rückweg fuhr sie zwischen Elisabeth und Karl.
»Hat es dir gefallen?«, fragte Karl.
Als sie strahlend nickte, sagte Elisabeth: »Dieser Joop, der ist auf allen Festen. Der hat keinen guten Ruf. Das ist ein richtiger Schürzenjäger.«
Lene fühlte, wie ihr Magen sich zusammenzog. Sie schluckte und versuchte, ihre Enttäuschung hinter einem Lächeln zu verbergen.
»Weiß ich doch!«, antwortete sie trotzig.
Drei Tage kämpfte sie mit Elisabeths Bemerkung und war entschlossen, am Samstag nicht nach Kleve zu fahren, aber schon am Donnerstag fand sie Gründe, ihn doch wiederzusehen. Vielleicht war er in der Vergangenheit auf der Suche nach der Richtigen gewesen? Das machten junge Männer doch so. Ihr Bruder hatte bestimmt auf etlichen Festen mit anderen Mädchen getanzt und sicher auch geflirtet, bevor er sich für Elisabeth entschied. Außerdem, sie würde es schon merken, wenn er es nicht ernst mit ihr meinte.
Am Samstag warf sie alle Bedenken über Bord, erklärte zu Hause, dass sie Dorothea besuchen wolle, und schnappte sich ihr Rad.
Am Werktor winkte der Pförtner sie zu sich und fragte: »Kann ich was für das Fräulein tun?«
»Ich warte nur auf jemanden«, antwortete sie und wurde puterrot, als er ihr zuzwinkerte und breit grinste.
Pünktlich um drei Uhr ertönte die Werksirene, und etwa fünfzig Menschen verließen die Fabrik, gingen zu abgestellten Fahrrädern oder verließen zu Fuß das Gelände. Sie hielt Ausschau nach ihm, konnte ihn aber nicht entdecken. Langsam leerte sich der Fabrikhof, und sie dachte: Ich bin so dumm! Elisabeth hatte recht.
»Je bent gekomen«, hörte sie es von links rufen. Er schob sein Rad, winkte und strahlte sie an.
Sie fuhren in Richtung Kranenburg, stellten auf halber Strecke die Fahrräder an einer Birke ab und spazierten zwischen Wiesen und abgeernteten Feldern. Er erzählte von der Fabrik, von seinem Zuhause, den beiden jüngeren Geschwistern und der Schreinerei seines Vaters, wo er abends aushalf.
»Die Zeiten sind schlecht«, sagte er, »die Leute haben kein Geld für neue Möbel. Wir brauchen den Fabriklohn.«
Sie sprach von der Arbeit auf dem kleinen Hof und davon, dass die Eltern nur sie und den Bruder hatten.
»Die Mutter hat viele Fehlgeburten gehabt. Vater wird demnächst sechzig, und Mutter ist zweiundfünfzig. Sie haben nur uns beide und brauchen uns auf dem Hof.«
Dass ihre Eltern klare Vorstellungen von ihrer Zukunft hatten und sich für sie eine Ehe mit einem Bauernsohn wünschten, sagte sie nicht.
Später nahm er ihre Hand, und sie gingen schweigend nebeneinander. Saatkrähen flogen auf, krächzten über Stoppelfelder und frisch gepflügte Äcker auf der Suche nach letzten Getreidekörnern. In der Ferne blökten Schafe. Er roch nach frisch gesägtem Holz, und Lene meinte, noch nie eine solche Vertrautheit gespürt zu haben.
Es begann schon zu dämmern, als sie sich auf den Rückweg machten.
Die Samstagnachmittage wurden für einige Wochen ihre Zeit. Ihr heimliches Glück. Wenn Joop sie fragte, warum er sie nicht nach Hause bringen dürfe, wich sie aus, bat um Geduld.
Ende Oktober sahen sie zu, wie Schwärme von Wildgänsen sich in den Wiesen der Düffel niederließen und mit ihnen der Winter Einzug hielt.
Einmal fuhren sie zu Joop nach Hause, und sie lernte seine Eltern und die beiden Geschwister Ineke und Marten kennen. Sie wurde freundlich empfangen, und später führten Vater und Sohn sie voller Stolz durch die Werkstatt.
Manchmal, wenn das Wetter allzu schlecht war, besuchten sie ein kleines Lokal in Kleve, hielten sich zwei Stunden bei einer Limo und einem Bier auf, obwohl sie sich das eigentlich nicht leisten konnten.
Die Tage zwischen ihren Treffen waren randvoll mit Arbeit. Obst und Gemüse ernten und einkochen, die Felder für den Winter vorbereiten und der tägliche Haushalt. Alles ging ihr leicht von der Hand, alles erledigte sie mit der Vorfreude auf die Samstage.
Ende November sagte Joop zum Abschied: »Lene, ich …« Er machte eine kleine Pause: »Ik denk, dat ik altijd op je heb gewacht.«
»Und ich habe auf dich gewartet«, erwiderte sie.
Ein Moment voller Glück. Ein Moment voller Kummer.
Dass Joop gesagt hatte, er habe schon immer auf sie gewartet, ließ sie strahlen, aber es bedrückte sie, dass sie ihre Eltern hinterging. Sie wusste, dass sie mit einem Fabrikarbeiter als Schwiegersohn nicht einverstanden wären. Anton Gertens verlangte Gehorsam von seinen Kindern.
Er hatte ihr gesagt: »Nachbarhöfe mit Söhnen gibt es genug. Da wird sich schon einer finden, der dir gefällt.«
Und die Mutter pflegte zu sagen: »Liebe vergeht, Hektar besteht!«
An Silvester verabredete sie sich mit Joop in einer Gaststätte in Kranenburg. Lene ging mit ihrer Freundin Dorothea und deren Brüdern hin, und sie würde so tun, als träfen sie Joop dort ganz zufällig.
Es war ein schöner Abend. Die Uhr zeigte bereits elf, und sie tanzten, als Lene Karl und Elisabeth, die eigentlich in Wyler feiern wollten, an der Theke entdeckte. Karl blickte voller Zorn zu ihr herüber. Lene stand stocksteif vor Schreck.
Joop nahm ihre Hand und ging mit ihr auf die beiden zu. Er legte den linken Arm um Lene und hielt Karl seine rechte Hand hin.
»Ich bin Joop de Jong. Freut mich, dich kennenzulernen.«
Karl starrte ihn an. Schweigen. Im Saal wurde ein Foxtrott gespielt.
Karl ignorierte Joops Hand und zischte seine Schwester an: »Dann stimmt es also, was erzählt wird. Du triffst dich seit Wochen mit ihm und belügst die Eltern.« Er packte Joop am Kragen. »Lass die Finger von ihr! Unsere Eltern werden das nie erlauben!«
Die Gäste um sie herum wichen erschrocken zurück.
Karl ließ Joop los, nahm Elisabeths Arm und verließ das Lokal.
Lene stand ganz still. Die fröhliche Musik klang in ihren Ohren wie Gelächter. Joop holte ihre Mäntel und führte sie hinaus. Die kalte, klare Winterluft biss ihr ins Gesicht. Sie war zu Fuß gekommen. Er brachte sie nach Hause, schob sein Fahrrad, während sie nebeneinander hergingen. Lene wischte sich immer wieder mit ihren Händen, die in Wollhandschuhen steckten, die Tränen von den Wangen, während sie ihm endlich erzählte, dass die Eltern sich einen Bauern als Schwiegersohn wünschten.
Sie standen fünfzig Meter vor der Hofeinfahrt zum Gertenshof in der Kälte, als die Kirchenglocken das neue Jahr verkündeten.
»Frohes neues Jahr«, flüsterte Joop ihr ins Ohr, und sie begann, hemmungslos zu weinen. Er zog sie fest an sich und sagte: »Ich rede mit deinem Vater. Ich bin doch Schreiner, und sobald die Zeiten besser sind, werde ich wieder zu Hause in der Werkstatt arbeiten.« Er lächelte sie an. »Dann kann ich gut für eine Familie sorgen.«
Als sie das Haus betrat, waren die Eltern schon zu Bett gegangen und ihr Bruder noch nicht zu Hause.
Karl hatte am Neujahrsmorgen wohl schon im Stall mit den Eltern gesprochen. Lenes vorsichtiges »Frohes neues Jahr« erwiderten sie nicht.
Anton Gertens sprach am Frühstückstisch das Tischgebet. Nach dem »Amen« wandte er sich übergangslos, zunächst leise, dann immer lauter werdend, an Lene.
Sie saß mit gesenktem Kopf, starrte in ihre Milchsuppe und schluckte angestrengt an den aufkommenden Tränen, während er brüllte. Dass sie die Eltern belogen und monatelang hintergangen habe. Dass sie sich wie eine Dirne benommen habe. Dass er sich für so eine Tochter schäme.
»Und dieser Kerl ist ohne Anstand! Ein Hallodri, der ein junges Mädchen überredet, seine Eltern zu belügen«, schimpfte er.
Sie nahm allen Mut zusammen, hob den Kopf und sagte: »Aber das stimmt nicht. Er hat das nicht verlangt. Ich wollte es euch noch nicht sagen, weil ich dachte …«
Weiter kam sie nicht. Die Hand des Vaters schnellte über den Tisch und klatschte auf ihre rechte Wange. Er stand auf.
»Wage es auch noch, Widerworte zu geben!«, brüllte er, zog sie vom Stuhl und schlug auf sie ein.
Karl ging dazwischen.
An der Tür drehte der Vater sich noch einmal um. »Du wirst das Haus in nächster Zeit nicht alleine verlassen! Und zur Neujahrsmesse kommst du auch nicht mit. Du trittst nicht vor den Herrn, bevor du nicht alles gebeichtet hast.« Er knallte die Tür hinter sich zu.
Die Mutter half ihr auf und flüsterte: »Mein Gott, Kind, ich hoffe nur, dass du keine noch größere Dummheit gemacht hast«, und Lene verstand nicht, was sie meinte.
Die erste Woche des neuen Jahres war ohne Farben. Am Montag schneite es ununterbrochen, der Himmel hing tief und schwer, das Land verlor sich zwischen Weiß und Grau.
Sie ging wie betäubt durch die Tage, erledigte ihre Arbeiten mechanisch, mied die Eltern und Karl und sprach kaum ein Wort.
Am Samstagnachmittag schälte sie Kartoffeln, als Joop auf den Hof gefahren kam und vom Rad stieg. Sie klopfte ans Küchenfenster, aber er hörte sie nicht, denn gleichzeitig kam ihr Vater aus der Scheune gelaufen und schimpfte schon von Weitem: »Dass du es wagst, meinen Hof zu betreten …«
Dann hatte er Joop erreicht. Was er weiter sagte, konnte sie nicht verstehen. Sie sah, wie er an Joops Lenker rüttelte und mit ausgestrecktem Arm Richtung Straße zeigte. Sie sah, wie Joop immer wieder den Kopf schüttelte und versuchte, zu Wort zu kommen, und sie sah, wie er schließlich sein Fahrrad anhob, es umdrehte und davonfuhr.
Minutenlang stand sie da, eine Kartoffel in der einen und das Küchenmesser in der anderen Hand. Dann ließ sie beides in die Schüssel fallen und ging die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Sie legte sich aufs Bett, schloss die Augen und sah immer wieder, wie Joop sein Fahrrad umdrehte und davonfuhr.
In den Tagen danach verließ sie ihr Zimmer nicht. Die Mutter schimpfte und flehte, brachte ihr Suppe oder Brote ans Bett, aber sie aß kaum davon. Nach zwei Wochen zog Maria Gertens den Koffer vom Schrank und packte Lenes Kleidung zusammen.
»Du fährst zu Tante Grete und Onkel Hubert nach Ratingen«, erklärte sie. »Grete hat eine Stellung als Hausmädchen für dich gefunden. Vielleicht kommst du da endlich zur Vernunft und lernst Gehorsam.«
Lene nahm es hin.
Der Vater war im Stall und verabschiedete sich nicht von ihr, als Karl sie am 18. Januar 1932 zum Bahnhof brachte.
Kapitel 3
Der erste Herbststurm jagt von Osten übers Meer. In der Nacht schlägt etwas rhythmisch gegen die Hauswand. Ein Geräusch, das sich in ihren Traum schleicht und zu einer Faust wird. Eine Faust, die gegen eine Tür hämmert, und eine Stimme, die »Otkrojte dver! Otkrojte dver!« fordert.
Augenblicklich schreckt sie hoch, schnappt nach Luft, braucht einen Moment, um sich zu orientieren.
Der Wecker zeigt vier Uhr. Sie steht auf, schlüpft in graue Filzpantoffeln und zieht den ausgewaschenen blassroten Frotteemantel über.
Pepe liegt auf seiner Decke neben dem kalten Ofen. Er hebt den Kopf, als sie das Licht in der Küche einschaltet.
Es ist einer der Läden am Küchenfenster, den der Wind gegen die Hauswand schlägt. Mit Papier und Holzspänen zündet sie den Ofen an und streichelt den Hund. Das leise Knistern des Feuers und die gleichmäßige Bewegung ihrer Hand über das warme Fell beruhigen sie.
»Gleich wird es warm«, flüstert sie ihm zu.
Sie legt Briketts nach, wickelt den breiten Wollschal um die Schultern und geht hinaus. Am Fensterladen ist der untere Eisenbeschlag aus dem morschen Holz gebrochen. Mit einem Ruck zieht sie den Laden zu sich heran und bricht auch die obere Halterung heraus.
Endlich Ruhe! Sie atmet tief durch, dann begutachtet sie die schweren, in der Mauer verankerten Scharniere. Sie sind unbeschadet. Die morschen Bretter kann sie später ersetzen.
Der Wind bläst ihr die Kälte durch Schal, Frotteestoff und Schlafanzug bis auf die Knochen.
Durchgefroren kehrt sie ins Haus zurück, füllt den Wasserkessel und stellt ihn auf den Herd.
Seit der Brief von der Rentenversicherung gekommen ist, schläft sie schlecht. Die Jahre, die sie versucht hat zu vergessen, stehen jetzt Nacht für Nacht in ihrer Kammer, steigen in ihr Bett und annektieren ihre Träume.
Das Schreiben hat sie gleich nach dem Spaziergang mit Pepe ganz hinten in die Küchenschublade gelegt und entschieden, nicht darauf zu reagieren. Die kleine Rente, die sie bisher bekommt, wird man ihr nicht streitig machen können. Die steht ihr zu. Die hat sie sich in den Jahren im Krankenhaus erarbeitet. Sie braucht keine neue Berechnung. Sie will nicht mehr Geld! Sie will ihre Ruhe!
Dennoch lässt sie der Gedanke, dass ihre Angaben, Geburtsname, Geburtsdatum und Geburtsort, jetzt auch in Westdeutschland erfasst sind, nicht mehr los. Was, wenn es jemandem auffällt?
Der Kessel pfeift. Sie füllt getrocknete Minzblätter in das Teesieb, gießt Wasser in die Kanne.
Später sitzt sie am Küchentisch, raucht, verliert sich in den Karos der Wachstuchdecke und hört sich vierzig Jahre zuvor sagen: »Ich finde ihn und werde ihm alles erzählen. Ich verspreche es dir! «
Mit einem kurzen schrillen Lachen versucht sie, die aufkommende Traurigkeit zu verjagen. Pepe springt auf, legt seinen Kopf auf ihren Schoß.
»Schon gut«, flüstert sie.
Nur Gustav hatte ihre Vergangenheit gekannt.
Sie steht auf und füllt Pepes Fressnapf.
Gegen Mittag hat sich der Sturm gelegt, sogar die Sonne blitzt ab und an hervor.
Im Schuppen findet sie ein geeignetes Brett, repariert den Fensterladen und schraubt ihn wieder an. Anschließend sammelt sie die Äpfel auf, die der Sturm vom Baum geschüttelt hat.
Nachmittags geht sie mit Pepe die fünf Kilometer zu Fuß nach Kühlungsborn. Auf dem Weg denkt sie darüber nach, alles aufzuschreiben.
Sie kauft Milch, Zucker, Mehl und Hefe und gönnt sich ein Stück Camembert. Dann steht sie an dem Ständer mit den Schreibwaren. Unschlüssig nimmt sie Schulhefte in verschiedenen Größen zur Hand, zählt die Seiten, legt sie wieder zurück, vergleicht Seitenzahlen mit Preisen. Schließlich packt sie ein DIN-A4-Schreibheft zu ihrem Einkauf.
Auf dem Rückweg überholt Bernd Scholten sie mit einem Transporter der Dachdeckerei. Er hält an und steigt aus.
»Soll ich dich mitnehmen?«
»Das ist nett von dir, aber Pepe steigt in kein Auto. Der hat da wohl schlechte Erfahrungen gemacht.«
Ob sie den nächtlichen Sturm gut überstanden hat, fragt er. »Ist am Haus alles in Ordnung?«
Sie berichtet von dem Fensterladen.
»Wenn du Hilfe brauchst, gib Bescheid«, sagt er noch und fährt davon.
Bernd kennt sie von Kindesbeinen an. Mit sechs Jahren hatte er mit Meningitis auf der Kinderstation gelegen. Es stand schlecht um ihn, und die Eltern waren ganz verzweifelt gewesen, aber er überstand die Krankheit ohne Folgeschäden. Danach war seine Mutter immer in Sorge gewesen, und wenn eines der drei Kinder Fieber hatte, klopfte sie an ihre Tür und fragte: »Kannst du mal kommen und nachsehen?«
Es dämmert bereits, als sie zu Hause ankommt.
Das Heft legt sie in den Wohnzimmerschrank, füttert Pepe und macht sich zwei Scheiben Brot mit Camembert. In Gedanken ist sie immer wieder bei dem Heft. Wenn sie alles aufschreibt, wo soll sie anfangen? Bei den frühesten Erinnerungen? Oder sollte sie mit dem fatalen Moment beginnen, an dem alles aus dem Ruder gelaufen war?
Sie hat die Biografien von Karl Marx, Rosa Luxemburg und Heinrich Heine gelesen, aber über deren Leben hatten andere geschrieben, hatten Biografen Fakten zusammengetragen. Sie hat nur ihre Erinnerungen, ihren eigenen Blick zurück.
Nach dem Essen holt sie das Heft aus dem Schrank und spitzt sorgfältig einen Bleistift. Erst mal mit Bleistift schreiben, dann kann man radieren, wenn es holprig klingt.
Sie schreibt: Kühlungsborn, Oktober 1991.
Ich bin 1953 in Frankfurt an der Oder angekommen, aber mein Entlassungsschein …
Drei Zigarettenlängen sitzt sie vor diesem angefangenen Satz, sieht hinaus und immer wieder auf das Papier.
Nein! Da hatte es nicht begonnen. Da nicht!
Sie dreht den Stift um, radiert die Worte aus und legt das Heft zurück in den Schrank.
Kapitel 4
Am frühen Abend kam sie in Ratingen an. Der Onkel holte sie vom Bahnhof ab. Er nahm ihren Koffer und sagte: »Ach, Mädchen, du bist ja kaum wiederzuerkennen, nur Haut und Knochen.«
Sie versuchte ein Lächeln. Auf der Zugfahrt war ihr der Gedanke gekommen, dass diese Reise ihr auch eine Möglichkeit bot. Sie könnte schreiben! Sie könnte Joop jetzt Briefe schreiben. Und er ihr.
Gleich am nächsten Morgen brachte die Tante sie zum Marktplatz.
Auf dem Weg erklärte sie Lene: »Ich habe früher bei den Eberechts die Wäsche gemacht, das sind gute Leute. Herr Eberecht ist Direktor in einem Stahlwerk. Du musst gute Manieren zeigen. Am besten, du sprichst ihn mit Herr Direktor an und seine Frau mit Frau Direktor.«
Tante Grete war ganz aufgeregt, während Lene neben ihr herging und darüber nachdachte, wo sie sich Papier und einen Stift besorgen könnte.
Auf dem Marktplatz standen an einem Kiosk Männer, die einen verwahrlosten Eindruck machten, und als ein Junge auf sie zukam und sie um Brot anbettelte, zischte die Tante: »Verschwinde«, und zog Lene eilig weiter.
Sie gingen zwischen zwei Jugendstilhäusern mit Erkern und reich verzierten Giebeln in einen Hinterhof zu den Dienstboteneingängen. Tante Grete steuerte auf die linke Hintertür zu, und sie betraten eine große Küche. Eine stämmige Mittvierzigerin mit weißer Schürze begrüßte die Tante freudig und musterte Lene.