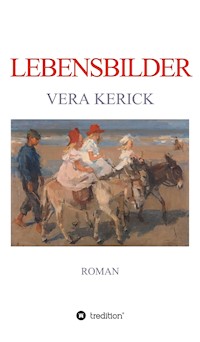
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lilly muss einiges klären. Der Tod des Vaters, die Trennung vom Lebensgefährten und die Entfremdung von der Schwester haben ihr zugesetzt. Quälende Fragen sind dabei offengeblieben. Und sie geht diese auf ihre ganz eigene Weise an. Schon seit Kindertagen hat Lilly die bizarre Eigenschaft, Menschen aus ihrem Umfeld mit Bildern zu verbinden. Mit Bildern, die sie aus der Kunstbüchersammlung ihres Vaters kennt, in der sie immer so gerne geblättert hat. Eine Reise, die sie nach Paris, Chicago und Amsterdam führt, gerät zum Schicksalsweg. Lilly sucht dort die Bilder auf, die sie an ihre Lieben erinnern. Überraschende Einsichten, neue Begegnungen, auch Enttäuschungen formen auf diesem Weg ihre Sicht auf das Leben und auf ihre Mitmenschen. Es ist Zeit für eine Wende, Zeit zu handeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vera Kerick
Lebensbilder
© 2019 Vera Kerick
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-5639-1
Hardcover:
978-3-7497-5640-7
e-Book:
978-3-7497-5641-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Meinem Freund Bastian
Verlust ist eine Lupe,
die das Schöne größer macht.
Herbert Grönemeyer, 2018
Prolog
Das kleine Mädchen schlich unbemerkt ins Kaminzimmer, wo es sich mitsamt einer Wolldecke rasch in den großen Ledersessel einkuschelte, dessen dunkelgrüner Bezug fraglos schon bessere Zeiten erlebt hatte. Ihre kleinen, nackten Füßchen vergrub sie in Lumpis Fell. Der Hofhund räkelte sich vor dem schwächelnden Feuer und gähnte hin und wieder ausgiebig. Auf sein hellbraunes Fell fielen die allerersten Sonnenstrahlen des Jahres.
Endlich Frühling.
Der Vater arbeitete draußen auf dem Feld, die Mutter im Hofladen, und Mathea war in der Schule.
Stille im Haupthaus.
Nur die kleine Lilly, die eine Erkältung auskurierte, langweilte sich sehr und hatte daher ihr Krankenlager heimlich verlassen. Nun saß sie in Vaters geliebtem Ohrensessel und ihr Blick streifte beiläufig eine Kundin des Hofladens vor dem Fenster, die mit einem Korb voller Lauch zu ihrem Fahrrad eilte.
Sie sah sich im Inneren des Zimmers um, sah die schweren, dunklen Vorhänge, die vielen gerahmten Familienbilder in dünnen Silberrahmen auf dem Kaminsims, die im Dezember den Weihnachtskarten wichen, das Hirschgeweih an der Wand.
Dann blickte Lilly zu den Büchern.
Zu den Kunstbüchern, die schon immer da gewesen waren, die Vater sich schweigend ansah, wenn er nach getaner Arbeit abends mit einem Glas Bier dasaß.
Lilly stand auf und ging näher. Sie besah die Buchrücken erstmals in ihrem Leben genauer und strich vorsichtig mit ihren Fingern darüber. Schließlich zog sie eines aus dem Regal. Es war riesig und für ihre dünnen Ärmchen fast zu schwer. Sie legte es auf den Fußboden und begann zu blättern. Die Buchstaben und Zahlen darin sagten ihr nichts, aber die vielen Bilder fesselten sie auf eine ungekannte, verstörende und zugleich faszinierende Weise.
Plötzlich hielt sie inne. Sie starrte gebannt auf das abgebildete Gemälde vor ihr. Es zeigte eine Frau mit ihrem Kind auf dem Schoß. Die Mutter fütterte es mit Brei und pustete fürsorglich in Richtung des gefüllten Löffels in ihrer Hand, um offenbar die Temperatur der Mahlzeit zu regulieren.
Lilly hielt den Atem an.
Das Bild erinnerte sie so sehr an ihre eigene Mutter, dass sie erstaunt die Augen rieb und ein weiteres Mal hinsah. Die Frau hatte gar keine besondere Ähnlichkeit, aber es gingen ein Zauber, eine Liebenswürdigkeit und Fürsorge von diesem Bild aus, die die Erinnerung ganz deutlich hervorriefen.
„Mama“, flüsterte das Mädchen und rieb vorsichtig und ehrfürchtig mit der Innenfläche ihrer Hand über die Abbildung des Kunstwerks.
Sie ahnte nicht, dass es das Werk „La Bouillie“ des französischen Künstlers Jean-Francois Millet aus dem 19. Jahrhundert war, aber das spielte keine Rolle.
Lilly holte ein weiteres Buch aus dem Regal, danach noch eines, sie blätterte, staunte, besah die Bilder mit kindlicher Neugier und großer Faszination. Sie bekam gar nicht genug von den abgebildeten Landschaften, der figürlichen und abstrakten Malerei, von Tierdarstellungen, gemalten Bauwerken, fotografierten Skulpturen. Manches gefiel ihr besser als anderes, aber alles sah sie mit einem Interesse an, als habe sie noch nie zuvor solch Spannendes, Erhellendes erlebt.
Schließlich stutzte sie erneut. Sie schreckte gar zurück beim Anblick von Jackson Pollocks Werk ‚No. 5‘, das sie plötzlich in Händen hielt. Es erinnerte sie mit einer solchen Wucht an eine ihrer Kindergärtnerinnen, Frau Voss, dass ihr die Hände zitterten.
Frau Voss mochte niemand.
Sie war streng, ungerecht und vermochte Kinder untereinander, Kinder und Eltern, Eltern und Erzieher auf eine Weise gegeneinander aufzuhetzen, dass es seinesgleichen suchte. Sie spann ein Netz von Intrigen, weit über die Grenzen des Kindergartens hinaus, das dem Netz von Pollocks Farbgebung, dem Wilden und Ungezügelten seines abstrakten Expressionismus wahrlich ähnelte.
All dies war Lilly nicht explizit bewusst. Vermutlich war es sogar eher die Farbgebung des amerikanischen Spätwerks, die der Garderobe der Kindergärtnerin ähnelte, aber das Kind konnte sich der Assoziation nicht erwehren: dieses Bild war Frau Voss.
Etwas verwirrt und müde, aber immer noch gefesselt von den Gemälden, ging Lilly schließlich zurück in ihr Bett. In diesen Büchern, da war sie sicher, hatte sie nicht zum letzten Mal geblättert.
Der Vater hatte einen anstrengenden Tag verbracht. Es wurde Frühling, da gab es viel zu tun. Beim Abendbrot hatte er erfreut festgestellt, dass es seiner kleinen Tochter Lilly inzwischen besser ging, das Fieber war gesunken. Sie hatte einen aufgewühlten Eindruck gemacht, das schrieb er der Tatsache zu, dass seine Frau ihr in Aussicht gestellt hatte, morgen wieder aufstehen zu dürfen.
Als er nun das Kaminzimmer betrat, wunderte er sich über den Anblick, denn auf dem Fußboden lagen einige seiner Kunstbücher verstreut. Fünf oder sechs Bildbände lagen teils aufgeschlagen umher. Instinktiv sah er sich um, als könne er den Übeltäter noch erwischen. Schließlich schüttelte er leicht den Kopf, seufzte und begann aufzuräumen. Er hob zunächst den Pollock-Bildband auf, den sein Bruder Bernhard ihm aus den Staaten mitgebracht hatte. Er stellte ihn zurück ins Regal, gefolgt von den anderen Büchern bis hin zu einem Band über den französischen Realismus, den er dann doch wieder herauszog und mit zu seinem Sessel nahm.
Seine Kunstbücher, wie sehr er sie liebte! Vielleicht würde sich ja eines seiner Kinder auch eines Tages für die Kunst interessieren, so hoffte er an diesem Abend, an dem die untergehende Sonne seinen Hof in ein wunderbares Licht tauchte.
Teil I: Paris
1
Das Abenteuer konnte beginnen. Lilly schaute hinüber zu den drei aufgeschlagenen Bildbänden, die auf ihrem Bett lagen. Ihre Reiseanleitung. Ihr Wegweiser in eine Zukunft, von der sie selbst noch kaum eine Vorstellung hatte. Hauptsache anders, vorwärts. Sie ging langsam etwas näher und warf einen letzten, intensiven Blick auf jedes der drei Bilder, dann klappte Lilly die Bücher zu und stellte sie ins Regal zurück.
Etwas spöttisch besah sie den riesigen, vollgestopften Rucksack auf dem Fußboden. Normalerweise verreiste sie mit einem Hartschalenkoffer, doch eine Abenteuerreise wie diese verlangte nach einem Trekkingrucksack. Dachte Lilly zumindest. So ganz sicher war sie sich inzwischen zwar nicht mehr, aber für Zweifel war es zu spät. Sie würde das jetzt durchziehen.
„Wir müssen los, oder?“
Lillys Mutter stand in der Tür und wischte die Hände an ihrer geblümten Kochschürze ab. Optisch hatte sie sich kaum verändert. Vielleicht war sie ein bisschen kleiner geworden, etwas in sich zusammengesunken nach allem, was passiert war. Als hätte man ein wenig Luft rausgelassen aus einem Leben, das vorher übervoll war mit Alltäglichem. Der Hof hatte Lillys Mutter komplett ausgefüllt. Jahrzehntelang hatte sie in ihrer großen Bauernküche gestanden und völlig mühelos eine Mahlzeit nach der anderen zubereitet. Um den riesigen Holztisch versammelte sich stets eine Schar hungriger Gäste. Lilly hatte oft staunend zugesehen, welch riesige Portionen die Lehrlinge verdrücken konnten. Wie selbstverständlich gesellten sich neben den Angestellten auch Nachbarn, Freunde und die Kunden des Hofladens dazu, die gerne auf einen ausgedehnten Kaffee blieben, eine Brotzeit und den neuesten Tratsch aus der Umgebung. Der Hofladen kannte keine Öffnungszeiten, und Lillys Mutter keine Langeweile.
Und jetzt wohnte sie in dieser stillen Drei-Zimmer-Wohnung. Hübsch zwar, aber kein Vergleich zu ihrem alten Leben. Für Lillys Mutter ein schlechter Tausch. Keine Weite mehr, keine Felder, kein Wald, keine Luft. Und keine Aufgabe. Vielleicht war es die Enge, die die Mutter kleiner gemacht hatte, ihr Körper passte sich einfach der neuen Umgebung an.
„Ja, lass uns fahren, sonst verpasse ich noch meinen Flug.“, sagte Lilly nun mit einem Blick auf die Uhr und griff nach ihrem Gepäck.
Das kleine Gästezimmer in Mutters neuer Wohnung war eine schnelle und unkomplizierte Notlösung gewesen. Die vertraute Gesellschaft tat beiden gut, auch wenn Lilly ohnehin die meiste Zeit in der Kanzlei verbrachte. Nach der Trennung von Robert war sie froh gewesen über die Möglichkeit, einfach in einer Art Kinderzimmer unterschlüpfen zu können. Unter Mutters Flügel, ein zeitlebens sicherer Hort.
Sie hatte nur wenig mitgenommen aus Roberts und ihrem gemeinsamen Leben. Er blieb vorerst in der Wohnung und behielt die Möbel, und die wenigen persönlichen Dinge, an denen Lilly hing, waren mitsamt ihren Büchern schnell im Gästezimmer untergebracht. Ihren Kleiderschrank hatte sie bei dieser Gelegenheit gründlich ausgemistet, und so passte nun fast alles, was sie besaß, in den Reiserucksack. Lilly blickte ein letztes Mal auf ihr provisorisches Reich.
„Soll ich meine restlichen Sachen noch wegräumen?“, fragte sie ihre Mutter. „Ich meine, falls dich irgendetwas stört, falls du mehr Platz brauchst… Ich könnte den Kram schnell in den Keller tragen? Immerhin werde ich zwei Monate lang weg sein und danach…“
„Mach dir keine Sorgen. Ich brauche doch ohnehin kein Gästezimmer. Wer soll mich denn besuchen? Oder glaubst du allen Ernstes, dass deine Schwester sich hierhin verirrt?“
Die Mutter zog die Augenbrauen hoch und berührte Lilly vorsichtig am Arm.
„Vermutlich nicht.“
Lilly seufzte und bemühte sich, die irritierenden Gedanken an ihre Schwester zu unterdrücken, während sie sich auf den Weg zum Auto machte und das Gepäck einlud.
Die Mutter nahm nicht den schnellsten Weg zum Flughafen. Sie fuhr stets die absonderlichsten Umwege, um ja am alten Hof vorbeizukommen, als müsse sie dort noch nach dem Rechten sehen. Lilly verstand nicht, weswegen sie sich dem Schmerz jedes Mal aufs Neue freiwillig aussetzte. Aber auch diesmal lenkte die Mutter den Wagen wieder auf die Straße, die einen Blick auf die so vertrauten Mauern zuließ.
Lillys Hand umfasste fest den Türgriff, und sie erwartete das dumpfe Gefühl in der Magengrube, das nun kommen und die Erinnerung an glückliche Zeiten zwangsläufig begleiten würde. Zwar könnte sie die Augen schließen, doch die Bilder würden trotzdem aufblitzen, denn sie trug sie in sich wie eine einzigartige Kostbarkeit, die wunderbar, überlebenswichtig und doch zugleich so schmerzhaft war.
Lilly sah es den Bruchteil einer Sekunde früher als ihre Mutter. Nach nur einem einzigen, vorsichtigen Augenaufschlag erfasste sie den Bagger, die groben Laster mit den Containern und das riesige Loch inmitten der Spezialwiese links neben dem grünen Hoftor. Noch bevor sie etwas sagen konnte, bremste die Mutter so scharf, dass der Trekkingrucksack krachend von der Rückbank flog.
„Das können sie nicht machen“, flüsterte sie und trat dann erneut aufs Gaspedal. Zielsicher steuerte sie auf die Spezialwiese zu.
„Lass doch bitte, Mama…“, versuchte Lilly sie zu stoppen. „Natürlich können sie. Es ist ihr Hof. Verstehst Du? Ihrer!“
Die Mutter bremste erneut und legte resigniert den Kopf auf ihre Hände, die das Lenkrad an seinem oberen Rand umklammerten. Lilly war sich sicher, dass sie in diesem Moment wieder etwas schrumpfen würde. Sie hörte, wie ihre Mutter ein paar tiefe Atemzüge nahm.
Lilly hatte als Anwältin den Hofverkauf begleitet. Ihr war es eigentlich ganz recht, dass es so schnell gegangen war. Ihre Mutter hätte die viele Arbeit alleine nicht geschafft, und sie selbst und ihre Schwester Mathea hatten nun wirklich keine Ambitionen, den Hof weiterzuführen. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der sie das gerne gemacht hätte, aber Vater hatte es ihr ausgeredet. Die ungewissen Zukunftsperspektiven für die Agrarwirtschaft, die schlechten Verdienstmöglichkeiten, die harte Arbeit, die seine jüngere Tochter ja doch nicht völlig ausfüllen würde… und so weiter. Und jetzt war es so, wie es eben war. Der Hof war weg.
Sämtliche Erinnerungen waren allerdings noch da. Verzerrt womöglich, lange her und gepaart mit kindlicher Phantasie, aber doch so sonnenklar. Kindheitserinnerungen an scheinbar endlose, warme und überglückliche Sommertage am Bach, auf dem Trecker, am Waldesrand. Der Geruch nach dem Regen, frische Wiese, Fliederblüten, nasses Holz. Erinnerungen an kalte Winter am offenen Kamin, angekuschelt an Lumpis weiches Fell, an die Schneemänner auf der Spezialwiese, auf der alles möglich war. Auch der Tod.
„Hallo, Frau Schulze-Blum!“, der Neue kam laut rufend und energisch winkend auf den Wagen zu und riss Lilly aus ihren Gedanken. Er übertönte sogar das gleichmäßige Brummen des Baggers. Van Goghs Selbstbildnis, schoss es Lilly sofort wieder in den Kopf. Sie konnte es nicht verhindern, die Ähnlichkeit war so verblüffend. Schon bei all ihren vorherigen Begegnungen hatte sie das Bildnis im Sinn gehabt. Der gleiche orangefarbene Bart, die gleichfarbig kurzen und doch leicht gewellten Haare, das strenge, hagere Gesicht mit dem unnachgiebigen, immer etwas ängstlichen Blick, der sich nun allerdings in ein Strahlen verwandelte.
Die Mutter hob langsam den Kopf vom Lenkrad, gab sich aber keine Mühe zu lächeln. Der Neue öffnete schwungvoll die Türe, ergriff und schüttelte Mutters Hand.
„Wie schön, dass wir uns mal wiedersehen! Geht es Ihnen gut? Wir haben hier ein neues Projekt gestartet. Wir bauen ein Häuschen für meine Schwiegereltern, sehen Sie?“
„Ja, ich… Wir…“
Frau Schulze-Blum wischte sich über die Augen, als sei sie gerade aus einem verwirrenden Traum erwacht, den sie möglichst schnell vergessen wollte. Sie schnallte sich in Zeitlupe ab und stieg aus dem Auto. Ihr ganzer Körper schien sich dagegen aufzulehnen, die simpelsten Regeln der Höflichkeit gegenüber diesem Verräter zu wahren.
„Schauen Sie mal“, fuhr der Neue ganz unbekümmert fort. „Das geht ja heutzutage alles so schnell, hier kommt die Garage hin, dort das Haus. Ende des Jahres wird alles fertig sein. Ich melde mich, wenn wir das Richtfest feiern, dann müssen Sie unbedingt kommen!“
Lilly war inzwischen auch ausgestiegen und hatte dem Neuen die Hand gegeben. Da ihre Mutter rein gar nichts sagte, stellte sie selbst ein paar Fragen und gab sich Mühe, möglichst interessiert zu klingen. Van Goghs Antworten hörte sie jedoch nicht.
Sie blickte auf die Spezialwiese, die ihren Namen Mathea zu verdanken hatte. Der kleinen Mathea, die es damals so speziell fand, dass auf der Wiese ständig etwas anderes passierte. Einen Sommer lang grasten dort zwei braune Ziegen namens Coca und Cola, die ihr Vater bei einer Wette gewonnen hatte. In einem anderen Jahr baute Mathea an gleicher Stelle einen immer größer werdenden Hasenstall, denn ihre ersten beiden Kaninchen waren doch keine zwei Weibchen gewesen, wie sich schnell herausgestellt hatte. Vater hatte seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag hier gefeiert, in einem großen Festzelt mit Live-Musik und der gesamten Nachbarschaft. Sogar ein Wanderzirkus hatte die Spezialwiese einst für die Unterbringung seiner Tiere genutzt.
Und schließlich war es hier passiert, hier war es zu Ende gegangen, ein zu kurzes Leben mit so einem unbefriedigenden Finale. Der Beginn des Endes hatte genau hier, ausgerechnet hier stattgefunden mit Lilly in einer unfreiwilligen Nebenrolle. Die Bilder würden sie für den Rest ihres Lebens begleiten.
Und er hatte es gewusst!
Er hatte es gewusst.
„Ich bringe meine Tochter zum Flughafen, wir müssen uns beeilen, es ist noch ein weiter Weg. Und sehen Sie, jetzt regnet es auch noch!“ Mutter hatte ganz plötzlich ihre Sprache wiedergefunden und drängte inmitten von van Goghs blumiger Schilderung zum Aufbruch. Sie deutete zum Himmel und schüttelte leicht den Kopf. Für sie schien der plötzliche Wetterumschwung eine nur logische, konsequente Reaktion des Himmels auf das gerade Erlebte. Der Neue entschuldigte sich freundlich, sie so lange aufgehalten zu haben, und sie verabschiedeten sich voneinander. Die Fassungslosigkeit in den Gesichtern der beiden Frauen, ihre geradezu versteinerten Mienen und Bewegungen hatte er nicht im Geringsten registriert.
Nach endlosen Minuten im Auto, in denen sie nur geschwiegen hatten, bot Lilly schließlich an umzukehren.
„Ich muss ja nicht unbedingt jetzt fahren, vielleicht nächste Woche oder…“
„So ein Quatsch, Kind“, unterbrach sie die Mutter.
„Du bist also sicher, dass ich dich allein lassen kann, jetzt, nachdem…?“
„Natürlich. Sie hätten es einfach nur woanders hin bauen können, das ist alles.“
Für Mutter war das Thema damit erledigt. Sie war viel härter, als es ihr schrumpfender Körper erahnen ließ.
Am Flughafen angekommen drückte Lilly ihre Mutter etwas länger und fester als sonst. Ihre Mama, der selbstloseste und unbeugsamste Mensch, dem sie je begegnet war. Sie war wie die viel zitierte Eiche im Sturm, so sicher, ganz standhaft. Immer für sie da, wie es nur Mütter sind. So selbstverständlich. Als sie einander endlich losließen, beeilte Lilly sich, in die Abflughalle zu kommen, denn der außerplanmäßige Zwischenstopp am Hof hatte viel Zeit gekostet.
Plötzlich hatte sie es wirklich eilig. Hier musste sie jetzt weg. Jetzt erst recht. Rückblickend kam ihr das komplette eigene Leben wie eine gleichförmige Masse vor. Als hätte es überhaupt keine erwähnenswerten Momente gegeben, als sei in vierunddreißig Jahren nur das passiert, was unbedingt passieren musste. Keine Leuchttürme und keine Felsschluchten. Ihr Leben war dahingeplätschert, wie von einem desinteressierten Langweiler im Voraus programmiert, ohne jede Kontur.
Ihre eigene Zeitrechnung hatte erst begonnen, seitdem alle fortgingen.
Mathea.
Vater.
Robert.
Seit die Verluste Löcher in ihr Leben rissen wie der Bagger in die Spezialwiese. Seitdem konnte sie sich plötzlich an jede einzelne Minute erinnern, jetzt hatte das Leben begonnen, seine möglichen Ausprägungen zu demonstrieren. Zwar zeigte es sich momentan nicht von seiner guten Seite, aber immerhin war da nun eine neue Lebendigkeit. Ein Aufwachen, ein schlagartiges Auftauchen aus dem Einheitssumpf. Plötzlich fühlte sie. Einsamkeit. Verlassenheit. Die Endlichkeit der Dinge erweckte Lilly zu einem neuen Anfang.
Aber ging das überhaupt? Mitten im Leben ein Anfang? Die neuen Löcher in Lillys Leben waren in Wahrheit tiefe Wunden, die bluteten und schmerzten. Wo gab es Heilung? Wie gab es Heilung?
Eiligen Schrittes bahnte sie sich den Weg durch die Reisenden, vorbei an Rollkoffern und Anzeigetafeln. Die Dame am Schalter erinnerte Lilly an die Mona Lisa, nur dass sie nicht lächelte. Kerzengerade und starr saß sie hinter ihrem Computer, die Hände schwach übereinander gelegt wie das große Original. Sie erkundigte sich missmutig nach Lillys Reiseziel, ohne dabei ihre Haltung auch nur minimal zu ändern. Mit einer Entschlossenheit, die Lilly selbst nicht von sich kannte, warf sie ihr hippes Gepäckbündel auf das Förderband, nahm ihr Ticket entgegen, schenkte der traurigen Mona Lisa einen aufmunternden Blick und ging schnurstracks zum Gate.
Jetzt ging es los, die Zeit war reif.
2
„Wissen Sie, was mich am meisten beeindruckt? Die Weite, die in diesem Bild zum Ausdruck kommt, diese unendliche Weite und die Stille, die über der Szene liegt.“
Lilly hob erstaunt den Kopf. Sie hatte, abgesehen von kurzen Telefonaten mit ihrer Mutter und der Kanzlei, seit über zwei Wochen kein deutsches Wort gehört. Und nun war da dieser junge Mann neben ihr, den sie bis gerade eben gar nicht wahrgenommen hatte. Sie saßen auf einer großen, lederüberzogenen Bank im Pariser Louvre, im Flügel der Franzosen des 17. Jahrhunderts, vor Nicolas Poussins ‚Der Sommer oder Ruth und Boas‘. Seit über vierzehn Tagen saß Lilly nun vor diesem Bild.
Sie war auch durch andere Abteilungen des Louvre geschlendert, hatte die Mona Lisa und im Musée d’Orsay van Goghs Selbstbildnis besucht, hatte sich treiben lassen durch die Stadt der Liebe, im Touristenstrom hin zu Kirchen, Denkmälern, in Kaufhäuser, Teesalons und Galerien. Sie hatte bei Café au lait und Croissants die ersten Strahlen der Frühlingssonne aufgesogen und lange Spaziergänge unternommen.
Lilly liebte den Frühling. Sie mochte alle Jahreszeiten, aber den Frühling ganz besonders. Die Zeit, in der wieder Leben in die Dinge einzog, Farbe, Wärme. Es war jedes Jahr ein befreiender Ruck durch das Geschehen auf dem Hof gegangen, als habe der Winter zuvor alle Betriebsamkeit verlangsamt. Gleich den Blumen aus der Erde sprossen Energie und Freude, alles wurde bunter und schneller. Und für dieses Frühjahr hatte Lilly so große Pläne.
Und jetzt saß sie hier, vor Poussins Sommerbild, auf dem Schoß die deutschsprachige Ausgabe des Katalogs, was dem Fremden neben ihr wohl ein Hinweis gewesen war.
„Genau“, bemerkte sie nun, „so geht es mir auch. Für mich spielt die zentrale Szene, das Bittgesuch von Ruth, gar keine entscheidende Rolle. Es ist die Natürlichkeit der Szene, die mich berührt, diese arbeitsame Sommerstimmung auf dem Land.“
„Und die Farben!“, warf der Fremde ein. „Die gesamte Komposition ist sehr harmonisch, sowohl in der Anordnung der Bildkomponenten als auch in ihrem Gesamteindruck.“
Lilly nickte, und gemeinsam blickten sie auf das Bild. Sie unterhielten sich darüber, ohne einander anzusehen, ohne sich einander vorzustellen, ganz versunken in das Kunstwerk. Sie sprachen intensiv über die Szene auf dem Land, die auf dem Bild zu sehen ist. Über das große, bislang noch kaum bearbeitete Ährenfeld in voller Pracht, über den wuchtigen Baum im linken Vordergrund, unter dem Frauen und Männer ihrer Arbeit nachgehen, aus einem Krug trinken, Korn umfüllen, Früchte sortieren. Über Boas im Mittelpunkt des Gemäldes, der die kniende Ruth vor sich sieht, die um Erlaubnis für ihre Arbeit im Feld bittet. Daneben der Diener mit der kriegerischen Lanze, die fast stört in der Idylle, die besonders von der Großherzigkeit der geöffneten Arme Boas‘ lebt. Er wird Ruth die Arbeit in seinen Feldern gestatten, wird sie später, wenn er beeindruckt sein wird von ihrer bedingungslosen Aufopferung und Liebe zur Familie, zur Frau nehmen. Ein Bild als Symbol für den Sommer. Für Wärme und christliche Nächstenliebe. Lilly und der Fremde waren sich einig über die beeindruckende Qualität des Werkes und seine faszinierende Wirkung auf den Betrachter.
„Das Bild ist mein Vater“, flüsterte Lilly plötzlich inmitten der Ausführungen ihres Sitznachbars über die Beschaffenheit der Pinselstriche.
„Wie bitte?“
Lilly atmete tief ein.
„Seitdem ich denken kann, verbinde ich Menschen mit Kunstwerken“, sagte sie geradeheraus. „Ich verstehe nicht viel von Kunst, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung von Künstlern, von Epochen, Stilen oder Techniken. Aber ich liebe es, mir Bilder anzusehen, und ich vergesse sie nicht. Wenn ich Menschen treffe, fällt mir meist sofort ein Gemälde ein. Verrückt, ich weiß. Dieses Bild hier erinnert mich an meinen Vater, immer schon. Es ist diese Sommerruhe, dieser Fleiß, die Liebe zur Natur, all das verbinde ich mit ihm. Er war Landwirt und lebt nicht mehr, müssen Sie wissen. Ich bin nach Paris gekommen, um dieses Bild zu sehen, zum ersten Mal im Original.“
Noch nie zuvor hatte Lilly jemandem in so kurzer Zeit so viel über sich erzählt. Sie gab sowieso nicht viel über sich selbst preis, es gab ja in ihren Augen auch nichts sonderlich Interessantes. Über ihre besondere Beziehung zu Kunstwerken sprach sie erst recht nicht und natürlich niemals mit Fremden. Doch irgendetwas war heute anders. Sie erschrak kurz über ihre eigene Offenheit, realisierte dann aber sofort und halbwegs gelassen, dass es nun eben passiert war. Die Worte waren gesprochen, die wenigen Sätze waren gesagt. Doch wieso sollten sie diesen Wildfremden interessieren? Schnell versuchte Lilly, von ihren bedeutungsschweren Worten abzulenken.
„Und wieso sind Sie hier?“
Sie wandte sich um und sah den jungen Mann nun direkt an. Lilly war überrascht, wie attraktiv er war. Er hatte blondes, längeres Haar und hellblaue Augen, trug ein Sakko über dem T-Shirt und Sneakers. Er würde viel besser in ein zeitgenössisches Museum passen, befand Lilly. Hier zwischen den alten Meistern wirkte er irgendwie falsch.
„Ich bin Florentin. Florentin Kluge aus Hamburg“, sagte dieser nun und reichte Lilly die Hand.
„Lilly Schulze-Blum aus Niedersachsen“, murmelte Lilly verlegen. „Die mit dem Kunst-Spleen…“
„Nein, nein! Ich fand wirklich sehr interessant, was Sie gesagt haben. Sehr… besonders. Sehen Sie, ich bin Kurator und beschäftige mich seit vielen Jahren tagtäglich mit der Kunst. Ich wünschte mir manchmal einen weniger… studierten, wissenschaftlichen Blick auf das Ganze. Wahrscheinlich verstehen Sie viel mehr von Kunst als ich. Sie sehen die reine Absicht des Künstlers, denn wenn Sie solche Verbindungen ziehen können, haben Sie den Kern verstanden. Sie sind zu beneiden!“
Er lächelte sie an, doch Lilly wurde immer beschämter. Jetzt war sie ausgerechnet an einen Experten geraten! Schnell suchte sie in ihrem Gedächtnis nach einem klugen Gedanken, als müsse sie gegenüber dem Kurator ihr laienhaftes Kunstgeschwätz wiedergutmachen.
„Über dieses Bild hier weiß ich zufällig einiges. Poussin stammt aus der Normandie, ist Frankreichs bedeutendster Maler des Barock, der allerdings viel Zeit in Rom verbracht hat. Als sogenannter gelehrter Maler hat er sich mythologischen und religiösen Themen gewidmet, aber auch der Landschaftsmalerei. Er war sogar Hofmaler von König Ludwig XIII.! Na, was sagen Sie nun?“





























