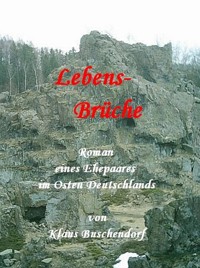
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor, geboren 1941 in Leipzig, arbeitete nach seiner Dienstzeit als Offizier an einer Bildungseinrichtung und studierte Philosophie. Nach der politischen Wende leitete er bis 1999 eine Einzelhandelsfirma. Er ist seit 1962 verheiratet und hat vier Kinder. Er ist mit Texten in mehreren Anthologien vertreten. 2002 veröffentlichte er "Filosofische Märchen", 2004 "Kann ich mit dir.?", 2010 "Kriegskinder", 2020 "Was wäre, wenn ...", 2021 "Sammelsurium" Seit 1977 lebt er in Erfurt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 871
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Prolog
Im Jahre Zwei nach dem großen Krieg zog eine Mutter ihren kleinen Jungen durch die Trümmerberge. Einen Schal trug sie wie einen Turban um den Kopf gebunden. Alle Leipziger Trümmerfrauen trugen das zu abgetragenen Mänteln. Gute, teure Kleider sah man in der Großstadt nicht mehr. Sie waren eingetauscht worden auf Hamsterfahrten übers Land. Eier, Fleisch, Mehl und anderes Essbares hatten sie von Bauern dafür bekommen. Wütend sah man zurück auf die Geizkragen, die immer zu wenig gaben. Doch was sollte man tun? Man musste ja essen. Keiner der Städter hatte je gesehen, dass ein lachender Bauer seinen Kuhstall mit eingetauschten Teppichen auslegte. Doch bei der Rückfahrt auf Dächern und Puffern der überfüllten Eisenbahnwaggons war diese Vorstellung ihr Reisegespräch.
Der Junge quengelte an der Hand der Mutter. „Will mit denen spielen.“ – Die Mutter sah die kleine Jungengruppe. Sie spielte Hasch mit Verstecken in halb verschütteten Kellern und eingestürzten Hausfassaden. „Viel zu gefährlich. Sind auch zu groß für dich. Wenn das ihre Eltern wüssten!“ – Neidisch sah der Junge weiter hin. Wortfetzen drangen an ihre Ohren.
„Traust dich nicht“, motzte einer. – „Ich schon. Du bist feige!“
Die Mutter zog ihren Sohn schnell weiter. Ringsum Trümmer, vielleicht lagen gar noch Blindgänger herum, alles gefährlich, der Junge muss hier weg. Doch er sträubte sich, zerrte an ihrer Hand. „Sieh doch mal!“ – Ihr Blick folgte seinem ausgestreckten Arm. Einer der Jungen kletterte einen Mauerfirst hinauf. Der Rest einer Fassade führte in die Höhe, Ziegelstein für Ziegelstein, wie eine schmale Treppe. Der Junge stieg unermüdlich aufrecht vorwärts, den Blick nach oben gerichtet. Entsetzen erfasste die Mutter.
Einer rief: „Komm zurück, wir glauben dir!“ Die Jungen sahen gebannt nach oben. Ihre Körper drückten Bewunderung, Hoffen und Angst aus. Leichter Wind fuhr in ihre viel zu weiten Jackenärmel.
Auf Höhe der ersten Etage erreichte der Kletterer ein gerades Stück. Vier Ziegel breit bot die Mauer eine Plattform. Er wendete sich um. Sein triumphierendes Lächeln strahlte herunter. „Na?“ – „Komm wieder runter! Es reicht.“ – „Ich trau mich noch viel mehr!“ Der Kletterer wandte sich wieder der Mauer zu. Sie wurde schmaler. Er ließ sich nieder, krabbelte mit Händen und Füßen weiter nach oben.
„Um Gottes Willen“, entfuhr es der Mutter.
„Ein Held, ein Held!“
Im abgerissenen Wehrmachtsmantel, Soldatenmütze auf dem Kopf, stand ein verhärmter kleiner Mann jenseits der Mauer. Den Kopf hoch gereckt, schien der Mützenschirm auf den kletternden Jungen zu weisen.
„Es gibt wieder Helden, jetzt, wo alle gefallen sind. Dort!“ Ein gespenstisches, hageres Gesicht. Es zeigte nach oben in den zweiten Stock, wo der Junge unermüdlich wie eine Katze kletterte. Der schien nichts zu hören, hingegeben auf Ziegel vor ihm und zur Spitze starrend. Frei ragte sie im vierten Stock ohne jeden Seitenhalt.
Weg wollte die Mutter, nur weg! Ihr Junge sollte nicht sehen, was geschehen könnte! Doch sie fühlte sich gelähmt an allen Gliedern.
Der Kletterer erreichte den letzten Ziegelstein. Er richtete sich auf, eine Windböe ließ ihn taumeln. Ohne einen Laut verschwand sein Körper, als hätte es ihn nie gegeben.
Die Jungen rannten durch enge Mauern davon und verschwanden im Ziegelstaub. Auch der Rufer war nicht mehr zu sehen.
„Was war das?“ – „Ein Traum, ein schlechter Traum!“ Die Mutter zerrte ihren benommenen Sohn weiter. „Vergiss ihn schnell!“ – Spitze Steine auf dem Trampelpfad durch die Ruinen, abgeknickte, zerborstene Wasserrohre fesselten ihre Blicke, wollten sie nicht straucheln.
Als sie die Trümmer verließen und den Hauptbahnhof vor sich liegen sahen, glaubte der Junge, ihn habe eine schlimme Einbildung genarrt. Seine Mutter trat an die Lore der Trümmerbahn. Sie stellte sich in die Reihe der Frauen, bückte sich und warf abgeklopfte Steine hinein. Der Junge folgte ihr. Seine ganze Kraft brauchte er für jeden einzelnen Stein. Schnell vergaß er, was er vergessen sollte. Er war noch so klein und jung.
Kinder einer fernen Zeit
Bernd
Der Umzug
Der schwarze Gummiball war weg.
Schluchzend saß der kleine Bernd zwischen Umzugskartons auf dem Sofa in der Küche. – „Du hast nicht gefolgt“, sagte die Mutter. „Deshalb habe ich ihn weggeworfen.“ – „Aber“, der Kummer schüttelte ihn. „Was habe ich denn gemacht?“ – Die Mutter sah den großen Schmerz und bedauerte ihre Worte. Sie warf den Ball nicht weg, er ging im Umzugswirbel verloren. Doch in ihrem Haushalt durfte nichts verloren gehen. – „Denke nach, wann du nicht gefolgt hast!“ – Bernd konnte nicht nachdenken. Sein Ball war der einzige Ball der ganzen Straße im zerstörten Leipzig von 1948 gewesen. So eine Kostbarkeit verloren! Was hat er Schlimmes angestellt, wenn Mutti ihn so straft? Es fiel ihm nicht ein. Sein Kopf war ganz leer. – Er schluchzte hingegeben vor sich hin, und dicke Tränen liefen über sein Gesicht.
Mutter griff ein Wischtuch und nahm Gabeln heraus. Die Schultern ihres Sohnes hoben sich krampfhaft. – „Komm“, sprach sie sanft. „Leg die Messer ins Besteckfach.“ – Bernd folgte mechanisch. Es war doch alles egal. Er hatte sich so auf die neue Stadt gefreut.
Aufregend war der nächste Tag. An den schwarzen Gummiball dachte er nicht.
Der Morgen begann mit dem verhassten Anlegen des Leibchens und dem Anziehen der Strümpfe. Bernd stand auf dem Stuhl und hielt sich an der Lehne fest. – Mutter streifte den zusammengerollten Strumpf über seine Zehenspitzen „Heb den Hacken!“ Sie rollte den Strumpf hoch. „Mach ihn fest!“ – Folgsam zog er den Strumpfhalter des Leibchens herunter, drückte das Strumpfende auf den Knopf des Halters und klemmte die Spange fest. – „Nun das andere Bein!“ – Bernd hob die Zehenspitzen und quengelte: „Immer dieses blöde Leibchen, die blöden Strümpfe!“ – „Es ist zu kalt für Socken. Hier sind wir im Gebirge. Du bist empfindlich.“ Die Mutter dachte an ihren eigenen Schulanfang, drei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Sparsam hat die große Familie mit acht Kindern gelebt, Socken und Strümpfe gab es genug. Jetzt, drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, fehlte es noch immer an allem. Sie hätte ihrem Nachkömmling gern zum Schulanfang eine reichere Zuckertüte gegeben, nicht mit zwei Dritteln Papier – doch, woher nehmen?
„Kommt Vati mit?“ – „Das geht nicht, Bernd. Er muss in den Schacht.“ – „Gerhard auch?“ – „Ja.“ – „Immer Schacht. Nie ist Vati da. Einen großen Bruder habe ich auch nicht.“ – „Aber Bernd! Sei nicht undankbar. Wir haben wenigstens Geld und können kaufen, was es gibt.“ Das ist wenig genug, dachte sie.
Sie klagte nicht, das wäre undankbar. Als schlimm hatte sie empfunden, dass die Stadtverwaltung Leipzig den Vater zum Wismutbergbau nach Annaberg verpflichtete. Nach einem Monat war er zum ersten Mal nach Hause gekommen. Sie konnte ein Brot mehr kaufen, auf dem „Schwarzen Markt“ für achtzig Mark. Bald sagte sie froh: „Wir vespern jetzt nachmittags, darfst eine Scheibe Brot mit Marmelade essen.“ Sie ertrug, dass es nach seiner Lehre auch den Ältesten traf, Begründung: „Bergwerkstauglich.“ Mehr brauchte es nicht in diesen Zeiten. Er fuhr mit Vater ins ferne Erzgebirge, bis sie genug von der Fahrerei und Geld für den Umzug hatten. Schwer ist ihr der Abschied von der zerbombten, trotzdem geliebten Stadt ihres Lebens gefallen. Doch dort im Gebirge gibt es Arbeit, und zuerst muss man essen. Sie konnte den Umzug so richten, dass ihr Jüngster die Schule hier beginnt. Den Schulweg kannte sie nicht. Die Nachbarin sagte, sie solle bis an die Straßenecke gehen. Viele werden kommen. Einfach mitgehen, eine dreiviertel Stunde Weg sei es mit den Kindern, die laufen ja nicht schnell. Und viel Freude in der neuen Wohnung wünsche sie. – Die neue Nachbarin wollte nicht aufhören mit ihren Wünschen und Freundlichkeiten. An den Dialekt wird sie sich gewöhnen müssen, sicher auch an anderes. Verwundert hatte sie bemerkt: Steckten die Wohnungsschlüssel von außen, war man zu Hause. Undenkbar, so ein Zeichen von Vertrauen, in ihrem geliebten Leipzig.
Bernd stand angezogen vor ihr. Ihrem Griff kam er zuvor und sprang vom Stuhl. – „Das sollst du nicht!“ – Er fuhr in den Jackenärmel. „Will selber machen!“ – Das hört sie nicht gern. Der Satz und „Das kann ich schon!“ lagen quer zwischen Mutter und Sohn. Denn sein Bemühen erfüllte selten ihren Anspruch. Heute mochte sie nicht schimpfen. Sie ließ ihm durchgehen, dass er die Jacke allein anzog, zupfte ihren Sitz zurecht und griff nach der Schultasche. – „Ich mache es!“ Bernd fuhr mit dem Arm durch die Schlaufen. Sie rückte den Ranzen gerade.
Kühl empfing sie der Septembermorgen wie ein Novembertag in Leipzig. Während sie an die Straßenecke liefen, mischte sich Bangigkeit in seine Ungeduld. Er griff nach Mutters Hand. Die Schiefertafel mit dem Schwämmchen schlug an seine Hüfte, im Ranzen klapperte der Holzfederkasten gegen die große Fibel. Ungewohnt. Da war es gut, das Kopftuch der Mutter zu sehen, das sie wie die Leipziger Trümmerfrauen trug. Beruhigend, das Kopftuch war immer schon so, wo heute alles wechselte, Stadt, Wohnung, Straße, es keine Straßenbahn mehr gab, und er nicht wusste, wo hier die Trümmerbahn fuhr. Mutters Kopftuch blieb ihm Halt.
Sie standen an der Straßenecke, sahen andere ABC-Schützen herauf stapfen. Das war neu. Wo gab es in Leipzig einen Berg? Er hielt sich an seiner Mutter fest, seiner großen, starken Mutter, die alles wusste. Er spürte die Kraft von Mutters Hand auf seinem Kopf. Die Anderen kamen näher. Bernd wollte nun groß und stark sein und schüttelte Mutters Hand ab. Vorsichtig gab sie ihm die Zuckertüte. Stolz präsentierte er sich vor den fremden Kindern. Sie reihten sich ein, beschnupperten sich, oben die Mütter, unten die Kinder. – „Wie reddstn du?“, hörte Bernd. „Biste gar net aus Annaberch?“ – „Nee, aus Leibsch.“ – „Ä Zugezogner! Kimmste in de Eins Be?“ – Bernd wusste es nicht. Er hörte gut zu. In einer Woche staunten seine Eltern, sagten: Nicht zu fassen, spricht schon erzgebirgisch wie ein Hiesiger.
In dieser Woche lernte der kleine Bernd noch mehr: dass es hier keine Trümmer gab und auch keine Trümmerbahn. Hinter den Häusern pfiff keine Industriebahn entlang, an deren Gleisen er so gern stand und beim Rangieren zusah. Auf der Straße war er nicht mehr „der Bestimmer“, der das Spiel angab. Meist spielte man Eisenbahn, natürlich, und Bernd war die Lok. In Leipzig. Da war es gut, dass er schnell sprechen lernte, wie sie hier alle sprachen. Bald lachten sie ihn nicht mehr aus, wenn er nach Dingen fragte, die hier keiner kannte – wie die Trümmerbahn. Schnell lernte er, was ein Wismuter oder ein Schachter war und ein Arb’ter, dass es im Finstern Huppmänneln gäbe mit Federn unter den Schuhsohlen. Hier spielt man auf der Straße Fußball. Die Zaunfelder der Vorgärten sind ihre Tore, die Bordkanten die Strafraumgrenzen. Von den vielen Kindern brachte immer eines einen Ball. Manchmal scholl: „Ein Auto!“ Dann gingen die Fußballer zur Seite und bestaunten den langsam vorbei tuckelnden „Holzgaser“. Große Rundbehälter hingen vor dem Kühler unter der Stoßstange oder standen aufrecht auf der Ladefläche. Noch seltener unterbrach ein anderer Ruf ihre Spiele: „Russkies!“ Geruhsam traten sie hinter die Bordkante und ließen in Dreierreihen laufende Soldaten vorbei. Sie schnupperten in die wehende Machorkawolke und vergaßen die Störung. – „Kein Gleichschritt“, bemerkte Gerhard missbilligend, als er, selten genug, mit Vater eines Tages zu Hause war. „Aber – die da haben den Krieg gewonnen“, sagte Vater. „Wir nicht.“
Bald läuft ihr Leben in geordneten Bahnen. Die Familie lebt in der großen Wohnküche. Das winzig kleine Wohnzimmer, hier „gute Stube“ genannt, betreten sie wie alle Erzgebirgler nur noch an Feiertagen. Bernd schläft bei den Eltern, der große Bruder in der Bodenkammer. Mit der Gaslampe kommt auch zu Stromsperrzeiten Licht in die Wohnküche. Vater, der Fördermann, wird bald Reviersteiger, der große Bruder avanciert zum Markscheider in spe. Mutter läuft nachmittags und abends durch die Straßen, kassiert Geld und klebt Beitragsmarken in Versicherungshefte. Einmal in der Woche zieht Mutter mit Bernd und dem großen Handwagen hinauf und hinunter zum weit entfernten Wismutladen.
Und über all dem Neuen, der Schule, den von zu Hause mitgebrachten losen Blättern als Heftersatz, dem Auf und Ab der Berge, dem Wald des nahen Pöhlberg, vergisst das Schulkind Bernd das flache, in Trümmern liegende Leipzig – und den schwarzen Gummiball.
Mutter und Sohn
Bernd lebte in zwei Kindergemeinschaften: Da war seine Klasse und dort seine Straße. In seiner Klasse fand er sich schnell zurecht. Alle seine Mitschüler mussten sich beschnuppern. Bernd wusste am nächsten Tag noch jede Minute des Schultages. Er brauchte sich nicht anstrengen, verblüffte seine Lehrer und Mitschüler. Ähnliches hat er schon erlebt.
Im letzten Kriegsjahr heulten oft Luftschutzsirenen. Im Kellergepäck nahm Mutter ein kleines Bilderbuch stets mit hinunter. Unter Bombeneinschlägen las sie ihm kleine Texte vor. Viele lange Bombennächte schufen schreckliche Gewohnheit. Einmal flüchteten Fremde in ihren Keller, ein Schulmädchen dabei. Bernd sah ins Buch, das Mädchen neben ihm buchstabierte: „Ja – nu – ar.“ – „Richtig“, entfuhr es Bernd. – „Ach, du Knirps. Du weißt es, aber ich kann das richtig lesen.“ Laut las sie die Zeilen. – „Das kann ich auch“, unterbrach sie Bernd und sprach den ganzen Text. – „Kunststück, eine Seite kannst du auswendig. Kannst du auch den Februar?“ – Bernd konnte, bis zum Dezember. Das Mädchen staunte: Der Knirps kann schon lesen! – Ein zweites Buch gab es nicht im Luftschutzkeller. Das Mädchen sah er nie wieder. Ihre großen, erstaunten Augen vergaß er nie.
Als er die erste Eins erhielt – was denn sonst, war doch ganz leicht – sagte er zu den kräftigeren Mitschülern: Ich helfe euch, sage vor. Dafür lasst mich in Ruhe. – In Rangeleien sah Bernd nicht gut aus. Alle hielten sich an den Vertrag. Keiner neidete ihm den Klassenprimus.
Nicht so einfach kam er auf der Straße davon. Doch er wich nie aus, selbst chancenlos. In ihren Kämpfen gab es Regeln: Fußtritte verboten, die Gürtellinie heilig, Schläge verpönt, man rang und drückte. Auch in der größten Not hielt er sich daran und erwarb sich durch Fairness Achtung. Ihr Kampf war aus, wenn der Sieger Muskeln reiten konnte. Aber ein fairer Sieger tut das nicht. Wer dennoch mit seinen Knien auf die Oberarme drückte, auf den stürzten sich Umstehende und straften den Frevel. Bernd hätte nie Muskeln reiten können. Aber er entwischte seinem Gegner immer, bis dieser erlahmte. – „Du schaffst mich nicht“, keuchte Bernd. – „Du aber auch nicht.“ – „Ich will ja gar nicht, ich wehre nur ab.“ – Kämpfer und Umstehende verloren das Interesse, weil der Unterlegene tapfer und nicht zu greifen war.
Oft ist er zerschunden nach Hause gekommen. – „Hast dich wieder geprügelt“, schimpfte Mutter. „Du sollst weglaufen oder mich rufen, wenn sie dich verhauen wollen. Bist nun mal nicht so stark!“ – Diese Worte hat er immer geflissentlich überhört.
Bernd kniete vor dem Ofenloch. Jetzt im beginnenden Sommer ließ man im Erzgebirge den Herd abends ausgehen, packte einen Kaffeewärmer um den Malzkaffee in der Sofaecke, Kissen darüber – so blieb er bis zum Morgen warm. Früh musste wieder Küchenfeuer her, warmes Wasser im Schaff, ein neuer Kaffeetopf gehörte auf die Herdplatte – einen Küchenherd ohne Feuer gab es nicht. Nach dem Frühstück war Mutter gegangen, Versicherungsbeiträge zu kassieren. Er hatte die Asche durchgerüttelt, sie hinaus geschafft, den leeren Kohleneimer mitgenommen, vorher die letzten Briketts im Kohlenkasten unter den Herd gestapelt, den Eimer im Keller gefüllt, einen Holzscheit in Späne gespalten, Holz und leeren Aschekasten auf den vollen Eimer gelegt und hochgebracht. Endlich konnte er bei langsam auflodernden Flammen Geschichten erfinden. Mutter duldete kein Träumen. – „Entweder wird gearbeitet oder gespielt.“ – Jede Arbeit vergällt sie. Aber – sie war nicht da.
Aus zwei Kohlen baute Bernd steile Felsen, ein Holzstück wurde Brücke. Kleine Fetzen Zeitungspapier schob er nach hinten als Buschwerk in der Schlucht der Rocky Mountains. Holzspleiße waren ihm Baumstämme und Papierschnipsel trockenes Unterholz. Er strich das Streichholz an, führte die Flamme vorsichtig an die kleinen Büsche, langsam fingen sie Feuer in der heißen Sonne von Arizona. Das abgebrannte Reststück diente ihm als einsamer Indianerkundschafter. In der Schlucht prasselte Unterholz, griff nach den trockenen Baumstämmen, Flammen leckten an der Holzbrücke. Auf der Flucht vor den Soldaten strebte der Kundschafter hinüber. Bernd nahm ein zweites Streichholz, schob mit der Schwefelkuppe den Kundschafter langsam über die Brücke, vorsichtig, denn sie konnte unter den prasselnden Flammen brechen. Getrappel von Pferden in seinem Kopf. Die ersten blauen Uniformen tauchten auf, aber schon loderte die Brücke. Sie kämen nicht mehr hinüber! Da flammte die Streichholzkuppe, brannte den Streichholzrest an – armer Kundschafter! So knapp traf dich die Kugel des ersten Reiters! Dein Leben ging zu Ende in den Flammen des Buschbrandes! Bernd bedauerte ihn. Ein lebender Kundschafter, hinter dem die Brücke brach und der Reiter ihm wütend nachsah, wäre ihm lieber gewesen. Aber das Schicksal ist hart.
Sein Spiel war vorbei. Er packte Holzspäne auf das brennende Papier, achtete darauf, dass die Flammen alles erfassten. Dann legte er ein Brikett über die Scheite, Ofentür zu. Luftzug fachte die Flammen an. Bernd räumte Zeitungspapier weg, stapelte übriges Holz in den Kohlenkasten und schob ihn unter den Herd. Den Kohleneimer an die Seite gestellt, Kontrollblick in den Ofen: Es lodert, Tür zu, fertig. Wassertopf auf die Herdringe, Blick auf die Küchenuhr: Ihm blieb noch Zeit. Er gab in den Kaffeetopf das Familienmaß hinein, brach vier Stücke vom Kathreiner Kaffeezusatz ab und legte sie dazu. Kocht das Wasser, gießt er auf. Er blickte auf die Tafel Kaffeezusatz. So ähnlich sieht Schokolade aus, sagte Mutter. Es wird alles besser, es gäbe schon freie Läden, die HO, und im Konsum sei manches jetzt ohne Marken zu haben, hat Mutter gesagt. Er mochte Süßes, freute sich auf die unbekannte Schokolade. Wann würde er Schokolade kosten können?
Zeit für den Schulweg. Er nahm den Schulranzen, schloss die Tür und zog den Wohnungsschlüssel ab. Kam Mutti heim, wusste sie: Er war auf dem Schulweg. Ein System kleiner Dinge sorgte für Ordnung und Wissen vom anderen, Mutters Werk. Mit sanftem Druck hatte sie eingeführt: Heimkommen, Schularbeiten machen, Ranzen packen und an einen festen Platz stellen. Bernd maulte. Alle seine Schulkameraden gingen erst Spielen. – „Wie oft haben sie keine Schularbeiten in der Schule?“ – Recht hat sie, täglich rief Einer in der Pause: „Hilf mir schnell mal ...!“ – Maulend gewöhnte er sich an Mutters Regeln. Ihr zweiter Rat: Höre gleich beim ersten Mal richtig zu, war leichter zu befolgen. Des Lehrers Worte interessierten ihn. Hatten Mitschüler nicht verstanden, gaben sie Bernd Zeichen: Er sagte vor.
Beim Diktat schaute Bernd dem Lehrer auf den Mund – auch Mutters Rat. Er las viele Buchstaben am Munde ab, während seine Klassenkameraden mit gebeugtem Kopf überlegten, wie die Wörter geschrieben werden. – Er war stolz auf Mutter, deren Rat er nutzte, die den Haushalt organisierte, ihm auch Zeit zum Spielen ließ. Sie verstand so vieles, sah manches voraus. Leider auch seine Verhalten, unbegreiflich, wie sie das schaffte. Viel zu ängstlich war sie, nahm ihm gar eine Batterie aus der Hand: „Das ist Strom, Bernd. Strom ist immer gefährlich.“ – Selbst vor dem Federhalter warnte sie: „Hat eine Spitze, Bernd. Spitzen sind immer gefährlich.“ – Dabei war nur die Schultinte aus dem Tintenfass in der Schulbank gefährlich. Fasern verbargen sich darin und machten Kleckse ins Heft.
Aber noch kämpfte er nicht mit der widerspenstigen Nachkriegsschultinte. Er lief den Schulweg an der Feuerwehr vorbei. In ihren hohen Fenstern spiegelte sich die Sonne.
Die Sonne überschritt den Zenit, als er mit seiner Klasse aus dem Schulgebäude von Kaiser Wilhelms Gnaden heraustobte. Ein Junge hatte einen echten Fußball in die Schule mitgebracht, man denke: einen echten, ledernen Fußball! Vom Schuhmacher geholt, will ihn am Abend sein großen Bruder haben. Die Jungen beschlossen: Am Nachmittag probieren sie den Fußball aus. Sie rannten nicht wie sonst den kurzen Schulberg hinunter, sich beiseite schubsend, um als Erster anzukommen, sondern wandten sich bergauf zur Straße, die am Bergteich vorbei zur Festhalle führte. Dort gegenüber baut sich stets der Zirkus auf. Aber der war nicht da, auch auf dem Kätplatz standen keine Karussells. Sie liefen zum Sportplatz am Pöhlberg. Oft haben sie sonntags auf seinen Terrassen gestanden, die „BSG Konsum“, die Betriebsportgemeinschaft der Verkäufer Annabergs anzufeuern in ihren schwarzen Trikots mit rotem Kragen. Heute wollten sie selber BSG Konsum sein mit richtigem Fußball und richtigen Toren auf richtigem Platz. Die Hälfte von ihnen musste als BSG Wismut spielen, die in der Kreisliga schlechter stand. Ein Stein entschied, die Glücklicheren jubelten, die BSG Wismut wählte die Seite, und los ging es mit Anstoß vom Mittelpunkt. Wie üblich Seitenwechsel nach fünf Toren, Ende bei zehn, eine Uhr besaß ja keiner.
Die kleinen Fußballer kämpften um den großen Ball, den sie so leicht trafen, der so weit wegsprang und dem sie lange nachlaufen mussten auf dem großen Spielfeld. Beim Stand von sechs zu sechs wurden ihre Beine müde. Ausgepumpt stolperte der Stürmer, nachdem er dem Ball so lange nachgejagt war. Der Torwart brannte auf den Ball. Müde trafen die Stürmer das große Tor nicht mehr. Das Spiel zog sich. Sie hielten Rat. Das nächste Tor soll entscheiden, forderten die Einen. Ausgemacht ist ausgemacht, verlangten Andere.
In Bernds Brust stritten zwei Seelen. Irgendetwas hatte Mutti heute von ihm gewollt. Das fiel ihm ein, als Müdigkeit die Begeisterung wegschob. Die Kameraden stritten. Das wurde ihm zu lang. „Itze gieh ich hämm“, sagte er, schnappte sich den Ranzen und stapfte los.
Nahendes Unheil spürte er nicht. An der Eckfahne ereilte es ihn. Von der Seite griffen zwei Arme, steckten blitzschnell seinen Kopf zwischen zwei, von einem langen, dicken Rock bedeckte Frauenschenkel. Dann prasselte es auf seinen Hintern herab, der Schmerz kam gar nicht so schnell nach. Bernds Blick fiel spiegelverkehrt auf seine Klassenkameraden. Langsam spürte er den schmerzenden Hintern, und ihm dämmerte: Das konnte nur seine Mutter sein – eine böse gewordene Mutter! Mutter schlug nie. Jahre musste es her sein, dass sie ihm zwei, drei Klapse gab, symbolisch nur. Jetzt schlug sie mit Kraft – sein Hintern brannte.
Vorsichtig näherten sich seine Freunde, bestaunten den seltsamen Anblick. – Bernd fragte in diese kopfstehende Welt: Soll er sich schämen? Soll er losheulen, Theater machen, Eindruck schinden? Nein – keine Träne wird er zeigen! Unempfindlich sollen ihn alle sehen. Er war er, das wäre doch gelacht! Mutters Hand wird bald erlahmen. Soviel Kraft hat sie nicht.
Mutter kam zu sich, als die kleinen Fußballspieler in ihre Augen fielen. Was tat sie? Ihre Hand brannte. Absurd: glotzende, schweigende, kleine Jungen, sie im Zentrum, zwischen den Beinen ihr Jüngster, starr wie ein Stück Holz. Was war in sie gefahren?
Sie nahm Bernds Kopf aus der Beinzange, ergriff seine Hand und herrschte ihn an: „Du weißt, dass wir heute Waschtag haben, dass ich dich brauche!“ Sie zog ihn weg vom Fußballplatz, vor dem ihr plötzlich grauste. – Bernd lief brav mit, kein Schniefen, keine Träne, kein Wort, dabei musste er die Kränkung vor den Mitschülern schlimmer empfinden als ihre Hand. Ein wenig Stolz auf ihren kleinen Sohn zuckte durch Mutters Gefühlschaos.
Kiesel sprangen unter ihren Füßen. Schweigend liefen sie den Fußweg hinab. Die groben Steine rollten weg, ließen beide schwanken und manchmal balancieren auf rollendem Splitt.
Beim Frühstück hat Mutter Schmerzen gespürt, sich noch im Griff gehabt. Sie schickte Hermann in den Schacht. Am Vortag hatte er mit dem Obersteiger gesoffen. Diesem groben Bergmann konnte er sich nicht entziehen.
Der Krieg hatte den Obersteiger aus dem oberschlesischen Bergbaugebiet zur Wismut verschlagen. Als er sah, dass der neue Fördermann aus Leipzig mehr konnte, als Loren auf die Halde zu schieben, machte er ihren Hermann zum Reviersteiger. Einem solchen Mann musste man gefällig sein. Sie fand ihn grob und klug, eine ungewohnte Mischung. Seine Frau war Hebamme. Sie ging gern ins Theater. Staunend erfuhr es Ilse.
Mutter und Hebamme fanden sich seelenverwandt. Gemeinsam schleppten sie ihre Männer in das kleine Stadttheater. Und ihr Hermann, den höchstens ein Film interessierte, der Theater als „bourgeoisen Kram“ abtat, öffnete sich zögernd dieser Welt. Ilse hat sie schon immer bewundert, stand als junges Mädchen vor den glitzernden Fassaden des Leipziger Nachtlebens. Kein Geld, sich Theater, Konzerte leisten zu können. Nun mangelte es daran nicht. Kaufen konnte man wenig, dem Geld vertraute niemand nach so viel Währungsreform, also ging sie endlich ins Theater. Das gehörte zu dem Leben, das sie wollte: etwas „Besseres“ zu sein und aus dem gewöhnlichen Dreck zu kommen. Sie verstand den Obersteiger nicht. Unter Strapazen brachte er ein Klavier von Oberschlesien mit, seine Tochter spielte Hausmusik – und dann: grobschlächtige Reden, proletenhaftes Saufen. Sie musste es ertragen.
Ilse war nie angekommen gegen das Elend, in das sie hineingeboren wurde. Acht Kinder hatte ihre Familie. Wie viele Geburten ihre Mutter ertragen musste, wusste sie nicht. Sie hat ihre Mutter nur in „guter Hoffnung“ gesehen. Ilse war schon „in Stellung“ bei einer Herrschaft mit Telefon, als die ältere Schwester anrief: Sie möge um Gottes willen schnell heimkommen, die Geburt sei schwer. – „Welche Geburt?“, fragte Ilse verwundert. – „Bei Mutter“, schrie die Schwester. – Ilse raste nach Hause, half ihrer jüngsten Schwester zur Welt. Den Vater rief niemand. Der schimpfte, dass das Abendbrot nicht pünktlich auf dem Tisch stand. Kurz sah er auf das neue Balg – das Mitglied des Kirchenrates, der Buchhalter, der mit Schlips und Kragen am Tisch saß, Reinhold mit Namen. Den Namen Reinhold hasste sie ihr Leben lang.
Aus diesem Leben würde sie nur durch Heirat heraus kommen. Sie flog dem ersten Mann in die Arme, einem Mann mit feinen Umgangsformen, der höflich fragte, sie umwarb. Sie hatte nie gehört, dass jemand „Bitte“ zu ihr sagte – der Mann musste „Besseres“, das musste Liebe sein. Sie ließ sich nur zu gern „verführen“. Dann wuchs „die Frucht“. Sie verdrängte allen Zweifel, denn ein Leben „in Schande“ schied aus. – Er betrog sie schon in den Flitterwochen. Ilse litt, „die Frucht“ starb bei der Geburt. Er schien reumütig, und sie wollte doch nur das Gute: Eine heile Familie – und seine Liebe war doch schön! In ihrem Leib wuchs neues Leben, Bernds großer Bruder Gerhard machte sich auf den Weg. Da prügelte sie der Mann, endlich befolgte sie der Schwestern Rat und ließ sich scheiden. Allein mit Gerhard schlug sie sich durch Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und “völkische Erneuerung“. Den Schwestern erging es ähnlich. Sie rückten zusammen, halfen sich.
Dann geschah ein Wunder. Mit dreißig sah sie aus wie zwanzig. Schlanksein kam in Mode. Sie war mager, blonder Bubikopf, lustige Augen. Sie wurde zum Mittelpunkt im „Palmengarten“. – „Darf ich Sie heimbegleiten?“, fragten gut betuchte Herren, meist jünger als sie. – „Wenn Sie sich an meinem Kind nicht stören.“ – Sie lachten über den guten Witz und fragten nicht wieder. Einer wandte sich nicht ab – ihr Juniorchef. Der fand ihre Arbeit im Büro schon gut, bevor er sie im „Palmengarten“ traf. Er hat sie teilhaben lassen an der Welt der „Besseren“, einen Zipfel nur. Als nette Begleiterin fand er die Ilse gut, beförderte die umsichtige Tippse, damit er sie einführen konnte in seine Welt. Ilse war klug, ihre Beförderung wurde zum geschäftlichen Glücksgriff. Sie zeigte ihm ihre Bewunderung für das Seriöse des Geschäftslebens. – Er sah sie lange an. „Ach, Mädchen“, sprach er, „... bis zur Million bleiben wir ehrlich, darüber geht’s Gemause los.“ – Ilse stutzte zum zweiten Mal: Er hieß Reinhold.
Sie hat auch höfliche Männer getroffen, die nicht zu den „Besseren“ gehörten. Sie verschloss sich ihnen nicht. Die störten sich kaum an ihrem Kind. Aber meist waren sie zu grob. – Einer fiel aus diesem Muster, der Hermann, den fand sie einfach lieb, war scheu, geriet nie in Streit. Als er erfuhr, dass sie die Sekretärin des Juniorchefs der Nachbarfirma sei, erdrückte seine Bewunderung fast seine kleine Liebespflanze. – Sie wollte mehr wissen von diesem Hermann. Er sprach wenig, denn Glück hat es Hermann nie gebracht, wenn er sich offenbarte. Als er nicht weiter kam bei dieser hübschen, klugen, so bewunderten Frau, entschied er: Es ist egal, ob sie ihn ablehnt, weil sie viel, oder weil sie zu wenig von ihm wusste. So erfuhr Ilse von ihm, dass es schlimmere Lebenswege als den ihren gab.
Hermann kannte seine Eltern nicht, lebte in Waisenhäusern und Pflegefamilien. Die Stadt Leipzig bot ihm nur die billigste Lehre: Zurichter, das ist nicht einmal ein richtiger Gerber – und das ist schon ein schmutziger, schlecht bezahlter Beruf. Ein Fanfarenzug der Arbeiterjugend wurde seine Ersatzfamilie. Der wurde „gleichgeschaltet“ mit Hitlers Machtantritt – da hörten sie auf zu spielen. „Wenn ich das erzählt habe, war immer Schluss.“
Nie wollte Ilse sein wie alle. Sie verabredete sich – Freude in seinen Augen!
Da stand sie zwischen Reinhold, von dem sie nicht wusste, ob er ein Reinhold sei – und einem Hermann, dem Habenichts. Sie strebte doch nach „Besserem“! Aber sie erlebte noch nie, dass jemand zu ihr selbst aufsah als etwas „Besserem“. Immer hat sie vergeblich nach oben geblickt. Hermann gab ihr ein neues Gefühl. Das wollte erprobt und ausgelebt werden.
Bei ihrem nächsten Treffen liebten sich der Hermann und die Ilse. Dann machte Hermann ein Angebot: Kann Ilse denken, ihn zu heiraten, würde er eine zweite Arbeit aufnehmen. Habe er tausend Mark zusammen, könnten sie das. Sie verlöre ihre Arbeit, deshalb brauchten sie das Geld. Es würde knapp, mit dem Jungen von seinem Geld zu leben, aber es geht.
Ilse war betroffen von diesem unromantischen Heiratsantrag. Sie wusste ja, dass diese tausend Mark nichts bedeuten auf dem Weg nach „Besserem“. Sie wusste aber auch, welche Leistung sich Hermann abverlangte, was sie, die Ilse, ihm wert war.
Beim Juniorchef würde sie sich immer fügen müssen – wenn es denn jemals so weit käme. Den Hermann wird sie führen müssen – einen dankbaren, verliebten Hermann.
Sie entschied sich fürs Führen. Nach einem Jahr zeigte ihr Hermann zehn Hundertmarkscheine. Im hellblauen Brautkleid trat eine glückliche Ilse aus der Kirche. Auch Gerhard spürte, dass der Mann an der Seite seiner Mutter keinen Unterschied machte in seiner Liebe zwischen ihr und ihm. Ilse war sich sicher: Sie hatte richtig entschieden.
Der Juniorchef musste ihr kündigen und fragte sich, was er vor Jahresfrist versäumt hat.
Ilses Arzt wollte nicht glauben, dass sie noch einmal schwanger werde. Er schob es auf die erzwungene Askese, weil es im Urlaub passiert ist, wie bei Soldaten üblich.
Glück hatte Hermann im Krieg. Zwar zog man ihn schon zwei Jahre vorher ein, doch als Flugplatzsoldat in Leipzig sah er keinen Schützengraben. Einmal sollte er als Nachschub nach Stalingrad. Sein Flugzeug ist nicht mehr hingekommen, flog zurück zum Leipziger Flugplatz. Als letztes Aufgebot sollte er nach Karlsbad ins Böhmische. Die Truppe war schon aufgelöst. Hermann schlug sich durch in voller Uniform zurück nach Leipzig. Ilse hatte kein Brot zu Hause. – Das hole ich noch, sagte Hermann. – Die Amerikaner griffen ihn, der Entlassungsschein half nicht. Ilse sah es von der Haustür. Er hatte wieder Glück. Sie vergaßen ihn beim Transport nach Bad Kreuznach, wo noch so viele Hungers starben. Ehe der Chef des Auffanglagers einen Anpfiff riskierte, entließ er den „German“.
Sein alter Betrieb war froh über den Mann. Ilse klopfte Trümmersteine. Sie schlugen sich durch mit Hamstern und Schwarzem Markt wie alle.
Die neue Besatzungsmacht entdeckte Uranpechblende in den alten Halden des Silberbergbaus im Erzgebirge. Ein Leipziger Beamter durchkämmte die Kartei und sah bei Hermann einen Eintrag als SA-Mitglied. Er konnte nicht wissen, dass der Fanfarenzug der sozialistischen Arbeiterjugend nach der „Gleichschaltung“ nie gespielt, der Eintrag ein letztes Zeichen war. Als „dem faschistischen Staat nahe stehende Person“ sollte Hermann seine Schuld am deutschen Volk büßen im Wismutbergbau. – Der Beamte erreichte seine Sollzahl nicht und ging die Kartei noch einmal durch, fand den erwachsenen Stiefsohn. Warum sollte er einer zweiten Familie Kummer bereiten? Wenige Wochen später lebte Gerhard im fernen Erzgebirge im möblierten Zimmer beim Vater.
Und dieser Vater hat gestern mit dem Obersteiger gesoffen. Gerhard ging nur noch seine neue Schlampe durch den Kopf. Diese Gustl war nie pünktlich, zog sich so neumodisch unordentlich an. – Im Unterleib spürte Ilse in großen Abständen merkwürdige Schmerzen. Im Waschhaus lag die Wismutwäsche im kochenden Kessel und Hermanns leiblichen Sohn trieb der Fußball um. Die säumigen Versicherungszahler hat sie nicht angetroffen. Hätte sie lieber das Waschhausfeuer in dieser Zeit geschürt, brauchte sie jetzt den Jungen nicht suchen – halt, Quatsch! Was haben die säumigen Zahler mit dem Jungen zu tun? Der hätte den Waschtag über Fußball sowieso vergessen!
Ruhiger wurde Mutter. Immer sorgt sie sich um den schwächelnden Jungen. Von ihrer wenigen Milch konnte er sich nicht satt trinken, erlitt alle Kinderkrankheiten der Nachkriegszeit. Oft hatte der Arzt keine Arznei. Nur das Fieber könne helfen, aber – hohes Fieber überlebt er nicht. Wadenwickel dämpfen Fieber. Nächte hindurch saß sie bei ihm, tauchte das Tuch ins kalte Wasser, nass lag ein anderes auf seinen Waden. – Am Morgen kam der Arzt mit dem Fahrrad durch den Regen und fühlte den Puls. Wenn sie noch die Apathie vertreiben könne ... Sie ist gelaufen und gefahren durch den Leipziger Westen, ein Spielzeug zu finden. Endlich konnte sie eine Holzeisenbahn aufs Tablett stellen. Eine Lok mit Tender, Langholzwagen, Güterwagen und Personenwagen gruppierte sie im Halbrund und schob alles auf seiner Bettdecke vor ihn hin. Sie sah aufs Thermometer, ob sein Fieber die Vierzig übersteige. Es blieb darunter. Sie ließ die Wadenwickel und hoffte, dass dieses Spielzeug in seine Augen dringen möge. Die sahen glasig und stumpf. Ein heißes Händchen griff vorsichtig an die Lok, ruckte sie hin und her. In der nächsten Nacht schien ihr, dass er besser schlafe. Am Morgen suchten seine Augen. Beim Füttern war er bei der Sache, trank den Tee, sah sie an. Dann griff er zur Lok. Er zog den Zug, achtete, dass sich die Wagen nicht verhakten.
Ihr Herz wurde leichter. Sie wird ihn durchbringen. Sie wird ihn immer behüten und beschützen müssen. Sie konnte ihm nur so wenig mitgeben. Als Frau hatte sie ihre große Zeit, als schlank in Mode kam. Sie hat gewusst: Sie war mager aus Mangel, nicht von Figur. Ihre Brust blieb immer klein, kaum gab sie Milch. Und nachfüttern – womit?
Stets ist Bernd als Kleinster und Schwächster aufgewachsen. Mit den Gedanken schien er schnell zu sein, merken konnte er gut. Kam sie doch mit ihm in den Laden an der Ecke, und die Verkäuferinnen sagten: „Bernd, sing den Schlager, sing!“ – Und Bernd sang ohne Stocken einen englischen Text. „Von Gerhard gelernt!“ – Auf der Bühne des Kindergartens spielte er einen Schornsteinfeger. „Ich kann das doch!“ – Ihr ging das Herz auf. Sie wollte ihn behüten und beschützen. Er sollte es besser haben als sie selbst.
Mutter und Sohn erreichten schweigend ihr Haus. In der Waschküche hieß sie ihn auf einen Stuhl steigen und aus dem großen Waschkessel die Wäschestücke mit einer langen Holzstange herausfischen. Dann klatschte er sie tropfnass auf einen Ablagetisch. Sie montierte die Handmangel an den Holzbottich. Die letzten, schweren Wäschestücke holte sie selbst aus dem Kessel. Er schob sie in die Mangel, sie drehte die Kurbel. Sie wies an, er führte es schweigend aus. – Er tat ihr leid, denn er ertrug mehr, als er verdient hat. Es kam ihr nicht in den Sinn, ihm das zu erklären, sich zu entschuldigen. Was hat sie selber aushalten müssen ohne Erklärung? Sie musste lernen, damit umzugehen. So ist das Leben. – Gemeinsam schöpften sie das Wasser aus dem Kessel. Sie stand auf dem Stuhl, beugte sich immer tiefer und reichte ihm den vollen Eimer hinunter zum Auskippen. – Das strengte ihn an. Ihm fiel alles schwer, was mit den Händen zu tun war. Das lag nicht nur am Gewicht. Beim Kartoffelschälen spielten seine Finger nicht mit. Er wird sein Brot nicht mit den Händen verdienen können, sein Kopf muss ihn ernähren. Sie wird ihn dahin lenken. Vielleicht wird er – ein Künstler? Auf jeden Fall was „Besseres“. – Doch jetzt musste die Wäsche aufgehängt werden.
Bernd bückte sich, griff ein Wäschestück und hielt es Mutter entgegen. Sie nahm es ab. Das ging flink. Bernds Pausen waren nicht so lang, wie er sie sich wünschte. Er bewunderte die schnellen Finger seiner Mutter. Er strebte nach langen Pausen, zu messen, wie flink er selber war. Das Ergebnis befriedigte ihn nicht. In den kurzen Pausen blickte er an Mutter vorbei auf die blaue, ferne Kante des Erzgebirgswaldes. Es wunderte ihn, wie verschiedenfarbig sie aussah. Bei Regen stand sie grau vor diesigen Himmelsrand. Grün herrschte vor, wenn sich Sonne und Wolken den Himmel teilten. Heute ging es in zartes Blau über, das Sehnsüchte bei ihm weckte, zu wissen, was dahinter sei. Tiefblau war die Kante, wenn die Sonne alle Wolken vom Himmel fegte. Komisch, dachte Bernd, heute hätten Hagel, Blitz und Donner am Himmel sein müssen, und die Waldkante dürfte nicht zu sehen sein, wenn der Himmel eigenes Erleben widerspiegeln würde. Sagt man doch so, eine ganze Wissenschaft gäbe es darüber, Astrologie genannt. Alles Quatsch, was die Erwachsenen da so erfinden. Heute war schönster Sonnenschein, nicht zu warm, ideal zum Fußball spielen, und ...? – „Träumst du?“ – Ach, ja ...! Er bückte sich. Dann war er wieder im Rhythmus von Mutters Händen. – Nun setzte sich die Sonne auf den fernen Wald. Der wich vor dem gelben Ball, verbog und verfärbte sich. Er wird nicht sehen, wie die Sonne dahinter verschwindet. Das letzte Wäschestück reichte er hoch. „Fertig!“ – Mutter streckte den Rücken, hob die Arme und reckte die Hände in den Himmel. „War ein langer Tag.“ Noch immer spürte sie Schmerzen. „Komm ins Haus!“ – Bernd nahm den leeren Wäschekorb und trottete ihr nach.
In der Nacht holte der Himmel nach, was er am Tag versäumte. – Er schlief nicht gut, wachte mit Unbehagen auf. – Am nächsten Morgen duftete die Luft wie frisch gewaschen. Letzte Wolken fetzten über einen hellen, blauen Himmel. Bernd sinnierte, was ihn von seinen Klassenkameraden erwarten möge. Auf dem Schulweg bummelte er ganz gegen seine Art. Erst kurz vor dem Klingeln erreichte er den alten Backsteinbau aus Kaiser Wilhelms Zeiten.
In der ersten Pause umringten ihn seine Mitspieler. – „Hast eine strenge Mutter?“ – Bernd nickte. – „Hast nicht gezuckt!“ Achtungsvolle Blicke. – Dann gingen sie auseinander. Bernd half wie gewöhnlich, erklärte eifrig. Der Andere begriff, was er gestern nicht verstand. Bernd besaß viel Übung beim Erklären.
Sie rasten den kurzen, steilen Schulberg hinunter und schubsten sich beiseite. Danach lösten sich Gruppen. Die Vorstädter liefen durch Straßengewirr zum Wolkensteiner Tor. Längst stand kein Tor mehr dort. Die große Hauptstraße teilte sich. Links führte sie hinunter ins ferne Chemnitz. Von dort sollen viele Menschen gekommen sein, Annaberg zu gründen, als das Silbergeschrei durchs westliche Erzgebirge hallte.
Am Wolkensteiner Tor gingen die „Talbewohner“ den steilen Schotterweg hinab. – Diesen Weg ging Bernd einmal in der Woche nachmittags zur Christenlehre. Das war so selbstverständlich wie das Brot, das er zum Erntedankfest in die Sankt-Annen-Kirche trug. Sonst hatten die Eltern wenig mit der Kirche im Sinn. Vor der Bescherung sangen sie gemeinsam, beteten, und eine Krippe stand unter dem Baum. Bei der Christenlehre wirkte der alte Küster hilflos, wenn er erzählte, wie die Wasserfront zur Seite wich, weil „Gottes auserkoren Volk“ durch das Meer aus Ägypten floh. – Warum so umständlich, fragten die frechen, kleinen Kerle. Wenn ihr allmächtiger Schutzherr dem Wasser befehlen kann, ist es für ihn doch einfacher, sein „auserkoren Volk“ dort zu lassen, wo es war? – Sie sollten sich nicht versündigen, widersprach der alte Herr. Gottes Ratschluss sei unerforschlich. – Und warum erschlug sein „auserkoren Volk“ im „Gelobten Land“ die dort Lebenden „mit der Schärfe des Schwerts“? Er gab ihnen doch Gebote auf dem Berge Sinai und darin stand: „Du sollst nicht töten!“ – Der alte Küster jammerte über den verlorenen Glauben in dieser schlimmen Zeit. – Sie hörten nicht. Bernd betrachtete die Landkarte vom „Gelobten Land“, das aussah wie eine halbe Birne, links abgeschnitten vom Mittelmeer, rechts am See Genezareth ausgebeult in die Wüste. Er hätte gern von Deutschland eine Karte gesehen, in Heimatkunde reichte sie nur von Chemnitz bis zum Fichtelberg. Er muss warten, bis richtige Erdkunde auf dem Stundenplan steht.
Christenlehre war stinklangweilig. Plötzlich stand am Wolkensteiner Tor ein kleiner Kiosk. „Speiseeis“ las er, „Kugel 35 Pfennig“. Der Verkäufer griff eine nie gesehene spitze Waffeltüte, fuhr mit einer Kelle in einen Behälter und setzte mit einem „Klick“ eine Kugel drauf. Traurig ging er hinunter. Eine Woche kochte er seine Mutter weich. Dann wies er stolz fünfunddreißig Pfennige vor und schleckte sein erstes Eis. Vanille, etwas anderes gab es nicht. Das schmeckte. Vanilleeis versöhnte ihn mit der Christenlehre.
Der Kiosk öffnet erst am Nachmittag. Doch heute war keine Christenlehre. Mit Lale und Wolfgang bog er in die Geyersdorfer Straße ein, die bis Marienberg führt, die nächste Bergstadt, gegründet von Annabergern, als man auch dort Silber fand. Doch so weit war Bernd noch nie gekommen. In Wolfgangs Wohnung in Geyersdorf sah Bernd zur Weihnachtszeit eine elektrische Eisenbahn, eine „Nachkriegsproduktion“. Eine Pikolok, schwarz mit Stromlinienverkleidung, zog drei grüne Personenwagen über Schienen auf einem Gleisbett aus Bakelit, dem neuen Kunststoff. Keine dritte Stromschiene lag dazwischen, wie sie Bernd bei „Vorkriegsbahnen“ gewohnt war. – Er habe schon das moderne Zweileiterstromsystem, sagte Wolfgang wichtig. – Bernd konnte sich nicht sattsehen, wie die kleine Bahn durch Moos, kleine Steine und Wattebällchen fuhr. Ob er das je besitzen wird? Mutter war immer so ängstlich bei allem, was nach Strom aussah.
Heute ging er nicht mit Wolfgang weiter. Im Sommer gab es nirgends Eisenbahnen zu bestaunen. Wo die Straße vom Pöhlberg herunter kam, trennte sich Wolfgang von ihnen. Bernd lief mit Lale abwärts zur Haldenstraße. Dann musste Lale allein weiter gehen. Warum sie Lale so nannten, wusste keiner mehr. Mit ihm war der Schulweg nie langweilig. Er erzählte die neuesten Witze. Mit den „schweinischen“ wartete er, bis Wolfgang sie verließ. Nun kicherten sie aufgeregt. Das schaffte Vertrautheit nur zwischen ihnen.
Wenige Schritte blieben Bernd. Links lag der Krankenhauspark hinter hohem Zaun. Räuber
und Gendarm, Schmuggler und Zöllner, Prinzessin erlösen, ließen sich darin spielen. Vor dem Gärtner blieben sie auf der Hut. Der fing sie nie, sie waren viel zu flink. Die gruselige Stimmung beim Spielen verdankten sie ihm, seinem Poltern, wenn er sie von Weitem sah. Der Gärtner gehörte zum Spiel, das Gruseln, das flinke Ausreißen vor der eingebildeten Gefahr.
Er freute sich der grünen Sträucher in den Vorgärten. Vor allem freute er sich, dass ausgestanden war, was ihm gestern geschah. Heute früh erlaubte Mutter gar Butter unter der Marmelade. Aber nur ausnahmsweise, sagte sie. – Und in der Klasse gewann er an Ansehen. Alles ist gut ausgegangen. Hart im Nehmen muss ich sein, bin ja nicht so stark. Der Rest findet sich. Weglaufen aber – das werde ich nie.
Bernd war heute sehr zufrieden mit dieser frisch gewaschenen Welt und mit sich.
Wismutschatten
Gustl – ich komme!
Inmitten von Kumpeln saß Gerhard im holpernden Sattelauflieger. Ein Wismutbus war ein seltsames Gefährt. Im Krieg hatte er als Laster Munition transportiert. Jetzt saßen Wismutkumpel auf vier längs eingebauten Holzbänken. Sackte eine Seite in die Fahrrille, wurden die Kumpel auf ihre gegenübersitzenden Kameraden geworfen. Diese grünen, verbeulten Blechautos kamen immer und fast pünktlich an. Mehr verlangte niemand in dieser wilden Zeit.
Gerhard freute sich, von Freiberg nach Annaberg durchfahren zu können. Der Bus fuhr viele Schächte an, die Kumpel dorthin zu karren – dennoch wird er eher als mit dem Bummelzug zu Hause sein. Eine Nacht später zu Gustl – nein, lieber vom Bus durchschütteln lassen.
Ein Schlagloch, Gerhard stand unfreiwillig auf und stemmte abwehrend die Hände auf die Schultern seines Gegenüber. – „Na, na, du junger Eleve! Willst du einen alten Hauer küssen?“ – Gerhard saß wieder. „Nee! Dafür kenne ich jemand anderes!“ – Die Kumpel schmunzelten. „Lernst’ Markscheider?“, fragte einer. – Gerhard nickte. – „Mach’ste richtig. Die Wismut ist die einzige Stelle in der ganzen Zone, wo du Geld verdienst. Brauchst nicht bohren und machst dir die Lunge zur Sau. Sie wollen jetzt, dass wir nass bohren. Bei euch auch?“
„Hab neulich meinen Steiger aus dem Streb gedrückt“, hörte Gerhard. „Der redet mir nie wieder rein.“ – „Mir soll auch keiner mehr was sagen. In diesem verdammten Krieg hätte ich zehnmal sterben können. Ich mache mit meinem Leben, was ich will. Basta!“ – „Wir holen ihnen das Atom aus der Erde. Kann ihnen egal sein, wie wir das machen.“ – „Damit sie die Bombe bauen können.“ – „Ach, die Bombe. Der Krieg ist die Mutter aller Erfindungen. Das war und bleibt so. Aber das Atom ist doch nicht nur Bombe. Der junge Kerl hier wird sehen: In den achtziger Jahren gibt es Atomkraftwerke, brauchen wir keine Steinkohle mehr. Atomloks schleppen auf breiten Schienen riesenlange Züge. Vielleicht fliegen auch Flugzeuge damit. Und wir können sagen: Wir waren die Pioniere! Wie die im Wilden Westen!“ – „Komm runter, Kumpel! Erst drückst du deinen Steiger aus dem Streb, jetzt willst du Vorkämpfer der Menschheit sein. Sauf einen, ist reeller!“ Blick durchs Fenster. „Wir sind da. Saufen erst nach der Schicht! Glückauf!“
Der Bus hielt. Alle Kumpel rückten durch und kletterten die beiden Holztreppen an der Rückseite herunter. Andere Kumpel keilten Gerhard wieder ein.
Auf dem Annaberger Marktplatz holte ihn der Busfahrer in die Kabine. An der Haldenstraße entließ er ihn, bog ab zum „Russenviertel“. Das war allen Leuten ein Dorn im Auge. Mit Postenhäuschen und grünem, hölzernen Straßentor versperrte es den Weg zum Bahnhof. Von den Annabergern, die dort ausziehen mussten, redete niemand mehr.
Die letzten Meter in der warmen Kabine des Fahrers ließen Gerhard die Herbstkälte doppelt spüren. Es roch nach Schnee. Hier kam der Winter früh. Im Sommer gab es warme Tage, aber spätestens abends gegen fünf kühlte es ab. Trotzdem – wenn er die fernen Bergketten sah, die vielen Blauschattierungen der Fichtenwälder, wie sie ins Grün wechselten je nach Sonneneinfall und Wolkenstand – das war schön, kannte er nicht aus der Leipziger Tieflandsbucht. Schön war es auch, durch den Pöhlbergwald zu gehen, an den Felsen der „Butterfässer“ vorbei, den zerzausten Vogelbeerbäumen, die sich nie entschieden: Busch bleiben oder zum Baum wachsen? Gerhard fühlte sich heimisch werden in dieser groben Kumpelgemeinschaft, die schuftete und soff, wo Glücksritter unter Tage ihr Leben riskierten, und auf dem Arschleder Erzrutschen hinunter schlitterten, nur um schneller an den Fahrkorb zu kommen. Er begann, das Erzgebirge zu lieben, das seit Jahrhunderten nach Wald und Bergbau roch. Es stimmte die Menschen freundlich, selbst die rauen Wismutkumpel.
Und da war noch Gustl. Sie werden abends Boogie-Woogie tanzen, er wird sie heimbringen durch den Wald zu einem der kleinen, schiefergedeckten Häuser in der Pöhlbergsiedlung. Nur Mutter musste er noch überwinden. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden.
Gerhard stieg die Treppen hoch zur Bodenkammer. Bald wird Mutter zetern – wenn er sagt, er geht zu Gustl. Er räumte die Kluft in den Spind und nahm ein gutes Hemd heraus.
Sie ist zu dumm für dich. – Ja, sie hat nur die sechste Klasse, wie so viele Flüchtlingskinder.
Sie ist liederlich, zieht sich liederlich an. – Die Mode ist so. Du willst es nur nicht sehen.
Sie hat dich bestohlen. – Ich sagte ihr: Nimm meine Brieftasche und bezahle die Torte. Warum, Mutter, willst du mir nicht glauben?
Gerhard rückte den Schlips gerade, betrachtete sein Spiegelbild und fand sich passabel. Er sah sich prüfend um. Ein Bett, ein Nachttisch, ein Kleiderschrank, für einen Stuhl reichte der Platz nicht mehr. Decken verhüllten die Latten der Trennwand – eine Eishöhle im Winter, eine Sonnenhölle im Sommer. Schlimm, wenn er hier tags schlafen sollte, weil seine Schicht es so verlangte. Nichts lag herum. Er warf die leichte Tür zu, dass die Lattenroste federten, und stieg die knarrenden Holzstufen herab.
Als er die Wohnungstür schloss, trat Mutter aus der Küche. „Willst du zu Gustl?“ – Gerhard nickte. – „Ja, geh nur. Vater kann heute niemand brauchen.“ – Nanu? „Ist was passiert? Ein Unglück?“ – „Nein. Sie haben ihn rausgeschmissen. Fristlos gekündigt.“ Mutter lehnte am Türrahmen, sah zu Boden und atmete schwer. – „Aber warum? Vater war doch gut!“
Sie nahm ein Taschentuch und tupfte Tränen aus dem Gesicht. „Neue Leute sind in der Wismutleitung. Sie ist nicht mehr rein russisch, heißt jetzt Sowjetisch-Deutsche-Aktien-Gesellschaft. Die neuen, deutschen Herren wollen keine unzuverlässigen Leute, sagen sie. Alle Nazis müssen gehen.“
Vater und Nazi – ein Witz, wäre es nicht so traurig! Als Nazi holten ihn Russen zur Wismut. Überraschend wurde er mit Leib und Seele Bergmann. Als Nazi muss er bei Deutschen wieder gehen. Den Menschen hinter dem Papier schauen sie sich nicht an. Sie haben die Macht! Oh, wenn sie was von ihm wollen, sie sollen ihn kennen lernen, ihn, den Gerhard! So mit Vater umzuspringen!
„Was wird nun, Mutter?“ – Zum ersten Mal sah Gerhard Mutter hilflos. Dünn stand sie vor ihm, schwach, die grauen Augen stumpf. – „Was soll werden? Wir müssen uns Arbeit suchen. Aber viele sind entlassen worden. Was gibt es hier anderes als Wismut? Wir konnten Geld sparen. Doch wie lange muss es reichen?“ – Plötzlich straffte sie sich. „Ich will nicht klagen. Wir waren krank, wir haben gehungert. Jetzt sind wir gesund, sind satt, wir schaffen das. Sag Guten Tag. Dann lass Vater! Wasch dich, ehe du gehst. Komm nicht zu spät!“
So kannte er Mutter. Ein dünnes Blatt, gebeutelt vom Wind, hielt sie fest am schwankenden Ast, fing sich und saß wieder als Glucke auf ihrer Brut: „... wasch dich, komm nicht zu spät ...“ Beinahe hätte er protestiert, dass er schon lange volljährig sei.
Er trat in die Küche, sah Vater auf dem Sofa. Mit angewinkelten Beinen lag der kleine Mann seitlich, die Augen zur Wand gekehrt, ein leichtes Schluchzen schüttelte ihn. Er wendete den Kopf. Gerhard sah in rote, trockene Augen. „Vater, du bist doch nicht schuld! Warst immer ein guter Steiger. Selbst in Freiberg kennt man dich.“ – „Was nützt es? Russen haben mich geholt. Deutsche schmeißen mich raus.“ Er sah seinen großen Sohn an, den Ilse in die Ehe brachte. Stolz regte sich in ihm, ließ ihn den Augenblick vergessen. „Du hast dich fein gemacht. Geh, lass dir nicht den Spaß verderben.“
Gerhard beugte sich herab, drückte seinen Kopf ganz eng an Vaters Wange, umarmte ihn. – „Ist gut, Gerhard. Viel Spaß! Nun geh schon!“
Im Flur stürzte Bernd auf ihn zu. „Gerhard, ich soll im Schlafzimmer bleiben, bis es Vati besser geht. Aber ich muss dir doch Guten Tag sagen!“ – „Darfst du, Kleiner, darfst du.“ – „Sag mal, du hast einen Fußball gegen eine Mandoline getauscht, stimmt das?“ – Oh, Gott! Die Sorgen eines Elfjährigen! „Ja.“ – „Wie kannst du einen Fußball weggeben, einen Fußball?“ – „Später. Jetzt muss ich mich waschen. Lass die Eltern in Ruhe.“ – „Ja, schlimm mit Vati und dem Schacht. Aber Vati macht das schon.“ – „Sicher. Wir haben starke Eltern, nicht wahr?“
Bernd ging zurück in die Schlafstube. Er kramte in alten Kartons und fand seine alte Holzlokomotive. Mit ihren Rädern drückte er früher Schienen in den Erdboden, fuhr auf ihnen entlang, rangierte, pfiff und kuppelte die Hänger an. Das ging hier nicht. Seiner Würde war nicht angemessen, was er tat. Beschäftigen soll er sich, sagte Mutti. Ein Lokführer muss auch eine alte Lok fahren. Lokführer ist er eines Tages ganz bestimmt. Oder lieber Staatspräsident? Der Wilhelm Pieck lief durchs Kinderferienlager und schüttelte Hände. Die Großen drängelten sich alle vor. So umjubelt – da wäre er gern Staatspräsident! Der Wilhelm Pieck ist ein freundlicher Opa. Bernd hätte gern einen Opa. Der müsste sein wie Wilhelm Pieck. Also wird er Staatspräsident. Beschlossen. Oder doch lieber Lokführer? Ach was, er hat ja noch Zeit.
Gerhard verließ das Haus. Kalter Wind ließ ihn frösteln, er bedauerte seine Größe. Sie half ihm viel. „Hat Schlag bei den Weibern“, sprachen neidisch die Kumpel. Sie sahen nicht, er tat auch etwas dafür, wusch sich nach der Schicht gründlicher, verschmähte die Hilfsmittel der Frisöre nicht. Bei Gustl verfing das. Seine Kumpel gaben sich stolz, rau, „Kerle“ zu sein. Doch er gewann sich Gustl, die alle begehrten.
Endlich stand er vor ihrem Gartentor. Ein wenig aufgeregt drückte er die Klingel.
In der Tür erschien ein schlankes Mädchen. Freudig wieselte sie die Stufen herunter. Stolz betrachtete er ihre blonden Locken, sah in ihre blauen Augen über einer kleinen Nase zwischen starken Wangenknochen. Sie hatte ihm erklärt: Von der Nase nach oben bin ich Schwedin, nach unten Polin oder Russin, geredet habe ich immer Deutsch, gelebt im Memelland, geboren als Litauerin, wir sprachen von uns als Balten. Aber wer kennt hier Balten? Hitler holte uns „heim ins Reich“, und Ende vierundvierzig flüchtete Mutter im Treck. Die zwei Alten nahmen uns auf. Mutter starb im Hungerwinter siebenundvierzig, mein Vater ist vermisst. Die beiden Alten behandeln mich wie ihre Tochter. Ich habe es gut getroffen.
Ganz schnell ging das Gerhard durch den Kopf, während sie in einem warmen Baumwollkleid zu ihm lief. Sie umarmte und küsste ihn. Ihm blieb die Luft weg. „Dass du schon da bist! Komm rein!“
Die beiden Alten saßen auf einem Schwatz beim Nachbarn. Gustl zog sich um. Er saß allein auf der Ofenbank in der „guten Stube“ und erinnerte sich.
In diesem Wohnzimmer haben sich die Alten und seine Eltern beschnuppert, da es doch zwischen ihnen „’was Festes“ schien. Mutters missbilligende Blicke glitten über die vielen bestickten und mit Spitzen geklöppelten Kissen, auf die geschnitzten Bergleute, Lichterengel, die fünfstöckige „Peremett“, wie die Einheimischen die Weihnachtspyramide nannten, die hier immer zur Wohnung gehört. – Diese „Erzgebirgstümelei“ gefiel ihr nicht. – Sein Vater fühlte sich wohl. Die Männer sprachen über den Schacht. – Gerhard lenkte, dass seine Eltern zum Kaffee blieben. Heimlich schickte er den Nachbarsjungen zum Bäcker, half in der Küche, der künftigen Schwiegermutter zu gefallen. Gustls Blicke kündeten, dass seine Eltern angenommen seien. Er selber war sich seines Teiles nicht sicher.
Auf dem Heimweg nörgelte Mutter. Das Mädchen könne gar nicht ordentlich sein, kein Stil, überall Unordnung. Das Schlimmste: Gustl beklaut ihn. Das entschuldigt Gerhard auch noch. Sie hat aber gesehen, wie Gustl die Brieftasche aus seiner Jacke nahm. Sind die beiden Alten auch nett, sie strebe Besseres an. Bei ihren Versicherungsgängen hat sie genug gesehen. Gerhard wird hier nie das richtige Mädchen finden.
Vater versuchte zu vermitteln. Hier im Gebirge leben die Leute nach anderen Regeln, das müsse sie doch verstehen. – Er kam schlecht an. – Ordnung sei ein Allgemeinprinzip. Außer bei Obersteigers fand sie hier nirgends Ordnung. Aber Obersteigers sind Schlesier. Lieber heute als morgen wolle sie zurück nach Leipzig. Dieses kalte Nest!
Es gab keine Gegeneinladung, aber Mutters ständiges Nörgeln. Mutter war immer zielstrebig und ausdauernd. Er bewunderte das – früher. Jetzt erlitt er das.
Gustl trat ins Wohnzimmer. „Gefalle ich dir?“ Sie drehte sich vor ihm. Ein roter Rock schwang über den Hüften. Im breiten Gummigürtel mit silberner Schnalle steckte eine kurzärmelige Bluse mit spitzem Ausschnitt. Am hohen Hals keinen Schmuck, warum auch? Ihre strahlenden Augen waren Blickfang genug.
Er war stolz. Da flogen blonde Locken, ihre Augen glitzerten ihn an über einer schmalen Taille und rot schimmernden Hüften – Herz, was willst du mehr?
Gustl warf sich ihren Mantel über und legte eine Nachricht auf den Tisch. Sie liefen zur Pöhlbergstraße und oberhalb der Traversen des Sportplatzes zur Festhalle.
Gerhard erzählte, was Vater geschehen ist. Er sprach von seinem Vorsatz, diesen neuen Leuten zu zeigen, dass man sich nicht alles gefallen ließe, er wisse nur nicht, wie. – Das bringt doch nichts, meinte Gustl. Er könne die höchstens ärgern und riskiere dafür seinen Markscheider. Wir sind zu klein, etwas zu bewegen. – Man muss sich aber wehren gegen Unrecht. – Einige aus ihrem Dorf im Memelland glaubten auch, sie müssten sich wehren gegen die Russen. Mutter wehrte sich nicht. Sie sprach freundlich mit Deutschen, sprach freundlich mit Russen und kam heil hier an. Die Stolzen, Tapferen sind lange tot. – Was wollen sie mir schon? Schlimmstenfalls schmeißen sie mich raus. Na und, ich habe einen Beruf! Die Schwestern meiner Mutter haben mir aus Leipzig geschrieben: Musikalienhändler werden wieder gesucht. Du kommst natürlich mit. Leipzig wird dir gefallen. – Sie lasse nicht einfach so über sich bestimmen! – Ist doch nur Spielerei, beschwichtigte Gerhard. Er wollte doch sagen, dass ohne sie gar nichts mehr geht! –„Wirklich?“ – „Wirklich!“ – Gustl blieb stehen. „Du gehst nicht weg?“ – „Ich liebe dich doch!“ Er sah ihren zweifelnden Blick, küsste ihren harten Mund, küsste ihn weich. „Übrigens hatte diese schlimme Sache etwas Gutes. Meine Mutter sagte: Geh zu Gustl, geh!“ – „Vielleicht ein Anfang. Also versündige dich nicht!“
Gustl knickte mit dem Fuß aus dem Tanzschuh, ein Kiesel sprang scheppernd vom Fußweg. Gerhard fing sie auf. Das kleine Malheur ließ sie nach hinten sehen. Eine gelbe Sonne berührte blaue Waldkämme. Aneinandergelehnt betrachteten sie den Farben mischenden Ball, erfreuten sich seines Spiels auf der Palette der fernen Bergwälder. Aus Grün und Blau der Wälder und Gelb der Sonnenscheibe schuf er Nuancen, blitzte mit goldenen Strahlen dazwischen, weitete im Niedersinken die flüssige Mischung des Horizonts. Es geschah so weit weg, und sie sahen es so klar. Die schwarzen Waldkanten rückten sacht der Mitte zu, sogen vom sinkenden, schwächer leuchtenden Ball den letzten hellen Tupfen auf. Ein letztes Glitzern verschwand zwischen schwarzen Kanten.
„Das war es, du romantische Seele.“ – „Nur im Gebirge siehst du so einen Sonnenuntergang, in deinem Leipzig nie.“ – „Aber ich will doch gar nicht nach Leipzig. Sei wieder lieb!“ – „Na gut. Weil du es bist.“ – Sie fassten sich an den Händen und schwangen die Arme.
In der Festhalle stiegen sie auf die Empore. In jener, ach, so wilden Zeit, spielte eine Kapelle drei Tänze, dann trank sie Bier. Die Burschen brachten ihre Mädchen zurück und verbeugten sich. Schüchterne tranken sich an der Theke Mut an. War der Mut groß genug, ging man über den Saal und sagte: „Darf ich bitten?“ Den ersten Tanz schlug ein Mädchen niemals ab.
Bis zur Pause konnte jeder auf diese Regeln bauen. Erste Flirts führten vor die Tür, um „Luft zu schnappen“ – Luft war aber das Letzte, woran man dachte. Es gab auch „ganze Kerle“, die mit ihrer neuen Eroberung im nahen Buschwerk „ganze Arbeit“ leisten wollten. Ohrfeigen zeigten Grenzen. Die Mädchen hielten nicht hinter dem Berg, wie ihr Kavalier gewesen – draußen, vor der Tür. Schwieg eine drüber – war es ernster. Man fragte nicht und sah sich den Burschen an, der sein Mädchen öfter holte, schließlich mit ihr verschwand. Sie, auch er, waren jetzt „in festen Händen“. Das respektierte jeder.
Nach der Pause spielte die Kapelle andere Lieder. War bisher auch „Dr Vuggelbeerbaam“ zu hören, tönten nun Tango, Swing und Foxtrott durch den Saal und zur „Damenwahl“ Langsamer Walzer – der Mädchen Chance. Zwei, drei Runden blieb Zeit, alles in „Sack und Tüten“ zu bringen. Synkopen schmetterten durch den Saal, Boogie war angesagt, von oben erhitzt, wurde unten geschwitzt, verrenkt, der Saal durchmessen und manches Mädchen hochgewirbelt. Alle wollten mitsingen, sich ausleben nach einer Woche Schicht beim Schein der Grubenlampen und dem Rattern der Bohrmeißel. Viele Lieder färbte jeder Saal für sich. Gustl und Gerhard sangen mit wie fast der ganze Saal:
Tschio, tschio, tschio, tschooo!
Käse gibt’s in der HaOooo.
Stunden lang kannste steeehn,
aber Käse, Käse gibt es keeen!
So leitete die Kapelle die zweite Pause ein. Danach spielten sie auch englische, französische und italienische Schlager. Man schaute in die Augen der Partnerin oder soff sich den Rachen voll, um zu vergessen, hielt zärtlich Händchen wie Gustl und Gerhard – Musik blieb Hintergrund, oft auch für handfesten Streit wegen „Beleidigung“, oder „weil der meine Braut befummelt“. Irgendeiner ging schnell dazwischen – den Wirt, gar Polizei rief keiner. Verletzungen – Fehlanzeige, ein blaues Auge zählte nicht. Ungeschriebene Regeln galten – gefährlich war das nie.
Vor Ewigkeiten hatte an den langen Tischen Gerhard die Gustl entdeckt. Nach der ersten Pause tanzte er nur noch mit ihr. In der zweiten duldete sie seine Lippen an ihrer Wange, gestattete ihm, sie heimzubringen durch den Pöhlbergwald. Am Gartentor küsste sie ihn flink auf die Wange und brachte schnell die Tür zwischen ihn und sich, bevor er begriff.
Am nächsten Tag, kurz vor Ladenschluss, hat Gustl Butter umgepreist. Zwanzig Mark kostete das Stück, als sie hier anfing. Jetzt drückte sie fünf Mark in die Halterung. Da hörte sie hinter einem Pfeiler leise einen Schlager summen. Gerhard lachte sie an. – „Hab Frühschicht, da kann ich nach dir sehen.“ – Sie freute sich. – Er brachte sie heim vom Marktplatz, an der Sankt-Annen-Kirche vorbei, vorüber an Festhalle und Sportplatz bis zur Pöhlbergsiedlung, ein langer Weg und immer bergauf. – „Wird ein weiter Heimweg für dich.“ – Er lachte. „Für dich tu ich alles.“ – „Na na! Sei froh, dass ich nicht beim Konsum arbeite.“ – „Warum?“ – „Die müssen noch eine halbe Stunde Marken kleben.“ – „Würde ich auch noch opfern.“





























