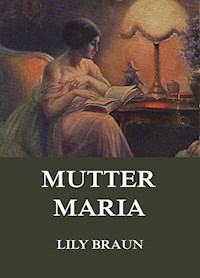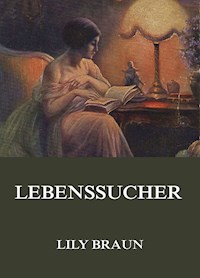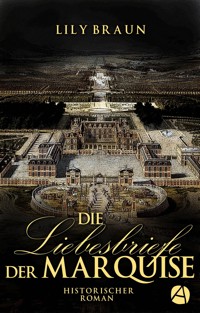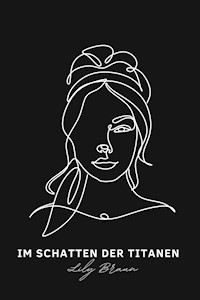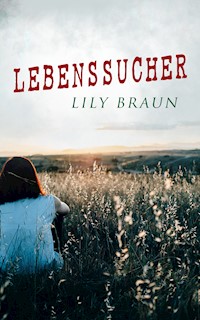0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In ihrem Buch 'Lebenssucher' präsentiert Lily Braun eine tiefgründige Erkundung der menschlichen Existenz und des inneren Kampfes um Identität. Ihr literarischer Stil ist geprägt von einer eindringlichen Sprache und einer nuancierten Charakterdarstellung. Der Roman spielt im Berlin des späten 19. Jahrhunderts und wirft gleichzeitig einen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Normen und die Rolle der Frau in dieser Zeit. Lily Braun gelingt es meisterhaft, die psychologische Entwicklung ihrer Protagonisten zu erfassen und den Leser auf eine introspektive Reise mitzunehmen. Als bekannte Schriftstellerin und Frauenrechtlerin war Braun stark von feministischen Ideen geprägt, was sich auch in 'Lebenssucher' widerspiegelt. Durch ihre eigene Erfahrung und Beobachtung der Gesellschaft gelang es ihr, ein Buch zu schaffen, das tiefe Einblicke in die menschliche Seele bietet und dabei gesellschaftliche Normen subtil in Frage stellt. 'Lebenssucher' ist ein literarisches Meisterwerk, das sowohl Liebhaber psychologischer Romane als auch historische Romanfans ansprechen wird. Dieses Buch ist eine Bereicherung für jeden Leser, der auf der Suche nach einer anspruchsvollen Lektüre ist, die zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lebenssucher
Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel. Wie Konrad Hochseß zuerst das Leben suchte, und was er fand
Es gibt Jahre, in denen der Frühling nicht fröhlich ist; die wenigen Blumen, die er über die Wiesen streut, sind blaß und welken rasch; nur zögernd, fast als fürchteten sie sich, kriechen die jungen Blätter an den Bäumen aus der braunen Hülle; das dürr raschelnde Herbstlaub im Walde wird kaum jemals ganz von einem frischen Moosteppich verdrängt, und auch der klarste, blaue Himmel trägt einen feinen grauen Schleier wie die jungen Nonnen bei der letzten Weihe.
Solch ein Frühling strich mit seiner schlaffen, weichen Luft über die Höhen des fränkischen Jura, spielte im Vorüberstreifen flüchtig mit der zerbrochenen Äolsharfe auf dem grauen Turm von Hochseß, tanzte ein wenig über dem ausgetrockneten, zwischen Nesseln träumenden Ziehbrunnen, um schließlich die schmale Wange und die blonden, glatten Haarsträhnen des schlanken Knaben kosend zu streicheln, der auf der alten efeuumsponnenen Mauer saß und unbewegt in das Land hinausstarrte. Weithin breitete es sich aus vor ihm, von dem engen Tale an, das drunten schlief, eingewiegt vom Murmeln und Plätschern des breiten Baches und dem Klappern der Wassermühle, deren Räder er trieb. Blasse Wiesen schmiegten sich sehnsüchtig an den zärtlichen Freund, als erwarteten sie von seiner Umarmung ihr buntes Blumenleben, und in zahllosen Windungen umschlang er sie, als ob er zögere, sich von ihnen zu trennen; Sträucher von wilden Rosen, Schlehen und Rotdorn, die zum Himmel empor ihre Ästchen streckten, nach heißer Sonne verlangend, die ihre Blüten wecken sollte, umkränzten sie, ehe die Bergwände steil emporstiegen.
Buchen und Eichen, Tannen und Eschen überzogen alle Hänge bis zum Gipfel hinauf. Ihre Stämme, vom silbernen Grau bis zum tiefsten Schwarz, standen gegen den matten Himmel wie Marmorsäulen. Da und dort aber wich der Wald zurück; Felsmauern und Türme überragten ihn finster drohend in wild-verwitterten Gebilden. Zwischen ihnen, so hatte der Knabe einst geträumt – und die Erinnerung daran zauberte ein verlorenes Lächeln auf seine Züge –, hausten die Götter und Helden der Vorzeit, und Sonntagskindern zeigten sie sich in Maiennächten. Sie zu suchen, war er einmal heimlich ausgezogen, ein kleines Bübchen noch, dorthin, wo in gewaltigen Quadern, wie von Zyklopen erbaut, die Riesenburg silbern in der Sonne leuchtete. Sein Auge blieb an ihr haften: wie war damals sein Atem geflogen im steilen weglosen Anstieg, wie hatte sein Herz geklopft im Glauben an das Große, das seiner wartete. Und dann – unwillkürlich hob er die geballte Faust wider die fernen Felsen –, dann, als das mächtige Tor sich über ihm wölbte und fiebernde Erwartung die Brust zu sprengen drohte, hörte er Mädchenkichern und die dozierende Stimme des Lehrers, der die bunte Schar auf gebahnten Wegen emporgeführt hatte, sah um den Rand des höchsten Felsens, der ihm als unnahbarer Wachtturm erschienen war, ein schmächtiges Drahtgitterlein gespannt, sah ein Fähnchen hoch oben flattern, darunter eine Bank, mit hundert Namen bedeckt, – und in einer der schmalen Felsenhöhlen barg er seine Verzweiflung. Dort hatte er die Nacht erwartet, ach, die götterlose Nacht!, war dann hinaufgeklettert, hatte die Fahnenstange mit Anspannung all seiner von der Wut gesteigerten Kräfte aus der Erde gerissen und hinab geschleudert, hatte die wurmstichige Bank zum Kippen gebracht und sich am Drahtgeländer die kleinen Hände blutig gerissen. In Gedanken an die erste, bitterste Enttäuschung seiner Kindheit zog grausamer Spott über sich selbst seine Mundwinkel abwärts, so daß er sekundenlang ganz alt erschien.
Ein Blick in die sonnenüberglänzte Ferne verklärte sein Antlitz wieder. Er folgte dem Bach und dem sich weiter und weiter dehnenden Tal, wo die Wiesen in buntgestreifte Felder sich verwandelten, wo, in Obstgärten gebettet, von Kastanien überragt, rote behäbige Dächer und alte kunstvolle Fachwerkbauten mit spitzen Giebeln um schlankturmige Kirchen sich scharten. Er sah die Schlösser auf den Höhen, die dem toten Felsen gleich gewesen wären, wenn ihre Fenster nicht in der Sonne wie lebendige Augen gefunkelt hätten. Und ganz, ganz fern im Nebelgrau, wie ein phantastisches Traumgebilde, am Fluß gelagert, sich mit Mauern und vielen Türmen zu den Hügeln emporstreckend, lag sie, die Stadt – die großen, schwarzen Augen des Knaben verdunkelten sich noch mehr, seine sehr blassen Hände krampften sich ineinander, so daß die Fingerspitzen sich röteten –, die Stadt, deren strahlender Glanz die Nacht und ihre Gespenster besiegte, deren brausender, auf- und abschwellender Ton die unheimlichen Stimmen der Stille verschlang; die Stadt, über die der Dom, einer Königsfeste gleich, sich erhob und tote Kaiser in seinen hohen Hallen dem Raunen alter, in goldene Roben gehüllter Priester und dem hellen Gesang weißgekleideter Chorknaben lauschten.
An einem Pfeiler stand eine steinerne Madonna. Der Knabe faltete die Hände, seine Augen glänzten wie von innen erhellt. Heimlich dachte er an sie und betete zu ihr, wenn sie ihn Sonntags drunten im Dorf in die kahle lutherische Kirche führten. Und an einem anderen stand auf hohem Roß der gekrönte Ritter, dessen Namen er trug – –
»Konrad!« rief eine Stimme, die klang, als klopfe jemand an ein zersprungenes Glas. Der Knabe hob ein wenig den Kopf, »der Lehrer«, dachte er und sah wieder regungslos sinnend ins Land hinaus. Vor dem dunklen Bilde des Ahnherrn droben im Saal hatte der Führer seiner Kindheit ihn heute feierlicher als sonst an das Heldenbeispiel dieses Mannes mit dem großen schwarzen Kreuz auf dem weißen Mantel erinnert. Er reckte seine schlanke Gestalt, als prüfe er ihre Muskeln: ein Ritter wie jener würde er sein – wenn sie nur erst vor ihm stünden, die Feinde!
»Konrad!« rief es noch einmal; seltsam, wie die letzte Silbe in einem hohen Vogelton lange nachzitterte. Ein weiches Lächeln, wissend und gütig, fast wie das eines reifen Mannes, überflog die Züge des Knaben, und seine rasche Phantasie, für die eine Farbe, ein Ton genügte, um den Vorhang vor einer Welt der Märchen und Wunder emporschnellen zu lassen, zauberte ihm im gleichen Augenblick all die Bilder vor Augen, die jene Stimme, so lange er denken konnte, heraufbeschworen hatte: weiße, von üppigen Rosen umsponnene Schlösser unter dunkelblauem Himmel, schwarzäugige Frauen in königlichen Sälen, eine Stadt von Palästen, bewohnt von einem Volk der Mediceer, und seine heiße Sehnsucht spannte ihre Flügel weit – weit.
Er glitt von der Mauer herunter.
»Die Großmutter«, flüsterte er im Weitergehen.
»Konrad!« klang es zum dritten Male. Und wieder eine andere Stimme, wie das Meckern einer Ziege. Jetzt aber lachte der Gerufene hell auf und war mit ein paar Sätzen – die Muskeln der langen, schlanken Beine spielten unter den dünnen Strümpfen wie die eines Vollblutpferdes – unter den Kastanien, an denen die roten Blüten leuchteten, vor dem Haus.
»Bin ich zu spät, Giovanni?« Der Angeredete, ein spindeldürres Männchen, um dessen krummgezogenen Körper die ausgewaschene Sommerjacke in tausend Falten schlotterte, meckerte fröhlich auf, seine Augen, winzige schwarze Kohlenpunkte im braungelben, verknitterten Pergament des Gesichts, umfaßten den Knaben mit einem Ausdruck leidenschaftlicher Zärtlichkeit.
»Tut nix, tut nix, bambino mio«, sagte er und streichelte seinen Arm mit jener scheuen Bewegung, mit der der Sammler seinen kostbarsten Schatz zu betasten pflegt, »wir träumten einmal wieder?«
Konrad streckte die Arme mit gespreizten Fingern weit aus, als gelte es, die Welt zu umarmen.
»Vom Frühling, nicht wahr?« flüsterte der Alte mit einer vor Erregung vibrierenden Stimme, »von unserem Frühling? Von heißer Sonne und roten Rosen? Von – daheim?!«
»Von daheim!« wiederholte Konrad mit einem verlorenen Blick. Dann strich er sich mit den langen schlanken Händen über die Stirn und lachte auf. »Nein, nein! Ich dachte nur an morgen. Dann bin ich fort, fort in der Stadt bei den vielen Buben, die alle jung sind wie ich, mit denen ich toben kann und mich balgen, und tanzen und reiten und schwimmen. Wo ich nicht immer allein sein werde wie hier zwischen lauter – lauter –«
Er stockte und senkte, übergossen von Schamröte, die Stirn.
»Zwischen lauter Alten!« ergänzte Giovanni; sein Kopf nickte ruckweise wie der einer Marionette, er zog das dünne Röckchen fester um die Schultern, als fröre ihn. »In der Stadt hört freilich das Träumen auf. Da arbeiten sie und schwitzen über den Büchern. Da sind auch die Jungen alt.«
Auf dem Antlitz des Knaben erlosch die Freude; er warf einen ängstlich fragenden, scheuen Blick auf den Gefährten, der mehr zu sich selbst, als zu ihm zu sprechen schien. » Niente – niente, bambino mio– du wirst frieren, noch mehr frieren als hier, wirst sehen, wie sie in den Straßen hin und her laufen, um warm zu werden; wie sie alle suchen – und längst vergessen haben, was sie suchen. Nur Träume leben –«
Seine Stimme verlor sich in ein heiseres Flüstern und verklang wie ein ferne plätschernder Bach. Über Konrads Züge flog ein halb selbstbewußtes, halb mitleidiges Lächeln.
»Einen Sack voll Träume, die ich erlebte, bringe ich dir mit wenn ich heimkomme,« sagte er überlaut mit seiner noch unschön mutierenden Knabenstimme, als wollte er durch den starken Ton den Eindruck des gehörten Geflüsters überwinden. Neckend zupfte er den in sich Versunkenen an den spärlichen Haarlöckchen; den Körper des Alten durchzuckte es. Er reckte sich auf und strich sich, beglückt über diese Liebesbezeugung, über den spitzen Schädel.
»Konrad!« klang die weiche Frauenstimme noch einmal. Der Gerufene lief ihr entgegen.
»Ein echter Savelli,« murmelte Giovanni stolz, den schönen Knaben mit den Blicken zärtlich verfolgend, »ein echter –« und er verstummte jäh. Gerade hatte ein Sonnenstrahl Konrads Haupt getroffen, die Haare blitzten goldig auf.
»Zweierlei Blut – zweierlei Blut! –
Das tut nicht gut – das tut nicht gut –«
zischelte er kopfschüttelnd. Seine Gestalt knickte wieder zusammen. Hinter dem Ziehbrunnen verschwand er. Dann ächzte und knarrte noch von ferne die Turmtür.
Auf der Terrasse, wo in großen weißen Kübeln runde Lorbeerbäume standen und sehnsuchtkranke Glyzinen an der Hauswand mühsam emporkletterten, saß die Gräfin Savelli, in viele weiche, bunte Kissen geschmiegt, am Teetisch.
»Verzeih', Großmama –« mit der Gebärde aufrichtiger Hingabe beugte sich der Knabe über die dargebotene Hand. Weiß und schmal und schmucklos, mit perlmutterglänzenden Nägeln an den spitzen Fingern, streckte sie sich ihm entgegen. »Wie schön sie ist!« sagte er erstaunt, als sähe er sie zum erstenmal, und vergaß darüber den Kuß. Die alte Frau zog ihn an sich, so daß der Duft ihrer weichen weißen Haare ihn umschmeichelte. Dann warf sie einen raschen triumphierenden Blick auf den kleinen Kreis um sich. Die beiden glattgescheitelten Damen neben ihr, die sich glichen wie ein Ei dem anderen, – sie trugen sogar dieselben grauen, schwarz-getupften Satinkleider auf den dürren langen Gestalten, dieselben schwarzen Zwirnhandschuhe über den mageren breitkuppigen Fingern – sahen einander mit hochgezogenen Brauen an. Der alte Schulmeister, der trotz des Jahrzehnts, das er hier oben verlebt hatte, nicht anders als auf der äußersten Kante des Stuhles zu sitzen vermochte, lächelte pflichtschuldigst.
»Unsere letzte Teestunde, Konrad,« hub die Gräfin an, und über ihre schwarzen noch immer lang umwimperten Augen legte es sich wie ein Schleier. Dem Knaben stieg das Blut in die Schläfen: durfte er seiner Seligkeit Ausdruck geben oder mußte er Abschiedsschmerz heucheln?
»Dummer Junge,« fuhr sie mit erhobener Stimme fort, als empfände sie seine Gedanken, und ihre Augen blickten wieder klar, »sind wir sentimental wie die Deutschen?« Ihre Worte pfiffen wie ein Peitschenhieb über den Köpfen der anderen; die beiden grauen Fräulein senkten die hellen blonden Scheitel.
»Er ist und bleibt ein Hochseß,« sagte die eine von ihnen scharf, ohne den Blick zu erheben. Die Gräfin lachte, ein helles klingendes Mädchenlachen.
»Kein Zweifel, Tante Natalie, kein Zweifel!« Und dann mit geschürzten Lippen: »Sind wir nicht alle stolz auf die Mischung?« Natalie räusperte sich vielsagend. Elise, ihre Schwester, setzte mit lauterem Geräusch, als es der guten Form entsprochen hätte, ihre Tasse auf den Tisch.
»Kommt er nicht in eine deutsche Pension? Hat er nicht in unserm lieben Habicht einen echten deutschen Schulmeister gehabt?« frug die Gräfin halb spöttisch, halb gelangweilt, es war in den acht Jahren, seitdem sie Konrads Erziehung allein zu leiten hatte, nicht das erste Gespräch der Art, »und zwei deutsche Tanten, die, wenn man's ihnen nicht auf das bloße Ansehen hin glauben würde, ihre Reinheit von jedem Tropfen welschen Blutes bis ins zwölfte Jahrhundert hinein nachweisen können!«
»Und – –,« Tante Elisens Stimme zitterte.
»Ich weiß – ich weiß,« lachte die Gräfin, »und eine italienische Großmutter, die alles wieder verdirbt!«
»Nein, o nein!« widersprach Natalie mit betonter Höflichkeit, »aber einen italienischen Komödianten, der dem Jungen nichts als phantastische Geschichten in den Kopf gesetzt hat und seine evangelische Seele mit Heiligenlegenden vergiftet.«
Konrad wurde noch einen Schein blasser. Er warf einen heißen Blick voll Haß auf die grauen Tanten. Seiner Großmutter schöne Hände, die auf der Armlehne ruhten, schlossen und öffneten sich abwechselnd, und ihre Fußspitze ging im gleichen raschen Takt auf und nieder.
»Der arme Giovanni!« Die Gräfin schien vollkommen ruhig, während ihr Blick sich ganz in der Ferne verlor. »Vergeßt ihr immer wieder, daß er meiner Lavinia letzte Freude war? Unter den Kastanien lag sie in Decken gewickelt, ganz ausgestreckt, schon vom Tode gezeichnet und freute sich doch wie ein Kind, als der gelbe Kasten mit dem schwarzäugigen Volk in den Hof rumpelte. Die hellen Tränen liefen ihr über die blassen Wangen, als sie unsere Lieder, unsere weichen sehnsüchtigen Lieder sangen! Was wißt ihr davon, wie das unsereinem tut – es sind gar keine Töne, es sind die Schläge unseres Herzens, die Stimme unseres Blutes! – Und die Tänze dann! Nicht euer stumpfsinniges Drehen mit gesenkten Lidern, sondern ein Kampf zwischen Mann und Weib –«
»Aber meine Beste!« tönten wie aus einem Munde die scharfen Stimmen der alten Fräuleins.
»Ach so – das Kind!« sagte die Gräfin; der spöttische Ton, den sie anschlagen wollte, gelang ihr nicht. Sie erhob sich rasch. »Gehen wir, es wird kühl.«
Aber schon war der Knabe, der inzwischen unruhig hin und her gerückt war, aufgesprungen und hatte sich mit beiden Händen auf den Tisch gestützt, daß die Gläser leise klirrten.
»Jetzt – jetzt muß ich es sagen,« brach es mit rauher Stimme tief aus seiner Brust hervor.
»Konrad!« mahnte der Lehrer; ein verweisender Blick der Tanten traf ihn; nur die Großmutter schaute ihn an, eine große, heiße Erwartung in den Augen.
Dann aber, als sie ihn zittern sah, legte sie ihm mit rasch aufsteigender Angst die Hand beruhigend auf den Arm. Seit der Arzt ihr gesagt hatte, daß des Enkels Herz schwach sei, verdoppelte sich ihre Sorge um ihn.
»Ich muß es – weil ich morgen gehe. Weil ihr Giovanni nicht leiden könnt, weil – weil –« seine Knabenstimme überschlug sich, in den Schläfenadern pochte sichtbar das Blut, während die Wangen nur um so tiefer erblaßten, »ich leide es nicht, daß ihr ihn höhnt und zankt. Mit seinen Späßen und Kunststücken hat er die Mutter lachen gemacht. Ich hatte es nie, nie gehört. Ich horchte verwundert auf, und ich lachte mit ihr; zum allererstenmal lachte ich mit meiner Mutter! Dann brachte man sie in ihr Zimmer hinauf, in ihr weißes, großes, kaltes Bett,« ein Schluchzen drohte ihm die Stimme zu ersticken, aber er bezwang sich, »die Kunstreiter zogen davon – nur Giovanni blieb. Er spannte ein Seil vom Turm über den Hof bis zum Torweg. Da konnte die Mutter vom Bett aus sehen, wenn er seine Sprünge machte, seine Gesichter schnitt. Wie sie lachte; wie sie froh sein konnte! Der Vater –,« ein harter Zug grub sich mit tiefen Falten in das weiche Knabenantlitz – »der Vater war nicht da –«
»Konrad, du versündigst dich –« Tante Natalie stand drohend dicht vor ihm.
»Weil ich sage, was ihr wißt, so gut wie ich: daß der Vater nicht da war, als – als –,« seine Stimme erstickte in wildem Weinen.
Gräfin Savelli zog ihn an ihr Herz. » Mio caro amore–« sie überschüttete ihn mit Schmeichelnamen, aber sein Körper zuckte, von der Erregung geschüttelt, in ihren Armen.
»Guten Abend,« sagten Elise und Natalie und verschwanden nach einigem geräuschvollen Stühlerücken hinter der Glastür des Gartensaales.
»Guten Abend,« sagte der Schulmeister; er hatte feuchte Augen und strich mit einer bebenden Hand über seines Zöglings blondes Haupt.
Nun waren die beiden allein. Vom Tale her stiegen in feinen Schleiern die Nebel auf.
Konrad warf einen zögernden Blick um sich, um gleich darauf die großen angstvoll aufgerissenen Augen fragend der Großmutter zuzuwenden.
»Willst du mir nicht sagen – jetzt am letzten Abend sagen – wie es kam, daß – daß er nicht da war?«
Die Gräfin richtete sich gerade auf; in ihren Augen entzündete sich ein grausamer, gelber Funken wie in der Pupille der Löwin, die, zum Sprunge bereit, vor dem Feinde ihrer Jungen auf der Lauer liegt. Sie sprach, wie immer, wenn sie mit dem Knaben allein war, italienisch, aber ihre Stimme kam tief und rauh aus der Kehle, so daß die vollen Laute von den Zähnen, durch die sie gepreßt wurden, zerrissen schienen.
»Drüben auf dem Eckartshof war er zur Jagd geladen. ›Bleibe bei mir, Manfredo – nur heute verlaß mich nicht,‹ flehte Lavinia – sie war an jenem Tage so weiß wie das Linnen, das sie deckte, nur ihre Haare lagen um sie wie ein schwerer, schwarzer Trauerschleier – und ich sah, daß dem Mann, der den ganzen Frühlingsduft der Erde mit sich hineintrug, vor ihr grauste. ›Ich kann nicht,‹ sagte er gequält, küßte ihr flüchtig die kalte, kraftlose Hand und ging. Sie aber lag von da an regungslos in den Kissen; die Tränentropfen allein, die unaufhaltsam unter den langen Wimpern ihrer geschlossenen Lider hervorquollen, bewiesen mir, daß sie noch lebte. Giovanni spannte indessen sein Seil vor ihren Fenstern. Aber sie sah seine Sprünge und Grimassen nicht. Da begann er den Tanz mit Gesang zu begleiten, und sie schlug die Augen groß auf. Welche Augen! Als laure der Tod in ihrer Tiefe!
Ich schickte nach dem Eckartshof. Aber sie saßen an der Frühstückstafel und ließen sich nicht stören. Da ging ich selbst. Und geradenwegs, an den verblüfften Dienern vorbei, in den Saal. Blond und weiß, mit Rosen auf den Lippen und den Wangen, saß die Hausfrau neben ihm. ›Lavinia stirbt,‹ rief ich in ihr Gelächter und wandte mich wieder zum Gehen. Ich sah, wie das Blut, das eben noch von Lebenslust gepeitschte, aus den Gesichtern wich, und fühlte die Stille, die ich zurückließ.
Er folgte mir – langsam, widerwillig, er, der sich einmal verzweifelnd mir zu Füßen gewunden hatte, als ich ihm Lavinia versagte!
Wir stiegen stumm den Berg hinauf. Plötzlich aber schoß er an mir vorbei, der helle Schweiß stand ihm auf der Stirne, es war, als jage ihn der Schrecken. Meine Hoffnung begleitete seinen Lauf. Erwachte nicht vielleicht mit der Liebe das Leben wieder?!
Ich betrat den Hof. Er war voller Menschen. Sie schwiegen alle, den entsetzten Blick auf einen Punkt geheftet, da lag Giovanni unter dem Seil in seinem Blut. Lavinia aber war tot.«
Die Gräfin Savelli schwieg. Sie war nun ganz zusammengesunken und sah sehr klein und sehr alt aus. Der Knabe zitterte, daß die Zähne ihm aufeinander schlugen.
»Sieh dort hinaus!« mahnte die Großmutter; ihre weiße, in die unbestimmte Ferne weisende Hand schimmerte wie von innen erleuchtet; »und nicht zurück! Dort suche das Leben!«
Am nächsten Morgen fuhr der alte, wappengeschmückte Wagen den letzten Junker von Hochseß zum Hoftor hinaus nach dem Bahnhof. Es regnete, ein lautloser, gleichmäßiger Regen, von einem gleichmäßig weißgrauen Himmel herab. Unter der Haustür standen die Tanten; in den mageren schwarzbehandschuhten Händen hatten sie weiße Tüchlein, die aber nicht recht wehen wollten, als sie sie hochhoben; der alte Lehrer stand hinter ihnen und schluchzte. Giovanni hatte sich in sein Turmzimmer eingeschlossen.
Die Gräfin Savelli begleitete den Enkel in die Stadt und ging mit ihm hinauf in den Dom, um dessen Säulen und Arkaden die Dämmerung ihren feinen Schleier wob. Sie sprachen kein Wort miteinander; aber zu dem königlichen Jüngling erhoben sich zu gleicher Zeit ihre Blicke, den ein unbekannter Künstler in Stein gemeißelt hatte, ein Vorbild reiner Ritterschaft. Konrad war, als sähe er sich selbst im Spiegel und als lächle der Doppelgänger ihm freundlich zu. Stumm drückten Großmutter und Enkel einander die Hände.
Dann gingen sie. Und die Gräfin Savelli übergab ihn mit ein paar freundlich-kühlen Worten dem Gymnasialdirektor Professor Traeger und seiner Ehefrau, deren behäbige Fülle und betonte Matronenhaftigkeit von seinen langen dürren Gliedern und sorgfältig frisierten Haaren seltsam abstachen. Die allzu tiefen und allzu häufigen Bücklinge, mit denen beide die Großmutter bewillkommneten und dann zur Türe geleiteten, als sie ging, hatten Konrads Urteil über sie unwiderruflich festgelegt.
Das war seine erste Enttäuschung. Denn in seinen Träumen war ihm der Direktor als ein Mann von Würde erschienen.
An der Abendtafel sah er die anderen Pensionäre zum erstenmal. Sie kamen ihm klein und dürftig vor; der eine hatte zerbissene Nägel, der andere häßliche rote Pünktchen im Gesicht, der dritte kratzte sich bei jedem Wort, das er sprach, den dicken Schädel mit den gelben Borstenhaaren, und alle miteinander überboten sich in lächerlichen Dienstleistungen gegenüber dem Ankömmling.
Das war seine zweite Enttäuschung.
Nur der vierte Schüler – »ein ›Judenjunge‹!« flüsterte ihm augenzwinkernd sein Tischnachbar zu – hatte kaum einen Gruß für ihn. Damit gewann er sein Interesse.
Drei Jahre blieb Konrad Hochseß in der Pension.
Als er zum erstenmal zu den Ferien nach Hause kam, stürzten ihm bei Giovannis ängstlich fragendem Blick die hellen Tränen aus den Augen. Der Großmutter gegenüber lächelte er; nur als ihre Hand beim Willkommen kosend über seine Haare strich, zuckte es schmerzlich um seine schmaler gewordenen Lippen. Eines Tages forderte ihn Giovanni mit einem geheimnisvollen Lächeln zu einem Spaziergang auf. Sie gingen weit durch den Park, bis er sich im Walde verlor. Da lag ein haushoher Felsblock, dessen Fuß von Brombeerranken dicht umwuchert war.
»Willst du mich daran erinnern, daß ich einmal als kleiner Knirps da oben saß und verzweifelt heulte, weil ich nicht zurück konnte?« lachte Konrad. »Damals wußte ich nicht, daß es ein unfehlbares Mittel gibt, um von allen Höhen hinunterzukommen: fallen!« fügte er mit dunklerer Stimme hinzu.
»Unsinn! Unsinn!« antwortete fröhlich meckernd der Alte. »Wozu ist denn der alte Seiltänzer da? Der holt noch immer den Buben herab oder hält den Sack auf, wenn er abstürzt! Aber jetzt, jetzt heißt's kriechen – nicht klettern. Den Tanzsaal der Mondgeister hat der alte Giovanni für sein Goldkind gefunden – den Tanzsaal der Mondgeister!« Und er bog weit die stachligen Ranken auseinander, hinter denen der Fels eine dunkle Spalte aufwies.
»Eine Höhle!« jauchzte Konrad, »eine Höhle, die keiner kennt!«
Eine Zauberwelt voll phantastischer Tropfsteingebilde öffnete sich ihm, die des Alten Blendlaterne mit hin und her flackerndem Licht seltsam beleuchtete. Sie wurde von nun an der Schlupfwinkel seiner Träume, die geheimnisvolle Erweckerin allen Frohsinns. Hohe gelbe Kerzen von Wachs, wie die Bauern sie alljährlich in psalmodierenden Prozessionen nach Vierzehnheiligen zu tragen pflegen, stellte Konrad hier unten auf; ein altes holzgeschnitztes Heiligenbild, es mochte wohl eine Magdalena gewesen sein – eine vor der Buße, denn die langen Haare deckten nur spärlich den jungen blühenden Mädchenkörper – das Giovanni in einem Bodenwinkel gefunden hatte, prangte in der großen Nische hinter der einen gewaltigen Säule, die das ganze Gewölbe zu tragen schien. Ihr zu Füßen breitete ein schwarzes Bärenfell sich aus – Konrads Lager, wenn er all die schwülen Bücher mit den bunten Umschlägen verschlang, durch die seine Pensionskollegen die steife Zurückhaltung des hochmütigen Junkers endlich überwunden hatten. Um ihretwillen hatte er sich sogar herbeigelassen und war Arm in Arm mit dem, der sich die Nägel biß, über den Grünen Markt gegangen; um ihretwillen hatte er mit dem häßlichen Dickschädel auf der Altenburg Schmollis getrunken und die rothaarige Kellnerin unter dem Beifallsgebrüll der anderen in den Arm gekniffen.
Als er das zweitemal den heimatlichen Boden betrat, hatte sich eine feine Falte zwischen seinen Brauen eingegraben. Walter Warburg, der »Judenjunge«, begleitete ihn. Professor Traeger hatte den jungen Mann als den klügsten und anständigsten unter seinen Schülern bezeichnet; daraufhin hatte die Gräfin Savelli, nicht ohne starkes inneres Widerstreben, dem Wunsche Konrads, ihn mitzubringen, nachgegeben.
Die beiden strichen von früh bis spät über Berg und Tal; sie suchten Steine und Pflanzen und Tiere und saßen an Regentagen unermüdlich über ihren Sammlungen. Für Giovanni, dessen Haut nur noch wie ein zerknittertes Pergament in tausend Falten über seinen Knochen hing, schien Konrad keine Zeit zu haben. Einmal fing er den heißen Blick tückischen Hasses auf, mit dem der Alte seinen Freund durchbohren zu wollen schien, als dieser gerade, entzückt vom köstlichen Fang, einen großen Trauermantel auf das Spannbrett spießte.
Ein seltsames Gefühl, aus Scham und Zorn gemischt, zwang Konrad von nun an, dem greisen Seiltänzer noch mehr aus dem Wege zu gehen. Es kam sogar vor, daß er es wie eine Erleichterung empfand, wenn die Tanten ihm von Giovannis gestörtem Geist allerlei Häßliches glauben machen wollten. Aber auch von der Großmutter zog er sich mit auffälliger Absicht zurück und behandelte sie mit der fremden Höflichkeit eines wohlerzogenen jungen Mannes. Die Freunde schienen völlig ineinander aufzugehen und der anderen nicht zu bedürfen. Und doch hatte Konrad ein Geheimnis vor Walter: seine Höhle. Es kam vor, daß er nachts aus dem Schlosse schlich, um bei Kerzenglanz vor der heiligen Magdalena mit sich allein zu sein. Nur zwei Augen, zu alt, um des Schlafs noch viel zu bedürfen, kleine schwarze Augen verfolgten ihn; sie sahen, daß er keine Bücher mehr in sein Versteck trug, wohl aber eine kranke Sehnsucht, die müde aus seinen umränderten Augen sprach.
Der Kummer um des Enkels verändertes Wesen trieb die Gräfin Savelli bis in Giovannis Turmstübchen. Erschrocken durch den ungewohnten Besuch, sprang er von seinem alten Lehnstuhl auf, so daß selbst die stillen kleinen Eulen auf der Stange über dem Ofen unruhig mit den Flügeln schlugen und die große gelbe Katze, die er getreten hatte, zu seinen Füßen kläglich aufschrie.
»Was ist's nur mit dem Konrad, Giovanni?!« und seufzend setzte sie sich auf den dreibeinigen Schemel, ohne zu bemerken, wie eifrig ihr der Alte den bequemen Sessel anbot.
»Frau Gräfin,« stotterte er, die Finger verlegen aneinander reibend, »der junge Herr Baron – unser – unser bambino–« Er stockte, das gelbe Gesicht blutübergossen, um in einem gezwungenen geschäftsmäßigen Ton, die Worte überstürzend, wobei der charakteristische Kehllaut des Florentiner Dialekts, der die Gräfin von Anfang an so heimatlich berührt hatte, besonders stark hervortrat, rasch fortzufahren: »Wenn Frau Gräfin vielleicht jetzt des Müllers Liese in Dienst nehmen wollten, – sie ist ein hübsches Ding, und gesund, ganz gesund.« Die Schweißtropfen standen dem Alten auf der Stirn wie nach schwerer Arbeit; er bückte sich und las eine Feder vom Boden auf. Die Gräfin war aufgestanden, sie atmete schwer.
»So – so –« sagte sie gedehnt, in Gedanken verloren. Sie wußte es: das war der Brauch in Italien; wenn die Söhne mannbar wurden, sorgten die Mütter für –. Sie schüttelte sich. In ihrer Eltern altem Palast war es nicht anders gewesen; sie erinnerte sich der Marietta recht gut, des kleinen Küchenmädchens, die ihres Bruders Geliebte geworden war; eines schönen Tages war sie plötzlich verschwunden gewesen, um dann nach ein paar Monden als blühende Bauersfrau mit dem Säugling an der straffen Brust, von dem ältlichen Gatten begleitet, der Mutter einen Dankbesuch abzustatten. Der Bruder aber, der Giulio, war trotzdem – oder deshalb?! – ein Schürzenjäger geworden. Nein – nein! Niemals würde sie mit eigener Hand ihren lieben Jungen, ihren Konrad, in den Sumpf hinabstoßen! Und die Liese, das süße, junge Ding! War es wirklich jemals möglich gewesen, ein Weib zu opfern, um einem Mann über ein paar qualvolle Monde hinwegzuhelfen?!
»Nein, Giovanni,« erklärte die Gräfin bestimmt, »das ist des Landes hier nicht der Brauch!« Und erhobenen Hauptes schritt sie zur Tür hinaus.
»Nicht der Brauch – nicht der Brauch,« wiederholte der Alte kopfschüttelnd. Als er wieder im Lehnstuhl saß in der Dämmerung und die Augen der kleinen Eulen über dem Ofen zu glühen begannen, bewegten sich seine Lippen noch lange in endlosem Selbstgespräch: »Und hätt' ich selbst eine Tochter – mit eigener Hand führte ich sie ihm zu – ihm, Monna Lavinias Sohn.«
Am gleichen Abend, Konrad war eines verstauchten Fußes wegen zu Hause geblieben, stürmte Walter, in einer ihm sonst ganz fremden Erregung, die Treppen hinauf in sein Zimmer. Atemlos schüttelte er den vollen Sammelsack auf dem Tisch vor dem Freunde aus. Dann gab er ihm scherzend einen Schlag auf die Wange.
»Duckmäuser du, elender Heuchler!« rief er lachend, »solch einen Schatz, eine Fundgrube kostbarster Dinge, deinem Intimus zu verstecken!« Er merkte im Eifer gar nicht, daß Konrads Augen größer wurden und seine Lippen zitterten. »Hier – das ist unzweifelhaft ein Bärenknochen – ein einziger aus einem ganzen Haufen, den ich fand! Hier, sieh nur diese Pfeilspitze – wie scharf der Stein geschliffen ist! Und da –« er hob mit beiden Händen ein großes Stück weißgrauen Tropfsteins hoch empor – »welch unvergleichlicher Stalaktit! Ich habe ihn selbst –« Aber schon hatte ihn Konrad an den Armen gepackt, so daß der Stein mit dröhnendem Gepolter seinen Händen entfiel; glühende Augen funkelten wild dicht vor dem erblaßten Antlitz Walters.
»Du – du hast es gewagt,« schrie eine rauhe fremde Stimme ihn an, »hast meine Säulen zerschlagen, bist in deiner ekelhaften, schnüffelnden Neugier in mein Heiligtum eingedrungen? Jetzt, jetzt weiß ich, was für ein Teufel du bist: setzst Käfer in Spiritus und hast nie einem Vogellied zugehört, klebst mit genauester Klassifizierung Blumen in dein Herbarium und hast den Wald niemals gesehen, suchst Bärenknochen und entweihst mein Letztes – das, wohin ich mich flüchtete mit meinen Träumen, meinem letzten bißchen Frommsein! Tempelschänder!« Und er hob, seiner nicht mächtig, die Hand – Walter rührte sich nicht; er sah den Wütenden an, sehr blaß, sehr ruhig. Und die Hand, die ihn hatte schlagen wollen, fiel zurück.
Walter ging, wortlos, zog leise die Türe ins Schloß und schritt, eine Viertelstunde später, den Rucksack über den Schultern, über den Hof, den Berg hinab. Konrad sah ihm nach, wie er auf der hellen Straße neben dem schimmernden Bach kräftig ausschritt, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Ein nicht mehr zu unterdrückendes Schluchzen erschütterte des Zurückgebliebenen schlanken Körper.
Den Rest der Ferien wurde er immer blasser, immer unzugänglicher. Seine Sammlungen warf er auf den Kehrichthaufen; vor den schmalen Höhleneingang spannte er ein dichtes Netz von Stacheldraht. Dann saß er in dem feuchten, sonnenlosen Ahnensaal, der von den vielen Folianten auf den braunen Regalen so seltsam nach Moder roch. Den Ordensritter mit dem weißen Mantel und dem großen schwarzen Kreuze darauf starrte er mit brennenden Augen an. Warum bin ich nicht seinesgleichen, dachte er ingrimmig, und hab' eine Fahne, der ich folgen, für die ich leben und sterben kann? Jeden Kongoneger beneide ich um seinen Götzen!
Die Gräfin grämte sich um ihn und scheute sich doch, durch ein unvorsichtiges Wort das leicht verletzbare Gemüt noch tiefer zu verwunden.
Nur zuletzt vor seiner Abreise zog sie ihn in ihr Zimmer – einen dunkel getäfelten Raum mit schweren alten Renaissancemöbeln und großen rotsamtenen Stühlen, wie Sitze für Könige oder Condottieri – und er träumte wieder zu ihren Füßen wie einst, wenn sie dem atemlos Horchenden von der fernen sonnigen Heimat und dem stolzen alten Palazzo der Savelli erzählte.
»Was fehlt dir, Konrad? Sag' mir, was ist's?« frug sie ihn.
»Nichts – nichts!« und er wich ihren forschenden Augen aus.
»Du bist der Alte nicht mehr!«
Ein hartes »Nein« kam von seinen Lippen, und er sprang auf. »Da draußen, Großmutter, zieht man uns eine Haut nach der anderen ab, bis es auf unserem Körper keine Stelle mehr gibt, die nicht jeder Luftzug mit Messerschärfe schmerzhaft träfe.« Und er ging mit großen Schritten hinaus, ohne eine Antwort abzuwarten.
Als die alten Füchse das drittemal den schaukelnden Landauer mit dem jungen Gebieter darin den Schloßberg aufwärts zogen, stand die grade Falte tief eingemeißelt wie eine Narbe zwischen seinen Brauen. Die Großmutter war krank. Sehr weiß, sehr durchsichtig saß sie tagaus, tagein in ihrem roten hohen Sessel; sie war stets in ganz weiche, spinnwebdünne, schneeige Wollentücher gewickelt und leuchtete vor den finsteren Wänden und schwarzen Schränken, wie der irrende Schatten einer Ahnfrau nächtlicherweile in den dunklen Gängen alter Schlösser leuchten mochte. Aber ihr Geist lebte das intensivste Leben. Sie sprach nur noch in knappen Worten, als hätte sie zu langen Sätzen keine Zeit mehr.
»Wir haben viel zu tun miteinander,« sagte sie ihrem Enkel statt jeder zärtlichen Begrüßung. Sie ließ ihm kaum Zeit, sich umzukleiden. Dann saß er stunden- und tagelang vor ihr an dem großen, mit Papieren voll endloser Zahlenreihen bedeckten Eichentisch und hörte mit einem Staunen, das sich immer mehr zur Bewunderung steigerte, von der Arbeit ihres Lebens.
Aus tiefster Zerrüttung hatte diese schöne Frau mit den weißen Händen, von der er, wenn sie in ihren Gemächern verborgen geblieben war, nichts anderes geglaubt hatte, als daß sie sich in ihre geliebten Dichter vergrub oder ihren Körper pflegte, der nie eine Altersspur verriet, den großen Besitz der Hochseß zu neuer, ungeahnter Blüte emporgeführt. Dokumente um Dokumente legte sie dem Enkel vor und erklärte sie mit sachlicher Kühle. Ein sarkastisches Lächeln kräuselte nur einmal ihre Lippen, als auf die regelmäßigen Auszahlungen an die Tanten die Rede kam. Sie blieben stets gleich niedrig trotz des wachsenden Reichtums.
»Natalie und Elise Hochseß«, sagte sie, »hüten seit fünf Jahrzehnten die hohen Traditionen dieses Hauses. Sie haben niemals ihre Kleider, niemals ihre Zimmer, niemals ihre Gesinnungen geändert. Sie werden dir die Wäscheschränke des Schlosses, die ich ihrer Verwaltung überließ, in tadelloser Ordnung, mit stets erneuten Häkelspitzen geschmückt, übergeben. Sie haben auch bereits, um dir alle Mühe zu sparen, in der kleinen Hilde Rothausen die Schloßfrau für dich ausgesucht. Sie werden sich zu ihren Vätern versammeln ohne einen Flecken auf ihrer jungfräulichen Ehre, ohne eine Narbe auf ihren Herzen. Auch ohne eine Schwiele, die von harter Ackerarbeit zeugte, an ihren Händen. Von dem, was ich geschaffen habe, ich, der sie jedes Kleid heimlich als einen Raub an der Familie Hochseß nachrechneten, wissen sie nichts – brauchen sie nichts zu wissen.«
Konrad nickte nur. Seit seiner Kindheit hatte ihn nichts so sehr entsetzt wie die Fledermäuse, die abends lautlos den Turm umkreisten und, wenn der Vollmond hell am Himmel stand, große schwarze Schatten warfen. In seinen Träumen vermischte sich das Bild der Nachtgeschöpfe mit dem der Tanten. Er spielte nie mit den Geschenken, die von ihnen kamen. Und so verstand er die Großmutter nicht nur, er dankte ihr für ihr Verständnis.
Während seines Aufenthaltes erholte sich die Gräfin Savelli zusehends. Sie erschien wieder wie einst auf der Terrasse unter den Lorbeerbäumen. Noch um einiges dürrer geworden und noch steifer im Rückgrat saßen die Tanten am Teetisch, die schmalen Lippen fest zusammengekniffen, – ein lebendiger Vorwurf. Von der Einweihung Konrads in die Geschäfte des Hauses hatte man ihnen weder eine Mitteilung gemacht, noch waren sie, wie es Familienrücksicht geboten hätte, zugezogen worden. Der alte Schulmeister, der auf dem Schlosse das Gnadenbrot aß, erfuhr von dem Ereignis durch Konrads harmlose Bemerkungen und erzählte es ihnen. Er war ein guter lutherischer Christ und hatte sich seit seines Zöglings Fortzug den Fräuleins von Hochseß, die allsonntäglich in der Dorfkirche saßen und jeden Karfreitag pünktlich zum Abendmahl gingen, auch nicht versäumten, täglich in ihrem Wohnzimmer mit den blank gescheuerten Dielen und der sehr bunten Kopie der Sixtina an der Wand eine Andacht zu lesen, mehr und mehr angeschlossen und saß auch jetzt mit der Wahrung respektvollen Abstandes zwischen ihnen.
»Es ist Ihnen, Frau Gräfin, als einer Ausländerin, wohl unbekannt geblieben,« begann Natalie spitz, »daß es der Tradition fränkischer Adelsgeschlechter widerspricht, einen Knaben von achtzehn Jahren in die Geschäfte einzuführen.«
»Noch dazu ohne Beisein der Schwestern seines in Gott ruhenden Vaters,« ergänzte Elise. Hektische rote Flecke malten sich dabei auf ihren spitzen Backenknochen.
Die Gräfin lehnte sich noch tiefer, noch behaglicher in ihre Kissen zurück, und ließ ihre schwarzen Augensterne sichtlich belustigt von einer zur anderen wandern.
»Der ›Knabe‹,« sagte sie und griff Konrad unter das Kinn, »ja, seht ihn nur genauer an: er könnte so bärtig sein wie seine Väter – ist, so viel ich weiß, der Herr von Hochseß und hat ein Recht auf die von mir vermittelten Kenntnisse. Auch wollte ich, als ›Ausländerin‹ – es bedurfte Ihrer freundlichen Ermahnung nicht, um meine Erinnerung daran lebendig zu erhalten – nicht länger allein alle Verantwortung tragen. Es kann jeden Augenblick mit mir zu Ende gehen –«
Ein halb bedauerndes, halb überraschtes »Oh« der Schwestern unterbrach sie, während der Schulmeister sein Gesicht in feierliche Falten legte. Die Gräfin hob spöttisch abwehrend die Rechte.
»Bitte, verschwenden Sie Ihre liebevolle Teilnahme nicht zu früh. Der Sommer und diese Jugend neben mir hielten mich noch einmal von der Italienreise zurück.«
»Von der Italienreise?!« frug Konrad erstaunt.
»Ich möchte nicht gern im Ausland begraben sein,« antwortete sie in fast geschäftsmäßigem Ton, »doch das nur nebenbei. Es hat keine aktuelle Bedeutung. Ich bin gesund. Ich habe mir selbst ein Mittel verschrieben, das mich dem lieben Familienkreise noch lange erhalten wird.«
»Darf man wissen –?« Natalie stellte die Frage, ohne die Augen von ihrer Häkelarbeit zu erheben; nur das leichte Zittern ihrer Finger verriet, daß eine Ahnung sie folterte.
»Man darf!« Frohlockend wie bei einer Siegesbotschaft klang die Stimme der Gräfin. »Wollen Sie mir folgen? Ich glaube, wir sind alle sehr lange nicht auf dem Turm gewesen!« Damit erhob sie sich und schritt, auf den Arm des Enkels gestützt, hoch aufgerichtet voraus.
Auf ihr Klopfen öffnete Giovanni die immer noch kreischende Pforte. Gegenüber dem hellen Tage draußen, erschien hier alles in nächtiges Dunkel gehüllt. In engen Windungen stieg die Treppe empor.
»Ich habe sie gekehrt und das Geländer befestigt,« krächzte der Alte aus der Finsternis.
»Führe uns!« antwortete die Gräfin.
Mit hart aufklappenden Sohlen, deren Ton vom Geräusch seines stöhnenden Atems begleitet wurde, stieg er voran. Das Seidenkleid der Gräfin rauschte über die Steinfliesen, dahinter klang das asthmatische Hüsteln der Fräuleins und des Schulmeisters breiter schwerer Tritt. Nur Konrad schien unhörbar emporzusteigen. Er ging auf den Fußspitzen, dem Licht entgegen, das oben durch die schmale offene Falltür schräg, wie mißgünstig, hereinbrach. Unter den vorspringenden Sparren und Balken hingen reihenweise die grauen Leiber zahlloser Fledermäuse.
In blendender Klarheit öffnete sich oben der Himmel über den Kommenden. Von plötzlichem Schwindel ergriffen, setzten sich die Tanten mit dem Rücken gegen die blaue Ferne auf die oberste der Stufen. Der Schulmeister steckte nur den Kopf ins Freie hinaus. Giovanni stand dicht am Rande der Plattform; der Wind klebte ihm die Kleider um die Glieder und sträubte seine grau-grünen Haare rings um den Schädel. Die Gräfin lehnte die linke Hand nur leicht auf des Enkels Schulter.
»Schwindelt dich?« frug sie lächelnd.
Er reckte sich in seiner ganzen, schlanken Größe kräftig empor.
»Auf der Höhe – in der Sonne – vor solch einem Ausblick – wie sollte mir schwindeln?« sagte er.
»Gedachten Sie durch diesen seltsamen Spaziergang nur Ihre Kräfte an den unseren zu messen, um sich des vollen Triumphs bewußt zu werden, Frau Gräfin?« Natalie knüpfte sich bei der spitzen Frage das graue Wolltuch fester um die fröstelnden Schultern.
»Nein, meine Lieben,« antwortete die Angeredete freundlich. »Ich erbat Ihre Begleitung, um mir nicht wieder Ihren Tadel zuzuziehen, denn nur von hier aus kann ich Ihnen zeigen – falls Sie die Güte hätten, auf einen Augenblick Umschau zu halten –, um welch kostbaren Besitz ich das Eigentum meines Enkels, Ihres Neffen, habe vergrößern dürfen. Sie von der Freude daran auszuschließen, wäre bitteres Unrecht gewesen!«
Nun standen die beiden grauen Gestalten eng aneinander gedrängt doch auf dem Turm, und in ihre farblosen Augen stieg ein Funke von Neugier.
»Siehst du dort im Tal, dicht an der Grenze unseres Waldes, das rote Dach mit den vier dünnen Türmchen an jeder Ecke?« wandte sich die Gräfin an Konrad, ohne die übrigen von da ab noch der geringsten Beachtung zu würdigen.
»Eckartshof,« antwortete Konrad und grub gleich darauf die Zähne heftig in die Unterlippe.
»Eckartshof –« Giovanni wiederholte es, nähertretend. Er streckte dabei die gelben Hände vor, sie zu Krallen spreizend, als ob er das friedliche Bild da unten zwischen ihnen zermalmen wollte.
»Von heute ab ist es dein,« mit einem langgezogenen Vogelton tönte dies »dein« der Gräfin Savelli in die Ferne.
»Ah!« ein tiefer Atemzug hob Konrads Brust.
»Und der Freiherr? – Und die Baronin?« stießen die Schwestern mehr entsetzt als erfreut hervor.
»Sind ruiniert! Er hat sich zugrunde gespielt und getrunken. Ich kündigte ihm als Konrads Vormund das Darlehen seines Vaters.« Das selige Lächeln, das der Gräfin Antlitz verklärte, ließ sie um Jahrzehnte jünger erscheinen. Sie legte den linken Arm um des Enkels Schultern, und ihr heißer Atem umhüllte ihn ganz, während sie sich flüsternd zu seinem Ohre neigte. »Auf den Knien lag sie vor mir, die weiße Schlange – auf den Knien!«
In diesem Augenblick näherte sich ihnen Giovanni und zog in demütiger Gebärde die weiße Schleppe der Gräfin an seine Lippen.
»Nun lächelt Madonna Lavinia,« sagte er verträumt, und all seine Falten schienen sich zu glätten.
Wortlos schlichen die Fräuleins die Wendeltreppe herab. Sie fürchteten sich.
Das war vor dem Examen Konrads letzter Besuch in Hochseß.
Zweites Kapitel. Von der Fahrt in die Freiheit
In der Bahnhofshalle von Bamberg brütete die Septembersonne in breiten, heißen Strahlen. Sie schien die kurzen Minuten verzauberter Stille benutzen zu wollen, um jeden Rest von Rauch herauszudrängen; sie tanzte lustig über alles Blanke und ließ selbst auf den Steinplatten des Perrons Millionen winziger Sternchen strahlen.
Drei Männer traten hinaus; mit elastischem, raschen Schritt der eine, so wie sorglose Menschen gehen, mit schweren an der Erde klebenden Sohlen der andere, wie solche, die unsichtbare Lasten tragen, und hastig trippelnd der letzte, als wäre er ein Greis oder ein Kind.
»Eine halbe Stunde zu früh! Verrückt!« brummte der zweite, eine untersetzte Gestalt mit den typischen feinen Zügen des Semiten von alter Kultur.
»Weise, sehr weise, mein Freund!« entgegnete lachend der erste, ein hochgewachsener blonder Jüngling, der, gewohnt, sich zu allen anderen niederbücken zu müssen, die Schultern ein wenig nach vorn fallen ließ, »und zwar nach deiner eigenen Theorie, lieber Walter. Heißt es nicht, die Vorfreude auskosten bis aufs letzte, wenn wir hier in steigender Erwartung die Minuten verstreichen sehen?«
Ein leise meckerndes Lachen antwortete ihm. Rasch wandte er sich nach dem anderen Gefährten um.
»Jetzt steht der Mensch wahrhaftig hinter mir wie eine Leibwache!« rief er halb ärgerlich, halb belustigt.
»Euer Gnaden haben geruht, mich als Kammerdiener mitnehmen zu wollen,« antwortete der Alte mit einem tiefen Bückling, während seine schwarzen Äuglein zärtlich zu ihm aufblinzelten.
»Damit du vor der Welt ein Amt hast, Giovanni, du weißt, ein Kerl ohne Titulatur hat keine Existenzberechtigung! Aber unter uns,« und über des Jünglings gebräuntes Antlitz huschte ein weiches Kinderlächeln, »unter uns bist du, was du immer warst: mein Freund.« Der Alte drückte die dürren Hände flach aneinander wie zu einem Gelöbnis.
»Wollen wir nicht wenigstens aus der Sonne gehen?« sagte Walter, noch immer voll Mißmut.
»Freu' dich doch, daß sie scheint! Sieh nur, wie sie selbst diesen öden Bau in einen Märchenpalast verwandelt!«
»Träumer!«
In diesem Augenblick schien das Leben erwacht: Dort rasselte schwerfällig ein langer Lastzug vorüber, hier rangierte mit schrillem Pfeifen eine Lokomotive, drüben klingelte gellend der Telegraph, dazwischen sauste ein Expreßzug stolz durch die Halle, daß sie bis in ihre Fundamente erbebte; das alles kreischte und fauchte und dröhnte und schrie den Harrenden und Hinund Widerhastenden in gleichem Allegrotempo sein Vorwärts – Vorwärts entgegen, während dunkle Rauchschwaden alle Sonne verschluckten.
Es läutete. Um den langsam hereinstampfenden Personenzug drängten sich die Landleute. Eine grauhaarige Alte, die schwer bepackte Kiepe auf dem krummen Rücken, keuchte im letzten Augenblick auf den Perron. »Mach rasch, Mutter!« rief ein junger Bursche ärgerlich aus dem Coupéfenster.
Konrad Hochseß' Stirnadern schwollen. »Bande!« knirschte er zwischen den Zähnen und sprang hilfreich zu, die Last der armen Frau mit beiden Händen stützend, als sie die Stufen des Waggons emporstieg.
»Wirst du nun einsehen, daß das weibliche Geschlecht sich in keinen einheitlichen Begriff zusammenfassen läßt?« sagte Walter; »es gibt Damen und Lastträgerinnen – von alters her.«
»Glaubst du, ich werde jemals eine Tatsache als berechtigt anerkennen, nur weil sie die sogenannte Würde des Alters für sich hat?« brauste Konrad heftig auf. »Die Würde des Alters! Ach!« er schüttelte sich wie im Ekel, »ich brauche bloß an unseren Magister zu denken: er predigte uns mit eindringlicher Spekulation auf unsere Tränendrüsen Enthaltsamkeit und betrank sich, daß seine arme Dicke ihn nächtlicherweile auf der Treppe auflesen mußte!«
»Was ereiferst du dich?! Seine Predigten waren nichts anderes als Schuldbekenntnisse!«
»Ein Schwächling ist noch ekelhafter als ein Heuchler.«
Es läutete abermals: der Eilzug. Hinter den Freunden klappten die Coupétüren auf und zu. Da lief ein Mädchen mit langen wehenden Zöpfen und glühenden Wangen, ein kleines, von Seidenpapier umhülltes Paketchen in der ausgestreckten Hand, über den Bahnsteig. Sie suchte. Vergebens. Niemand sah hinaus. Keiner schien für die Stadt, aus der der Zug ihn entführte, einen Abschiedsblick zu haben. Nur hinter einem Fenster tauchte etwas auf wie eine Fratze: gelb, faltig, mit tief heruntergezogenen Mundwinkeln, wie nur unauslöschlicher Gram sie zeichnet. Das Mädchen riß bei diesem Anblick entsetzt die hellen blauen Augen auf und starrte noch auf denselben Fleck, als der Zug sich schon in Bewegung setzte; erst der gelle Pfiff brachte sie zu sich. Und plötzlich schien sie entdeckt zu haben, was sie suchte: ein scharfgeschnittenes Profil – schwarze, gerade gezogene Augenbrauen, weiche rote Lippen – blonde Haare. Aber der Kopf, an dem ihre Blicke sehnsüchtig hingen, wandte sich ihr nicht zu, obwohl sie atemlos neben dem schon rascher fahrenden Zuge herlief. Da warf sie ihr Paketchen gegen das Fenster: das Seidenpapier löste sich, eine blasse Rose fiel unter die Räder.
Walters dunkler Kopf bog sich einen Augenblick lang hinaus. »Das Klärchen!« sagte er, zu dem Freunde gewandt.
»Ich weiß,« stieß er zwischen den Zähnen hervor.
»Und hast keinen Gruß für sie? Gabst du nicht früher dein ganzes Taschengeld für ihre Eitelkeit aus, machtest Fensterpromenaden und Liebesgedichte?!«
Der andere warf dem spottenden Freunde einen Blick zu, dessen drohender Ausdruck zu dem Geschehenen in keinem Verhältnis zu stehen schien.
»Erinnere mich nicht. Du weißt so gut wie ich, daß sie sich an den Egon, den dummen Bengel, hängte –«
»Ganz einfach: weil er, der Durchgefallene, in Bamberg blieb, und du nicht rasch genug den Ranzen packen konntest. Erwartetest du etwa ewige Treue von dem Mädchen, oder gedachtest du, Konrad Freiherr von und zu Hochseß, das Fräulein Klärchen Werber als dein ehelich Gemahl heimzuführen?!«
Der junge Mann überhörte diesmal den Spott.
»Ich hatte sie lieb,« flüsterte er wie im Selbstgespräch. »Wie oft wäre ich davongelaufen, aus Ekel über die Gemeinheit der Bengels um mich, aus Wut über den öden Stumpfsinn, den man uns als aller Weisheit letzten Schluß eintrichterte, aus Sehnsucht – ich wußte selbst nicht, wonach! –, wenn die Kleine nicht gewesen wäre. Kaum, daß ich ihr die Hand zu drücken wagte – Esel, der ich war! –, nur daß sie in einer Stadt mit mir lebte, daß ich sie hier und da sehen, grüßen, ein paar Worte mit ihr wechseln konnte, genügte mir.«
Er schwieg minutenlang, ein Lächeln um die Lippen, um dann, aufgerichtet, den Kopf dem Freunde abgewandt, als wäre er allein mit sich, in steigender Erregung weiter zu reden.
»Gib uns armen, hinausgestoßenen, mutterlosen Buben solch eine Liebe, gütiges Geschick, laß uns solch einem süßen, zarten Ding begegnen, und es bedarf all eurer Strafpredigten nicht, liebwerte Priester und Professoren! Wenn ich halbwegs gerade wuchs in diesen Jahren – dem Klärchen verdank' ich's. Nicht, weil sie mich mit guten Ratschlägen fütterte – weiß Gott nicht! – nur weil sie da war.«
Er setzte sich wieder, die Ellbogen auf den Knien, das Kinn in die Hände gegraben, dem Freunde gerade ins Gesicht starrend: »Und schließlich stieß sie – sie! – mich in den Schmutz, daß ich mich vor mir selber graue!« Aufstöhnend schlug er die Hände vor das Gesicht.
»Konrad – Konrad!« und der Freund suchte vergebens, sie zu lösen, um ihm ins Antlitz zu schauen, »wie kannst du dem unschuldigen Mädel daran die Schuld zuschieben!«
Der junge Mann sah auf, mit Augen, die erloschen schienen. »Glaubst du, ich wäre jemals mit den anderen gegangen, wenn ich ihrer sicher gewesen wäre?! Ich wäre solch ein Schweinigel gewesen, unsere Liebe zu beschmutzen?! Gelacht hätt' ich, wie bisher, triumphierend gelacht, wenn die Kameraden den ›heiligen Konrad‹ gehänselt hätten.«
»Früher oder später mußte es kommen,« meinte der andere zögernd, ohne aufzusehen.
»Es mußte – meinst du?!« Mit bitter geschürzten Lippen sah er auf. »Aus hygienischen Gründen wohl, wie die Gelehrten sagen?! Neulich hat sich einer das Leben genommen, als er von einer Dirne kam. Ich versteh's! Nur, daß ich auch dafür zu schwach bin.«
»Oder zu stark,« warf Walter mit Betonung ein.
»Du glaubst?!« Konrad zuckte die Achseln. »Pah! Schütteln wir's ab! Wie alles übrige! Jetzt geht's in ein neues Leben.«
Und sie schwiegen beide.
Walter sah zum Fenster hinaus. »Die Türme des Doms!« unterbrach er lebhaft die Stille. »Dort, ganz fern – zum letztenmal! So schau doch hinaus!«
»Nein,« ungewöhnlich hart kam es über die weichen Lippen, »denn nichts, aber auch gar nichts hat diese Stadt mir gegeben, was sie nicht mit Wucherzinsen wieder genommen hätte, wenn es nicht dieser erste Tag reiner Freude ist, und jener andere vielleicht vor drei Jahren, als ich sie, alle Wunder von ihr erwartend, zuerst betrat.«
»Und dankst ihr doch so viel an Wissen und Werden – um mit unserem würdigen Professor zu sprechen.«
Konrad lachte, aber es war sein frohes Lachen nicht. »Ins Gesicht hätt' ich ihm springen mögen, als er all sein Pathos auf diese unvergleichliche Alliteration verwendete. War nicht das Wissen, mit dem er und seinesgleichen unser Hirn belastete und unser Herz einschnürte, der mörderische Feind allen Werdens? Wie reich war ich, als ich zum erstenmal, aller Andacht, alles Wunderglaubens voll, da droben vor dem Hochaltar stand, zu Füßen des steinernen Reiters, um dessen ritterliches Haupt ich meine Märchenträume spann! Und jetzt –«
Er brach ab. Die Falte zwischen seinen Augenbrauen vertiefte sich.
»Jetzt,« fiel Warburg ein, »jetzt hat man uns in die Welt und in die Freiheit entlassen, um das eigene Leben zu erkämpfen.«
»Mit der Reifeprüfung in der Tasche und doch unreifer als je!« spottete Konrad.
Warburg nickte: »Selbstverständlich. Denn jede Altersstufe hat ihre eigene Reife, die uns niemand fix und fertig mit auf den Weg geben kann. Oder hast du erwartet, sie würde dir sauber verpackt und etikettiert, wie irgendein Apotheker-Elixier, mit auf den Weg gegeben werden?!«
Konrads Stirn rötete sich. »Wenn du's denn wissen willst: ja! Ein Elixier – eins, das als Wärme durch die Adern rinnt, als Kraft die Muskeln schwellt, – das hab' ich, unbewußt vielleicht, erwartet. Nicht goldvortäuschendes, dreckiges Papiergeld, das nur den Hunger von alten Geizhälsen stillen kann. Freilich,« fuhr er mit einem sarkastischen Lächeln fort, »die meisten unserer lieben Kameraden, das stellten wir ja erst neulich fest, sind alt geboren, darum konnte ihnen der Wust trockner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zur Weltanschauung werden, darum geraten sie in Ekstase – Begeisterung ist ein viel zu edles Wort dafür! – über jede neueste Luftschiffkonstruktion, verwechseln ständig Technik mit Kultur, machen den Beruf zum letzten Lebensideal –«
»Und«, ergänzte Warburg, »sind doch vielleicht beneidenswert um den festen Boden unter den Füßen, das klare Ziel vor Augen.«
Konrad schüttelte heftig den Kopf. »Unser alter Streit! Wozu ihn aufwärmen?! Du weißt: lieber verlier' ich mich in den Wolken und stürze zerschmettert hinab, als daß ich jenen festen Boden betrete, solch klares Ziel für das meine erkläre.«
Er lehnte sich mit geschlossenen Lidern in die Kissen zurück.
Beide schwiegen. Eintönig ratterte der Zug.
Stunden vergingen. Es dämmerte schon, als der alte Giovanni vor der Tür auftauchte.
»Frische Orangen, ganz frische Orangen, Herr Baron,« sagte er und hielt dem jungen Mann ein Körbchen voll blutroter Früchte entgegen. Sie leuchteten förmlich. Konrad griff mit beiden Händen danach und hob sie empor.
»Sieh nur die Pracht!« rief er strahlend. »Die Äpfel der Hesperiden! Die ewige Jugend! Komm, Walter, laß uns wieder glauben, daß wir Götter sind!«
Walter warf einen mißtrauischen Blick auf Giovanni. »Wo der Kerl nur die wieder her hat?« brummte er. Aber der Italiener war ebenso leise verschwunden, wie er gekommen war.
Die Freunde hatten beschlossen, die erste Nacht ihres Berliner Aufenthalts in einem Hotel nahe am Bahnhof zuzubringen und sich gleich am nächsten Morgen nach geeigneten Quartieren umzusehen. Daß Konrad den Gedanken an eine gemeinsame Wohnung auch nicht einen Augenblick zu erwägen schien, hatte Walter gekränkt. Er war überempfindlich und um so mehr geneigt, eine absichtliche Zurücksetzung seiner Person anzunehmen, als er noch immer nicht zu glauben vermochte, daß Konrads Freundschaft an seiner Ab stammung keinen Anstoß nahm. Es erschien ihm darum nunmehr als gewiß, daß die äußere Trennung das erste Zeichen der inneren sei. Je näher sie dem Ziele kamen, desto mißmutiger und einsilbiger wurde er, während Konrad, ohne eine Ahnung von den Empfindungen des Gefährten, in wachsender Erregung von Fenster zu Fenster lief.
Wie allmählich aus dem Dunkel der Nacht die Lichter Berlins auftauchten, in glänzender Perspektive ganze Straßenzüge da und dort sich öffneten und der schwarze Himmel sich allmählich mit einem rosigen Glanz überzog, als strahle von den Häusermassen zaubrische Helle aus, da klopfte sein Herz immer ungebärdiger. Weit, so weit, als wäre es seine eigene nicht, lag die Vergangenheit hinter ihm; diese Lichter leuchteten seiner Zukunft.
Er sprang als erster aus dem Zuge und atmete die rauchgeschwängerte Luft, die ihm entgegenschlug, mit demselben Entzücken wie der Bergsteiger den reinen Hauch der Gipfel. Traumbefangen lief er die Bahnhofstreppen hinab, kaum bemerkend, daß der Freund alle praktischen Erfordernisse der Ankunft für ihn erledigt hatte. Sie standen schon vor dem nahen Gasthaus, als er zu sich kam.
»In den Hühnerstall?!« lachte er, »und gleich jetzt? Hast du wirklich in diesem Augenblick nichts anderes zu denken! In dieser Nacht sieht mich kein Hotel! Wir wollen frei sein, Walter!«
»Morgen, wenn wir gegessen und geschlafen haben, – du solltest übrigens nicht vergessen, daß der Arzt dich vor Überanstrengungen warnte.«
»Pedant! Du machst dich zum Sklaven der Uhr, als gingen wir noch ins Gymnasium, und willst mich zum Sklaven einer dummen Muskel machen, die nicht ganz vorschriftsmäßig funktioniert.«
»Ich bin müde, und das Herz ist mehr als eine dumme Muskel.«
»So geh' schlafen!« lachte Konrad, »morgen früh weck' ich dich, Philister!« Und schon bog er mit großen, elastischen Schritten in die Königgrätzer Straße ein.
Daß Giovanni ihm hastig trippelnd folgte, während seine lebhaften schwarzen Äuglein unruhig hin und her fuhren, schien er vergessen zu haben. Mitten auf dem Potsdamer Platz blieb er stehen. Um ihn brauste die Weltstadt. Eine endlose Kette leuchtender Perlen, hingen die Bogenlampen der wie Sternzacken nach allen Richtungen weisenden Straßen am dunklen Himmel; unten flogen gelbe, braune und weiße Autos mit großen Lichtaugen vorüber; von den Höhen der Häuser warfen glühende Schriften, bunte Pfeile, kreisende Ringe ihre wechselnden Farben auf das Gewühl der Wagen, der Pferde und Menschen unter ihnen.
Wie der Schwimmer, dem das Meer zum vertrautesten Element geworden ist, sich jauchzend immer höheren Wogen entgegenwirft, so eilte Konrad leichtfüßig durch die abwechselnd sich stauenden und sich vorwärts schiebenden Massen, keines warnenden Zurufs achtend. Plötzlich aber sah er auch seinen Schritt gehemmt, denn alles um ihn schien durch einen einzigen Wink des die Straße beherrschenden Polizisten gefesselt, und in den leeren Raum vor ihm ergoß sich, von der anderen Richtung kommend, der Strom von Menschen und Wagen. Schon suchte er, dem jede Unterordnung unter allgemeine Gesetze verhaßt war, sich dem Zwang zu entziehen, als der schlanke, wie Firnschnee schimmernde Leib eines Autos langsam und fast unhörbar dicht an ihm vorüberkam; zu gleicher Zeit flammte in seinem Innern das Licht auf und umstrahlte schmeichelnd die üppige Gestalt eines Weibes, das lässig in den blauen Polstern lehnte. Die Menschen, die Wagen, die Pferde draußen verschluckte die Nacht. Nur sie leuchtete: ihr Goldhaar und die Perlenschnüre darin, die Haut ihres entblößten Halses, das lockende, grünlich schillernde Augenpaar, der volle, sehr rote Mund, der sich über starken weißen Zähnen lächelnd öffnete. Konrad starrte sie an, selbstvergessen, – war sie ein Fabelwesen? Dem Schoße der schillernden Stadt entsprungen? Im nächsten Augenblick erlosch das Licht, die Nacht schlug ihren Mantel um sie, mit einem langgezogenen Klageton wie der Sturm, wenn er durch alte Kamine heult, glitt der weiße Wagen vorüber.
Vorwärts schoben sich alle Räder; um Konrad tobte aufs neue der Lärm der Stadt. Widerstandslos ließ er sich weitertreiben. Durch lange Straßen, an hellen großen Fenstern vorbei, hinter denen dichtgedrängt an kleinen Tischen die Menschen saßen.
Sein Gang verlor an Elastizität, sein Blick wurde nüchtern: diese bunten Reklamelichtbilder waren doch eigentlich ein dummer, kindischer Witz, und wie müde sahen im Grunde die Menschen aus; das Lächeln auf den Gesichtern der Damen, die ihm begegneten, war doch nur ein Grinsen. Ach, auch er war müde! Und irgendeinen Ton hatte er im Ohr, der ihn störte, den er los werden mußte: etwas wie einen unregelmäßigen und doch niemals aussetzenden Schritt hinter sich. Zuweilen hatte er sich danach umgedreht, sein Blick war aber immer nur gleichgültigen, ausdruckslosen Gesichtern begegnet. Er hastete vorwärts, durch eine lange Straße, die das Licht der großen Bogenlampen auf halber Höhe der Häuser ganz zu verschlucken schien, während der Menschenstrom unten schwarz dahinflutete, nur hie und da von den Lampen eines Restaurants grell erleuchtet, – so grell, daß auch die jüngsten Gesichter, die rotgeschminktesten Wangen von fahler Leichenfarbe überzogen waren.
»Ich habe einen meiner schweren Träume,« dachte Konrad und strich sich mechanisch mit der kalten Hand über die Stirn. Dann lachte er hell auf, so daß die neben ihm Schreitenden ihn ängstlich ansahen. »Hunger, nichts als Hunger!« und er bog mit raschem Entschluß in das nächste Kaffeehaus ein, aus dem heitere Musik und wirrer Stimmenlärm ihm entgegenklang. Wie gut es tat, still zu sitzen und bei Essen und Trinken zur Wirklichkeit zurückzukehren! Wohin hatten seine Träume ihn wieder einmal getrieben? Die Nixe in der blauen Woge – »eine geschminkte Dirne« würde Freund Walter gesagt haben. Sein ausdrucksvoller Mund zuckte schmerzhaft. Herr Gott, wie allein er doch eigentlich war! Wo war einer, ein einziger, der ganz mit ihm gefühlt, ihn ganz verstanden hätte?! Seine Scheu vor dem Leben und seine große Sehnsucht nach ihm, sein Wünschen ins Weite und sein Erschrecken, wenn das Ferne nahe kam, sein Liebesverlangen und seine rasche, gräßliche Ernüchterung! Was wird die große, fremde, in diesem Augenblick von ihm fast als feindselig empfundene Stadt aus ihm machen? Er brachte sich ihr dar; war er Marmor, für dessen Gestaltung der Künstler schon lebte, oder ein Opfer, bestimmt, auf den Altären fremder, wilder Götter zu bluten? Wer einen Menschen hätte, nur einen einzigen Menschen in dieser Wirrnis!
Einen Menschen! Wo war Giovanni?! Er erschrak: hatte er den alten Mann, mit dem geheimnisvolle Fäden des Erlebens, des Träumens und Erinnerns ihn verknüpften, schon am ersten Abend im Gewühl verloren? Er sah sich suchend um; sein Blick tauchte in zwei kleine schwarze Augensterne, die mit einem Ausdruck mütterlicher Liebe und sklavischer Ergebenheit unverwandt, ohne die Lider zu bewegen, auf ihm ruhten. Er sprang auf. »Giovanni – verzeih,« und beide Hände streckte er ihm entgegen. Der lächelte nur.
»Jetzt suchen wir uns eine Schlafstelle,« damit schob er, des Tuschelns ringsum nicht achtend, seinen Arm unter den des Alten.
Sie traten ins Freie. Es war tief in der Nacht. Und noch ratterten die Autos, rollten die Wagen, strömten die Menschen auf und ab. Gab es in dieser Stadt keinen Schlummer?
Ein paar Mädchen mit hochgeschlitzten Kleidern und hauchdünnen Strümpfen, durch die das rosige Fleisch leuchtete, strichen dicht vorbei.
»Hast dir wohl den Urjroßvater als Jardedame mitjenommen?« lachte die eine keck, das blitzende Gebiß eines jungen Raubtieres zeigend.
»Du – die Blumenjule dort nimmt ihn dir jerne ab,« flüsterte die andere, die sehr groß und gertenschlank war, dicht an seinem Ohr; ihr Mantel schlug sekundenlang auseinander, die weiße schimmernde Brust enthüllend, aus der eine Woge starken Duftes empor stieg. In Konrads Schläfen pochte das Blut.
Ein blutjunges, schmächtiges Ding, mit großen übernächtigen Augen, um die das Laster schwere schwarze Ringe gezogen hatte, in einem schmalen Kindergesichtchen, vertrat ihm den Weg, sich wortlos anbietend. Er schob sie beiseite.