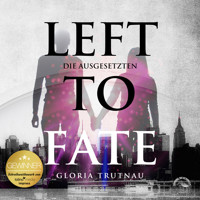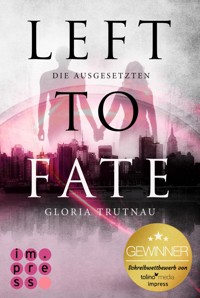
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
New York ist verfallen. Der totalitäre Staat Concordia nutzt die Ruinen als riesiges Gefängnis für junge Menschen, die laut Voraussage in der Zukunft ein Verbrechen begehen werden. Als Samantha in die gefährliche und von Banden umkämpfte Stadt verstoßen wird, sucht sie Schutz bei der Westside-Gang. Der unnahbare Anführer David misstraut ihr, obwohl er selbst Geheimnisse zu haben scheint. Langsam kommen sich die beiden näher. Sie finden heraus, dass hinter Samanthas Verbannung etwas Größeres steckt - und die Ruinenstadt wird zur lebensbedrohlichen Falle… Mit ihrem Roman »Left to Fate. Die Ausgesetzten« gewann Gloria Trutnau beim Schreibwettbewerb von tolino media und Impress den 2. Platz! Die Jury war begeistert: »Eine atemberaubende Liebesgeschichte und eine packende Story. Maze Runner meets Minority Report – ein grandioses Werk!« //»Left to Fate. Die Ausgesetzten« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Gloria Trutnau
Left to Fate. Die Ausgesetzten
**Du wirst ein Verbrechen begehen. Du weißt es nur noch nicht.** New York ist verfallen. Der totalitäre Staat Concordia nutzt die Ruinen als riesiges Gefängnis für junge Menschen, die laut Voraussage in der Zukunft ein Verbrechen begehen werden. Als Samantha in die gefährliche und von Banden umkämpfte Stadt verstoßen wird, sucht sie Schutz bei der Westside-Gang. Der unnahbare Anführer David misstraut ihr, obwohl er selbst Geheimnisse zu haben scheint. Langsam kommen sich die beiden näher. Sie finden heraus, dass hinter Samanthas Verbannung etwas Größeres steckt – und die Ruinenstadt wird zur lebensbedrohlichen Falle …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Gloria Trutnaus erster Roman liegt bis heute in der Schublade, mit dem zweiten gewann sie den Schreibwettbewerb von tolino media und Impress. Sie lebt in München und arbeitet in der Personalgewinnung. Ihre Leidenschaften sind Jugendbücher und Thriller sowie Film.
Für Mama.
Weil du immer hinter mir stehst.
1
Es ist totenstill. Ich liege auf dem Rücken. Der Untergrund ist Es ist totenstill. sehr hart, vielleicht Asphalt. Ich versuche die Augen zu öffnen, aber meine Lider fühlen sich unglaublich schwer an. Ich blinzle und nehme meine Umgebung nur schemenhaft wahr, während meine Hände über staubigen Boden tasten. Alles ist verschwommen. Ich kann mich nicht konzentrieren und nichts fokussieren. Mit Mühe schaffe ich es, meine Augen offen zu halten. Benommen warte ich darauf, dass die Dinge um mich herum endlich Schärfe annehmen.
Nach einiger Zeit werden meine Gedanken und meine Sicht klarer. Langsam versuche ich mich aufzusetzen und muss innehalten, als mir schwindlig wird. Ich befinde mich auf einer breiten und sehr langen Straße, deren Ende ich nicht erkennen kann. Links und rechts von mir ragen riesige Wolkenkratzer als tödliche Schatten empor. Sie sind verfallen, die Fenster kaputt. Backsteine liegen auf dem Asphalt. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde, und noch nie zuvor habe ich einen derartigen Ort gesehen. Die Häuser verdecken größtenteils den Nachthimmel und kein einziger Stern leuchtet in der Dunkelheit. Verdammt, wo bin ich?!
Ich verharre eine Weile in meiner sitzenden Position. Ich träume. Ich muss träumen! Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Eine ziemlich plumpe Erklärung. Aber wie sonst soll es schon sein? Ich befinde mich in einer surrealen Welt. Ich weiß nicht, wo ich bin, und ich weiß nicht, warum ich hier bin.
Plötzlich höre ich etwas, und auch wenn es noch weit entfernt ist, zerreißt es die Stille. Das Röhren und Knattern erinnert mich an das Geräusch eines sehr alten Motors und es wird immer lauter, Angst wächst in meiner Brust und drückt gegen meine Lunge. Ich muss hier weg! Mühsam versuche ich mich hochzustemmen, aber meine Arme zittern unkontrolliert. Meine Beine sind von der plötzlichen Last überrascht und brauchen ein paar Sekunden, um einen sicheren Stand zu finden. Ich stolpere nach links zu einem baufälligen Gebäude und stoße die Tür auf. Sie knallt zu Boden und Staub wirbelt auf. Hier drinnen muss einmal ein Restaurant oder ein Café gewesen sein, überall stehen Tische und Stühle, manche davon völlig kaputt. Unter meinen Schuhen knirscht Glas, als ich einen ersten Schritt mache. Der Geräuschpegel und meine Panik steigen gleichermaßen, also durchquere ich schnell den Raum und betrete eine große Küche. Der röhrende Motor ist jetzt so nah und ich atme keuchend aus, als er plötzlich stoppt.
Ich höre, wie Autotüren geöffnet werden, und kurz darauf eine männliche Stimme. Sie ist rau und tief: »Bist du dir sicher, dass sie hier abgelegt worden ist, Erin?«
»Ganz sicher. Die Narkose muss schon nachgelassen haben«, antwortet eine Frau bestimmt.
Mein Atem geht flach und mein Herz klopft wie wild, als ich mich hinter einem Herd verstecke.
»Na gut. Leute, verteilt euch und sucht sie!«, brüllt der Mann. Ich höre dumpfe Schritte, viele Schritte. Das sind mehr als nur zwei Personen. Ich drücke mich lautlos noch weiter in den Schatten und unterdrücke einen Schmerzenslaut, als ich mit der Schulter gegen eine Türklinke stoße. Sie wissen, dass ich dort draußen gewesen bin, und sie suchen mich. Aber warum suchen sie mich? Was wollen sie von mir? Verzweifelt versuche ich mich an etwas zu erinnern. Ich ringe um eine Erinnerung, die mir all das hier erklärt. Aber das Letzte, was mir einfällt, ist, wie ich am Abend vor meinem Geburtstag zu Bett gehe. Wie lange ist das her?
Die Stimmen und die schweren Schritte der Fremden werden leiser, Erleichterung durchströmt mich. Sie werden mich nicht finden. Sie werden aufgeben und dorthin zurückfahren, wo sie hergekommen sind – wo auch immer das ist. Ich will nicht wissen, wer sie sind. Diese Leute sollen einfach nur verschwinden. Und dann muss ich herausfinden, wo ich bin und wie ich von hier wegkomme.
Mir bleibt fast das Herz stehen, als ich Glas knirschen höre. Panisch drücke ich mir die Hand auf den Mund, um meinen lauten, keuchenden Atem zu unterdrücken. Ich lausche angestrengt, aber außer fernen Rufen höre ich nichts.
»Ich weiß, dass du dich hinter diesem Herd versteckst. Komm hervor, aber langsam. Ich bin bewaffnet.«
Mir stockt der Atem. Das ist die Männerstimme, die ich vorhin bereits gehört habe, und sie ist ganz nah, in diesem Raum.
Ich habe keine Wahl. Als ich mich langsam aufrichte, versuche ich mir meine Angst nicht anmerken zu lassen. An der Tür, nur etwa fünf Schritte entfernt, steht ein junger Mann. Er hat dunkles halblanges Haar und eine kantige Gesichtsform. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder ob ich überhaupt etwas sagen soll. Meine Arme hängen schlaff herab und ich zwinge mich, ihm in die Augen zu sehen. Das Gewehr, das er auf mich richtet, lässt er kaum merklich ein paar Millimeter sinken.
Was soll ich machen? Was wollen sie von mir und warum hat der Typ eine Waffe? Ich schiele zu meinem letzten Ausweg, zu meiner einzigen Hoffnung.
Ohne länger zu überlegen, wirble ich herum, stoße die Hintertür rechts von mir auf. Sie führt tatsächlich ins Freie und ich stolpere auf eine weitere breite menschenleere Straße. Darauf gefasst, verfolgt und beschossen zu werden, renne ich los. Ich will so viel Abstand wie nur irgend möglich zwischen den Kerl und mich bringen. Doch schon nach kurzer Zeit höre ich ihn hinter mir und nur wenige Augenblicke später spüre ich einen festen Griff um meinen Oberarm. Er reißt mich zu sich herum und ich strauchle.
»Wieso läufst du weg? Ich werde dir nicht wehtun!« Seine Stimme ist ruhig, sein Atem trotz des Laufs gleichmäßig.
»Und wozu dann die Waffe?«, frage ich keuchend und nicke zu seinem Gewehr, das er inzwischen geschultert hat.
»Es besteht trotzdem kein Grund, vor mir davonzulaufen. Wir bringen dich zu unserer Basis.«
Ich schaue über die Schulter. Immer noch will ich nur weg von hier. Lieber stelle ich mich allein meinem Schicksal, finde allein einen Weg aus dieser gottverdammten Geisterstadt, als mit diesem Typen mitzugehen. Ich darf niemandem trauen. Und schon gar nicht jemandem, der mit einer Waffe auf mich zielt.
»Denk nicht mal daran.« Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. »Allein würdest du keine Woche überleben.«
Widerwillig wende ich meinen Blick zu dem Typen, der mich genau beobachtet. »Wer sagt, dass ich bei euch eine Woche überlebe?«
»Ich«, antwortet er knapp, aber bestimmt.
Voller Skepsis sehe ich ihn an. »Wo sind wir hier?«, frage ich dann und kann einen unsicheren Unterton nicht verhindern.
»New York.«
»New York?«, wiederhole ich verdutzt. »Diese Stadt gibt es nicht und hat es nie gegeben. Sie wurde nur erfunden, um der Vergangenheit ein Gesicht zu geben.«
Der Junge schnaubt. »Diese Lügen habe ich schon fast vergessen. Nun, unsere Regierung hat New York tatsächlich von den Landkarten verschwinden lassen. Jetzt können sie uns hier gefangen halten, ohne dass jemand davon erfährt. Wirklich klug, findest du nicht?«
»Was?« Ich starre ihn an. »Warum sollte man mich gefangen genommen haben?«
»Wenn in ein paar Stunden die Giftstoffe der Narkose deinen Körper verlassen haben, wird deine Erinnerung zurückkehren«, erklärt er. »Sie haben deine Zukunft gesehen, und dort haben sie etwas gesehen, das ihnen nicht gefällt. Deshalb musstest du entsorgt werden.«
Seine Antwort bringt mich aus dem Konzept. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was er mir zu erklären versucht. »Äh, was?«
»Wie gesagt, du wirst dich bald daran erinnern können.«
Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden. »Wie meinst du das, sie hätten meine Zukunft gesehen?«
»Du wirst eine Straftat begehen und dafür wurdest du verurteilt. Alles Weitere erkläre ich dir in der Basis.«
»Eine Straftat? Woher willst du das wissen? Du kennst mich gar nicht«, fauche ich angriffslustig. Der hat sie doch nicht mehr alle!
Für einen Moment glaube ich Verärgerung in seinen Augen aufblitzen zu sehen, aber eine Sekunde später ist sein Gesichtsausdruck wieder neutral. »Weil es immer so ist. Hier hat jeder von uns das Gleiche erlebt.« Was ist hier los? Das ist doch Irrsinn!
»Das muss ein Fehler sein!« Hysterie mischt sich in meine Stimme. Warum wache ich nicht endlich aus diesem Albtraum auf? »Ich habe kein Verbrechen begangen und ich werde auch keines begehen! Sie können mich hier nicht einfach abladen!«
»Es gibt keinen Weg zurück. Sie lassen niemanden gehen«, sagt der Junge ernst. Seine dunkelblauen Augen ruhen auf mir. Ist es Mitleid? »Du bist verurteilt. Du gehörst jetzt zu uns.«
2
14 Stunden zuvor
Ich falte meine Vorladung und stopfe sie zurück in meine Hosentasche, verärgert bemerke ich dabei meine zitternden Hände. Warum bin ich so aufgeregt? »Ms Evans?« Ich sehe zu einer zierlichen Frau auf. »Bitte folgen Sie mir.«
Ich stehe auf und versuche mir unauffällig die schwitzigen Handinnenflächen an meiner Jeans trocken zu wischen. Die Frau führt mich in ein großes Zimmer, das mich an den Behandlungsraum meines Arztes erinnert. Der Boden ist sauber, weiß und die Wände sind nicht aus Stein, sondern aus Milchglas.
»Ah, Ms Evans. Schön, Sie zu sehen. Mein Name ist Theodore Stone«, begrüßt mich ein magerer Mann mittleren Alters. Er stemmt sich von seinem Drehstuhl hoch und hält mir seine Hand entgegen.
»Guten Tag«, nuschle ich und schüttle sie. Seine Hand ist knochig und kalt.
Die Frau verlässt ohne ein weiteres Wort den Raum. »Setzen Sie sich.« Stone deutet auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Ich tue wie geheißen und schiebe meine Hände unter die Oberschenkel, um sie am Zittern zu hindern. »Es besteht kein Grund zur Besorgnis.« Er lächelt mich beschwichtigend an, lässt sich mir gegenüber nieder und richtet seine königsblaue Krawatte. Sie ist wegen seines ebenfalls blauen Anzugs kaum zu erkennen.
Die Uniform eines Regierungsmitglieds.
»Nach Ihrer Berufseinweisung können Sie ganz gelassen Ihren siebzehnten Geburtstag feiern.«
Ich nicke nervös. Meine Eltern waren Mitglieder der Regierung, dadurch gibt es für mich nur einen möglichen Berufszweig. In Concordia werden die Kinder immer in den Berufen der Eltern ausgebildet, egal, welche Fähigkeiten sie besitzen. Das ist seit Generationen so.
»Also, haben Sie noch irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen?« Schnell schüttle ich den Kopf. Keine Fragen. Ich will es einfach nur hinter mich bringen und frage mich gleichzeitig warum, weil es doch schließlich um meine Zukunft geht. Wie lange habe ich meiner Selbstständigkeit entgegengefiebert? »Gut.« Er beugt sich nach vorne und faltet seine Hände. »Dann werde ich Ihnen jetzt den Ablauf erklären.« Ablauf? Stone deutet hinter mich. »Mithilfe dieses Gerätes führen wir ein paar einfache Tests durch.«
Ich drehe mich auf meinem Stuhl um. Das Ding sieht aus wie ein Tomograf. »Ähm …« Ich räuspere mich. »Was für Tests? Ich dachte, in diesem Gespräch geht es um allgemeine Informationen zu meinem Ausbildungsbeginn nächste Woche.«
»Aber sicher, das tut es auch.« Das Lächeln, welches er mir dabei schenkt, wirkt unecht und reicht nicht bis zu seinen Augen. »Es handelt sich lediglich um einen psychologischen Test. In der Regierung gibt es sehr vielfältige Aufgabengebiete und wir müssen wissen, in welches Sie am besten passen.« Ein Psychotest? Na, super. Hätten es dafür nicht auch Stift und Papier getan? »Sie werden sich hineinlegen. Sobald die Luke geschlossen ist, startet der Test. Ich werde Ihnen neun Fragen stellen, die Sie bitte nur mit Ja oder Nein beantworten. Überlegen Sie nicht, sondern antworten Sie instinktiv. Haben Sie das verstanden?«
»Nur mit Ja oder Nein«, wiederhole ich.
»Sehr schön, dann können wir beginnen.«
Irritiert sehe ich ihn an, weil ich mit einer viel längeren Erklärung gerechnet habe. Mehr muss ich nicht machen? Rumliegen und Fragen mit Ja oder Nein beantworten? Und was bitte soll das aussagen? Ich halte nichts von Psychologie, weil ich der Meinung bin, dass jemand mit schauspielerischem Talent den Leuten alles Mögliche weismachen kann. Solange Menschen lügen können, wird es unmöglich sein, ihre Psyche zu entschlüsseln.
Stone steht auf, durchquert den Raum und winkt mich zum Tomografen. Als ich ihm folge, schnürt sich mir die Kehle zu und ein ungutes Gefühl breitet sich bis in meine Fingerspitzen aus. Warum hat bisher nie jemand von diesem Test erzählt? Ungelenk lege ich mich auf die ausgefahrene Liege und verschränke die Finger vor meinem Bauch. »Es wird etwa fünf Minuten dauern«, informiert er mich und schenkt mir ein Lächeln, mit dem er mich vermutlich beruhigen möchte. Fünf Minuten und neun Fragen, dann ist die Aufregung vorbei. Ich versuche mich zu entspannen, als ich in die Röhre hineingefahren werde. Die Luke hinter meinen Füßen schließt sich und ich bin in völlige Dunkelheit gehüllt. Normalerweise habe ich keine Klaustrophobie, aber hier drinnen wird mir mulmig. Alles, was ich hören kann, ist mein eigener unregelmäßiger Atem. Was für Fragen wird Stone mir stellen? Was ist, wenn ich doch überlegen muss, bevor ich antworte?
Ich zucke zusammen, als ich plötzlich klar und deutlich seine Stimme dicht an meinem Ohr höre. »Vor Ihnen liegt ein Apfel. Heben Sie ihn auf?«
Hä? »Ja«, sage ich, weil es das Erste ist, was mir in den Sinn kommt.
»Der Apfel hat ein Loch. Möchten Sie wissen, ob sich darin ein Wurm befindet?«
Okay, selbst für einen Psychotest sind das echt merkwürdige Fragen. »Ja«, antworte ich dennoch. Sonst kann ich ihn ja nicht essen. Ich warte auf die nächste Frage, aber es kommt nichts. Die Stille hält immer länger an. Sagte Stone nicht, er würde neun Fragen stellen? Hallo? Habe ich etwas falsch gemacht? Aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich mich an alles gehalten habe, was er mir im Vorfeld erklärt hat, und so schwer waren seine Anweisungen nun auch wieder nicht. Wie viele Minuten sind mittlerweile vergangen? Vielleicht ist der Lautsprecher ausgefallen, doch ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Es läuft nicht nach Plan.
Eine halbe Ewigkeit später öffnet sich plötzlich die Luke, meine Liege setzt sich automatisch in Gang und wird hinausgefahren. Von der Helligkeit geblendet kneife ich die Augen zusammen, doch bevor ich mich wieder an das Licht gewöhnt habe, werde ich von der Liege gezerrt.
»Was soll das?«, frage ich entgeistert und versuche mich aus dem Griff eines großen und muskulösen Mannes zu winden. Das Licht spiegelt sich in seiner polierten Glatze.
»Ms Evans, Ihr Test ist vorbei.« Mein Blick findet Stone, sein Lächeln ist verschwunden. »Aufgrund Ihrer Zukunft werden Sie von der Regierung verurteilt.«
Ich starre ihn ungläubig an. »Verurteilt wegen meiner Zukunft? Was soll das heißen?«, stottere ich.
»Theo, lass uns den Fall erst prüfen.« Im Schwitzkasten ist es mir unmöglich, einen Blick auf die Besitzerin dieser hellen klaren Stimme zu erhaschen. »Wir wissen nicht, wer ihre Zukunftsdaten gelöscht hat. Ich habe den Alarm bereits ausgelöst, die Türen sind verriegelt. Wir werden gleich erfahren, wer dahintersteckt, und dann können wir klären, warum –«
»Da gibt es nichts zu klären! Der Grund ist offensichtlich!« Sein Gesicht läuft vor Wut rot an und seine Augen treten hervor. Was meint er damit? Was ist offensichtlich? »Führ sie ab!«, befiehlt er dem Mann hinter mir. Ich bin so geschockt, dass ich es nicht einmal schaffe, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Also werde ich halb geschleift, halb getragen.
»Bitte! Bitte, erklären Sie mir doch endlich, was los ist! Was habe ich falsch gemacht?«, rufe ich panisch, aber da fällt die Tür schon zu.
3
Ich schrecke hoch. Im ersten Moment weiß ich nicht, wo ich bin, aber nach ein paar Augenblicken kehrt die Erinnerung zurück.
New York. Der Typ mit der Waffe. Gefangenschaft.
Ich sitze auf feuchtem Boden, den Kopf an eine Backsteinwand gelehnt. Ich muss eingeschlafen sein, denn mein Nacken ist steif und mir ist kalt. Meine Erinnerung ist wieder da und schweren Herzens gestehe ich mir ein, dass der Typ mit der Waffe nicht gelogen hat. Ich wurde verurteilt. Aufgrund meiner Zukunft. Es hört sich irrsinnig an, so merkwürdig. Normalerweise hätte ich das alles als ziemlich fantasievollen Traum abgetan, aber es deckt sich zu sehr mit den Worten des Typen.
Ich vergrabe das Gesicht in den Händen und schütze mich so vor dem immer heller werdenden Licht der Sonne. Sie versucht sich hartnäckig einen Weg durch das rostige und verschmutzte Kellerfenster zu bahnen. Normalerweise mag ich die Sonne und ihre warmen Strahlen auf meiner Haut, aber momentan blendet die Helligkeit meine empfindlichen Augen und verursacht mir Kopfschmerzen.
Neben dem Jungen mit der Waffe waren da noch eine schlanke junge Frau und andere Typen. Alle trugen Gewehre oder hatten Pistolen in ihre Gürtel geschoben, aber auf dem ganzen Weg hat niemand mit mir gesprochen. Sie haben mich in den Keller gebracht und seitdem sitze ich hier und weiß nicht, was mit mir passieren wird. Was geht hier vor? Warum werde ich hier eingesperrt? In einen Raum ohne Tisch, ohne Stuhl, ohne Toilette. Nur zweimal wurde ich in ein heruntergekommenes Badezimmer gebracht, dessen Fliesen gesprungen und von Dreck verkrustet waren.
Ich seufze und richte mich auf. Ich will diesen Leuten nicht ausgeliefert sein und warten müssen, bis sie sich dazu entschließen, mich herauszulassen. Mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Ich bewege meine Zehen, dehne den Fuß, damit wieder Blut durchfließt und das Gefühl langsam zurückkehrt. Dann stehe ich auf und gehe direkt auf die Tür zu. Auch wenn eine offene Tür absurd wäre, versuche ich mein Glück und rüttle am Knauf. Natürlich verschlossen, also bleibt nur das Fenster. Es ist zwar relativ weit oben, aber wenn es sich öffnen lässt, kann ich mich am Fenstervorsprung hochziehen und mich hindurchquetschen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und packe den Fenstergriff. Mit aller Kraft versuche ich ihn zu bewegen, immer und immer wieder, aber keine Chance. Ein Frustlaut entfährt mir und ich trete wütend gegen die Wand. Erschrocken fahre ich zusammen, als sich die Tür hinter mir quietschend öffnet.
»Gefällt es dir hier etwa nicht?« Der Kerl von vorhin betritt den Raum. Sein Gewehr hat er zwar nicht dabei, aber in seinem Gürtel steckt eine stahlgraue Pistole. Er grinst.
»Ein Spaßvogel«, stelle ich trocken fest.
Er ignoriert meinen Kommentar und nickt zum Fenster. »Wo solls denn hingehen?«
»Raus«, sage ich nur. Macht er sich über mich lustig? Ist das seine Art von Humor?
»Das würde ich an deiner Stelle bleiben lassen.« Er winkt mich zu sich. »Komm mit.«
Ich erwarte, dass wir nach oben gehen, aber er bringt mich nur zwei Kellerabteile weiter. Er öffnet die Tür und hält sie mir auf. Ich runzle die Stirn und bewege mich keinen Zentimeter. »Warum lässt du mich nicht gehen?«
»Wo würdest du als Verurteilte denn hingehen?«, stellt er die Gegenfrage. »Glaubst du ernsthaft, du bist zu Hause jetzt noch willkommen?«
Ich öffne den Mund und schließe ihn wieder. Seine Frage versetzt mir einen Stich. Und noch schlimmer ist die Tatsache, dass es darauf nur eine Antwort gibt.
Er seufzt ungeduldig. »Na also.«
Ich schiebe den Unterkiefer nach vorne und gehe widerwillig an ihm vorbei in das Kellerabteil, doch zu meiner Überraschung ist es nicht leer. Die schlanke junge Frau von vorhin und ein Kerl, den ich noch nie gesehen habe, sitzen an einem großen Tisch.
»Nimm Platz.« Sie deutet auf einen alten wackligen Holzstuhl. Als die Tür ins Schloss fällt, zucke ich zusammen. Auch wenn ich es nicht zugeben will, meine Körpersprache wird meine Unsicherheit verraten. Verärgert über mich selbst lasse ich mich auf den Stuhl sinken. Der Kerl setzt sich neben die junge Frau und der Tisch zwischen uns sorgt für einen beruhigenden Abstand.
»Wie heißt du?«, will sie wissen. Ich mustere sie. Ihre dunklen Haare sind auf der rechten Seite fast komplett abrasiert. Zuerst meine ich, dass sie sich auf ihrer Kopfhaut ein Tattoo hat stechen lassen, aber dann erkenne ich, dass es sich dabei um einen etwa zehn Zentimeter langen, noch nicht vollständig verheilten Schnitt handelt.
»Kannst du dich an deinen Namen nicht erinnern?«
Ich möchte nicht auf ihre Verletzung starren, aber es ist schwer, es nicht zu tun. Wie hat sie sich so verletzt? »Samantha Evans«, antworte ich schließlich auf ihre erste Frage.
»Kannst du dich schon wieder an deine Verurteilung erinnern?«
Wieso ist das wichtig? Und warum stellen mir diese fremden Personen überhaupt Fragen? Ich sollte die Fragen stellen!
Ich zögere. Etwas in mir hält meine neu gewonnene Erinnerung zurück. »Nein.«
»Wurdest du vor deiner Verurteilung bereits wegen irgendwelcher Verbrechen angeklagt?«
»Nein.«
»Erzähl uns von dir, von deinem Leben.«
So weit kommts noch! Warum sollte ich drei Fremden etwas von mir preisgeben? »Nein«, sage ich und höre mich dabei an, als hätte ich dieses Wort aufgenommen, um es jetzt immer und immer wieder abzuspielen.
Die Frau richtet sich auf. Ihre dunkelgrünen Augen fixieren mich wachsam. »Warum nicht?«
»Ich weiß ja nicht mal, wer ihr seid! Wieso interessiert euch mein Leben?«
»Wir nehmen dich bei uns auf, also müssen wir dich kennen und dir vertrauen.« Ruhig, zu ruhig. Ich schaue auf, in die Augen des Typen, der mich hergebracht hat. Warum habe ich mich nicht stärker gewehrt? Warum habe ich aufgegeben?
Meine Fingernägel drücken sich in meine Haut, als ich die Hände zu Fäusten balle, und meine Stimme zittert, als ich spreche. »Das geht euch nichts an.«
Stille.
»Sie ist eine von denen.« Das ist das erste Mal, dass der andere etwas sagt. Mein Blick huscht zu ihm. Sein schwarzes Haar ist kurz geschoren, die harten Gesichtszüge sind angespannt. Drei Piercings zieren seine Augenbrauen und der Kragen seines T-Shirts kann die wulstige Narbe am Hals nicht verdecken. Er erwidert meinen Blick feindselig.
»Jeff«, sagt der, der mich hergebracht hat, warnend.
Jeff dreht sich wütend zu ihm um. »David, der Moralapostel. War ja klar. Sie zögert bei jeder Antwort und enthält uns Informationen vor. Selbst du weißt, was das bedeutet!«
Die junge Frau verdreht die Augen. »Leute, bitte. Wollen wir das Gespräch vielleicht erst mal zu Ende führen, bevor wir uns eine Meinung bilden?«
»Es ist Stunden her, seit sie hier angekommen ist. Ihre Erinnerungen müssten schon längst wieder da sein!«, donnert Jeff.
»Was ist los?« Angespannt schaue ich in die Runde. Offenbar ist es weniger ein Problem, dass ich nicht von mir erzählen möchte, als dass ich den Ablauf meiner Verurteilung verschweige. »Ist es denn so schlimm, dass ich mich noch nicht erinnern kann?« Jeffs Lachen hallt unnatürlich laut. Gänsehaut läuft mir über den Rücken.
»Nein, natürlich nicht«, meint das Mädchen beschwichtigend.
»Natürlich nicht?«, wiederholt Jeff. »Erin, stell dich doch nicht dumm! Sie ist eine von denen!«
»Von wem soll ich sein?«, frage ich und werde langsam ungeduldig. Warum spricht der Typ nicht einfach mal mit mir?
»Hör jetzt auf, Jeff!« David knallt die flache Hand auf den Tisch. Bei dieser unerwarteten Geste zucke ich abermals zusammen und verfluche mich dafür. »Samantha ist vor mir davongerannt, als ich sie gefunden habe, und als ich sie gerade holen wollte, hat sie versucht durchs Fenster abzuhauen. Sie ist keine von ihnen!«
»Das gehört alles zu ihrem Plan! Ihr lasst euch doch total verarschen!« Er dreht sich wieder zu mir. »Es gab bei uns schon Spione, die besser vorbereitet waren, Süße.«
»Jetzt halt doch mal die Klappe, Jeff!«, ruft Erin entnervt. »Lass mich bitte das Gespräch zu Ende führen und dann kannst du uns gerne deine Vermutungen mitteilen!« Jeff verschränkt die Arme vor der Brust und kneift wütend die Lippen zusammen. An seiner Schläfe pulsiert eine Ader.
»Schön«, sagt Erin schroff, ohne ihn anzusehen. »Also, Samantha, du sagst, du kannst dich noch nicht erinnern. Warst du, seit du hier bist, die ganze Zeit wach?«
Ich schüttle langsam den Kopf. »Nein, ich glaube, ich bin mal eingeschlafen.« Ich merke sofort, dass ich die falsche Antwort gegeben habe. Erin zieht die Augenbrauen nach oben und wechselt einen vielsagenden Blick mit David.
Ich will ihnen nicht von meiner Verurteilung erzählen, eine Stimme in meinem Kopf flüstert mir ein, dass es besser ist. Neun Fragen, hat der Regierungsabgeordnete behauptet und doch wurden mir nur zwei gestellt. Zwei von neun! Da kann doch was nicht stimmen! Außerdem hallen die Worte der Frau in meinem Kopf nach: Wir wissen nicht, wer ihre Zukunftsdaten gelöscht hat. Was meinte sie damit? Jedenfalls hörte sich das nicht nach einem Routineablauf an. »Sollte meine Erinnerung schon wiedergekommen sein?«, frage ich scheinheilig.
»Die Narkose nimmt dir vorübergehend dein Kurzzeitgedächtnis. Aber normalerweise kehren die Erinnerungen innerhalb weniger Stunden zurück. Mindestens vier, höchstens zehn. Schlaf hilft dem Körper, die Wirkung der Narkose schneller loszuwerden«, antwortet mir David. Sein Blick ruht auf mir, als wolle er keine meiner Reaktionen verpassen. »Du bist seit elf Stunden bei uns.«
Ich starre ihn an, bringe kein Wort heraus, weil ich weiß, dass er mich durchschaut hat. Aber welchen Nutzen können sie aus meiner Erinnerung ziehen? Warum wollen die das unbedingt wissen? Ich wurde verurteilt. Alles andere spielt doch jetzt keine Rolle mehr.
»Na gut, Samantha, lassen wir das Thema«, seufzt Erin, weil das Gespräch ganz offensichtlich nicht in ihrem Sinne verläuft. »Ich muss dich bitten, uns von deiner Familie zu erzählen. Wir wollen dir nichts Böses, vielmehr möchten wir dich bei uns aufnehmen. Aber wie David bereits sagte, müssen wir dir vertrauen können.«
»Wenn ich euch antworte, tut ihr es dann auch?«
»Natürlich«, sagt Erin ernst und ich glaube ihr.
»Ich habe keine Familie.« Ich verschränke die Arme und lehne mich zurück. Jeff schnaubt.
»Erzähl es uns«, fordert Erin mich auf.
Ich seufze. »Das ist sehr privat. Ich rede nicht gerne darüber.«
»Natürlich nicht«, bemerkt Jeff verächtlich.
Sein Kommentar fordert mich heraus. Ich lasse mich provozieren. Er behandelt mich wie irgendeine Spionin, die sich Geschichten über tote Verwandte ausdenkt. Nur zu gerne würde ich auf eine andere Kindheit zurückblicken und von rosaroten Marshmallows erzählen, aber diese Sorglosigkeit war mir nun einmal nicht vergönnt. »Meine Eltern sind gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Ich habe keine Erinnerung an sie. Zufrieden?«
»Sie sind beide gestorben? Was ist passiert?«, fragt Erin vorsichtig nach.
»Ein Hovercraftunfall. Sie waren auf dem Weg zum nationalen Kongress der Abgeordneten.«
»Deine Eltern waren Regierungsmitglieder?«, fragt David stirnrunzelnd. Seine Miene ist unergründlich.
Ich nicke. »Ja, warum?«
»Sagen wir mal so, es ist sehr ungewöhnlich.«
»Was ist sehr ungewöhnlich?« Ich verstehe nicht, worauf er hinauswill, und bin genervt, ihm alles aus der Nase ziehen zu müssen.
»Es ist sehr ungewöhnlich, dass die Tochter von zwei Regierungsabgeordneten hier landet.« Was will er damit sagen? Und was spielt das überhaupt noch für eine Rolle? Ich bin hier, egal wessen Kind ich bin und egal wie selten das vorkommt. »Welche Funktion hatten deine Eltern?«, bohrt David weiter und wieder frage ich mich, was das zur Sache tut.
»Das ist doch scheißegal!«, schnaubt Jeff und erspart mir dadurch eine Antwort.
»Es tut mir sehr leid, dass sie gestorben sind.« Erin sieht tatsächlich betroffen aus.
»Schon in Ordnung«, murmle ich, überrascht von ihrer Anteilnahme. »Es ist lange her. Außerdem bin ich froh, dass sie nicht miterleben müssen, wie ihre Tochter nach New York abgeschoben wurde.«
»Da seht ihr’s!« Jeff grinst triumphierend. »Woher weiß sie, dass wir in New York sind? Sie hat sich gerade enttarnt!«
»Sie weiß, dass wir in New York sind, weil ich es ihr gesagt hab, Alter«, bemerkt David trocken.
Jeffs Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig. »Haben wir nicht ausgemacht, den Neuen keine Fragen zu beantworten, bis wir sie verhört haben?«
»Ja, das haben wir tatsächlich.« Erin runzelt die Stirn und wirft David einen Seitenblick zu.
»Sie ist keine Spionin, also beruhigt euch.«
»Da scheint sich jemand aber sehr sicher zu sein.«
»Ja, Jeff, ich bin mir sicher! Da musst du wohl einfach mal meinem Urteil vertrauen!«
Jeff lässt seine Knöchel knacken, hält aber den Mund. David wendet sich an mich. »New York ist das Gefängnis von Concordia und von jetzt an dein Leben. Verlassen wirst du diese Stadt nie mehr, also rate ich dir, dich mit deiner Situation abzufinden. Wir brauchen hier keine Einzelkämpfer. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Team. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist mein Name David.« Er weist auf die anderen beiden. »Und das sind Erin und Jeffrey. Wir bilden die Führung dieser Gang.«
Ich reiße die Augen auf, weil ich nicht weiß, was mich mehr überrascht. Entweder die Existenz dieser Gang, die Existenz von Leben in dieser Geisterstadt oder aber die Tatsache, dass Jeff eine Führungsposition innehat. »Wenn du ›dieser Gang‹ sagst«, fange ich langsam an, »heißt das dann, es gibt noch andere?«
David nickt. »Neben uns gibt es noch einen weiteren Zusammenschluss. Sie haben ihre Basis auf der Eastside, also auf der anderen Seite des Central Park. Es kann sehr ungemütlich werden, wenn sie bei uns auftauchen, deshalb tragen bei uns alle Mitglieder zu jeder Zeit eine Waffe.«
Bestimmt habe ich mich verhört. »Sprichst du von einem Bandenkrieg?«
»Ganz genau, das tut er, Schätzchen! Hier fliegen die Fetzen!«, bestätigt mir Jeff feixend. Er ist über meine Reaktion offensichtlich hocherfreut. Ich versuche mein Entsetzen zu verbergen, meine verzweifelte Hoffnung, doch noch irgendwann aus diesem Albtraum aufzuwachen. Aber ich versage kläglich.
»Was wollen die anderen von euch?«
»Waffen, Nahrung oder neue Mitglieder, hier gibt es eine Menge Dinge, um die wir konkurrieren. Die monatlichen Versorgungspakete von Concordia beinhalten zum Beispiel Brot, Bohnen, Reis, sauberes Wasser, Benzin für die Generatoren und sogar manchmal etwas Medizin. Trotzdem reicht es nicht zum Überleben, also müssen wir uns selbst helfen«, beantwortet David meine Frage. »Aber mach dir keine Gedanken. Du wirst vorbereitet sein. Jeff wird dir beibringen zu schießen und Erin ist im Nahkampf die Beste.«
Schießen. Kämpfen. Töten? Wo bin ich hier gelandet?
»Außerdem lernst du die täglichen Aufgaben kennen. Am Anfang wirst du häufig wechseln, nach ein paar Monaten feste Aufgaben bekommen, die sich dann nur noch selten ändern werden.« Ich versuche David zuzuhören, aber er wird von einem Rauschen übertönt, das sich in meinen Ohren ausbreitet und mir das Denken unmöglich macht. »Hast du noch irgendwelche Fragen?«
»Was wirft mir die Regierung vor, weswegen wurde ich denn verurteilt?«
»Die Regierung hat die Möglichkeit, in unsere Zukunft zu sehen. Sie tarnen es als Berufseinführungsgespräch, während sie dich in Wahrheit durchleuchten. Du wärst in der Zukunft straffällig geworden, also haben sie dich hierhergebracht. So bist du für das Volk keine Gefahr mehr. Niemand von uns kennt die genauen Gründe für seine Verurteilung.«
Die Regierung kann in die Zukunft sehen? Das klingt wahnsinnig, wie eine schlechte Idee aus einem noch schlechteren Film. Am liebsten würde ich lachen, aber die ernsten Mienen sowie die Waffen der drei halten mich davon ab. Was ich vorhin noch als Albtraum abtun wollte, entspricht also der Wirklichkeit.
Zwei Fragen habe ich noch und doch spreche ich nur eine laut aus. »Wie hält uns die Regierung gefangen?« Und wie komme ich hier wieder weg?
Davids Gesichtsausdruck bleibt neutral, obwohl ich in seinen Augen noch etwas anderes wahrnehme, beinahe so, als würde er glauben, dass ich die Antwort bereits kenne. »New York befindet sich unter einer Kuppel. Sie ist nichts Festes, nichts, was du greifen könntest. Und auch wenn die Versuchung groß ist, würde ich dir raten, sie nur aus der Ferne zu betrachten.« Fragend hebe ich die Augenbrauen. »Du würdest bei lebendigem Leib verbrennen. Ist kein schöner Anblick, glaub mir.«
»Wieso solltest du ihm glauben, bevor du es nicht selbst gesehen hast?« Jeff spricht leise, verführerisch und lockend. Fast so wie eine innere Stimme in mir. »Woher willst du wissen, dass er dir die Wahrheit erzählt?«
Erin würdigt ihn keines Blickes. »Hör auf«, zischt sie und tatsächlich gehorcht er. Trotzdem bedenkt er mich mit einem hämischen Grinsen und zieht kaum merklich eine Augenbraue nach oben, was wahrscheinlich so viel bedeuten soll wie: Deine Entscheidung.
»Ich bringe dich jetzt in dein Zimmer, dort kannst du dich ausruhen«, sagt Erin. Froh hier endlich rauszukommen, will ich mich gerade erheben und ihr folgen, als uns David zurückhält.
»Ich möchte mit Samantha noch unter vier Augen sprechen. Ich bringe sie dann selbst hoch.«
Erin bleibt verdutzt stehen und wirft ihm einen flüchtigen Blick zu. »Okay«, sagt sie dann nur.
Jeff hingegen baut sich vor David auf. »Was hast du mit ihr zu bereden, was wir nicht hören dürfen?«
»Wir sprechen später, Jeff.« In diesem einen Satz liegt so viel Autorität, dass Jeff die Lippen zusammenkneift, sich umdreht und wütend aus dem Raum stapft. Erin folgt ihm und schließt die Tür hinter sich.
Neugierig warte ich darauf, dass David etwas sagt. Aber er spricht nicht und sieht mich nur an. Besser gesagt, er fixiert mich mit seinen dunklen Augen. Dunkelblau, fast schwarz. Und genau in dem Moment, als ich mich entscheide zu fragen, was er von mir will, macht er den Mund auf.
»Wir kennen uns doch.«
4
Damit habe ich nicht gerechnet. Ich schüttle langsam den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«
Er starrt mich an. »Doch«, sagt er mit Nachdruck. »Wir sind uns schon einmal begegnet.«
»Wann soll das gewesen sein?«
»Sag du es mir.«
»Wann denn? Und wo? Ich kann mich wirklich nicht erinnern!« Ich mustere ihn genau, aber mir kommt sein Gesicht nicht bekannt vor. Weil er so überzeugt wirkt, will ich ihm eine Begründung anbieten, nur damit er mich dann hoffentlich in Ruhe lässt. »Ich kann mich ja auch noch nicht an meine Verurteilung –«, fange ich an, aber David unterbricht mich.
»Natürlich kannst du dich an deine Verurteilung erinnern. Keine Ahnung, warum du dir nicht einfach irgendwas ausgedacht hast. Ist mir eigentlich auch egal. Ich will wissen, warum du behauptest, du würdest mich nicht erkennen. Du lügst.«
Mir wird heiß und das Blut schießt mir in den Kopf. Woher nimmt er sich das Recht, so mit mir zu reden? »Ich lüge dich nicht an«, sage ich und versuche ruhig zu bleiben.
David lächelt kühl. »Du bleibst also dabei?«
»Ja, schon, ich meine, was soll ich denn sagen? Ich kenne dich nicht!«, stottere ich fassungslos.
Er steht abrupt auf, sodass sein Stuhl gefährlich wackelt. »Alles klar. Komm mit, ich zeig dir dein Zimmer.« Schweigend folge ich ihm aus dem Keller in das Erdgeschoss. Als ich hergebracht wurde, hatte ich keine Gelegenheit, mich umzusehen. Wir befinden uns in einem Gebäude, das wie vermutlich alle anderen Häuser in dieser Stadt alt und verfallen ist. Einige Fenster sind zerbrochen, sodass ich mir gar nicht vorstellen will, wie zugig und kalt es hier im Winter werden kann. Die Treppen zu den oberen Stockwerken sind aber weitgehend unbeschädigt. Alles in allem erinnert mich die Architektur an ein Hotel. Wir durchqueren eine große Eingangshalle und steigen ins zehnte Stockwerk hinauf. Ich war schon immer eher eine durchschnittliche Sportlerin, sodass ich die letzten Stufen nur noch keuchend nehmen kann.
»Du musst deine Ausdauer trainieren«, sagt David barsch, ohne mich anzusehen. Er geht einen langen Flur entlang und stößt eine der hinteren Türen auf. »Das ist dein Zimmer. Erin wird dich heute Abend zum Essen abholen.« Und dann ist er auch schon weg.
Ich betrete den Raum und bin überrascht. Dort stehen ein Bett mit Kissen und Decke, ein Tisch und zwei Stühle, sogar ein Schrank ist hier. Na gut, die Bettdecke ist mottenzerfressen, die Tischplatte ist völlig zerkratzt und eine der Schranktüren hängt aus den Angeln. Außerdem hat sich ein staubiger alter Geruch festgesetzt. Aber egal, wie renovierungsbedürftig es ist, dies ist mein Zimmer und zum ersten Mal muss ich es mit niemandem teilen. Als ich mich genauer umsehe, entdecke ich sogar noch ein Badezimmer. Vom Waschbecken ist zwar leider nur noch die Hälfte vorhanden, dafür sind Klo und Dusche noch ganz gut in Schuss. Ich gehe wieder zurück in mein Zimmer und versuche das Fenster zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen. Zuerst klemmt es, aber schließlich schaffe ich es, den unteren Teil hochzuschieben. Die vielen hohen Backsteingebäude ringsherum bilden einen starken Kontrast zu der riesigen rechteckigen Grünanlage, die sich nur wenige Querstraßen entfernt erstreckt. In der Ferne meine ich sogar einen See glitzern zu sehen. Eine fast friedliche Stille liegt über der Stadt, doch dass dieser Schein trügt, habe ich gerade erfahren.
Den restlichen Vormittag verbringe ich damit, es etwas wohnlicher zu machen. Ich schüttle Decke und Kissen aus und repariere den Schrank. Mit einem alten Lappen, den ich im Bad gefunden habe, wische ich Staub. Normalerweise bin ich nicht besonders ordentlich, aber heute hilft mir das Putzen, meine Gedanken zu sortieren. Die Geschehnisse im Keller lassen mich nicht los. Jeffs Feindseligkeit hat mich schockiert, vor allem, weil ich nicht weiß, womit ich sie verdient habe. Und doch ist es Davids Verhalten, das mich am meisten irritiert. Während des Verhörs hat er sich noch für mich eingesetzt und gegen Jeff verteidigt. Und dann? Das Vieraugengespräch. Ich kann mich nicht an ihn erinnern und überlege die ganze Zeit, wo wir uns schon mal begegnet sein könnten. Vielleicht war er in einer Parallelklasse von mir oder hat auch im Heim gelebt. Dort waren so viele Kinder. Warum ist er sauer, wenn ich das nicht mehr weiß?
Nach einiger Zeit schweifen meine Gedanken ab und es setzen sich Fragen fest, auf die ich nie Antworten erhalten werde. Warum wurde ich verurteilt, wenn es Mr Stone nicht möglich war, meine Zukunft zu analysieren? Wer hat die Daten gelöscht? Wer wollte mich aus dem Weg räumen? Ich ziehe mir einen Stuhl ans Fenster, stütze meine Ellbogen auf dem Fensterbrett ab und lege das Kinn in meine Hände. Der Anblick dieser Geisterstadt fasziniert mich.
Ein lautes Klopfen reißt mich aus dem Schlaf und meine Ellbogen rutschen vom Fensterbrett. Ich sehe mich verwirrt um und es dauert einen Moment, bis ich realisiere, wo ich bin. Instinktiv will ich mich verstecken und unter mein Bett kriechen oder ins Bad flüchten, an die Wand drücken, aber einen Moment später rufe ich mich zur Vernunft. Ein Angreifer würde vor seinem Überfall wohl kaum an meine Tür klopfen. Erneut pocht es und ich mache vorsichtig die Tür auf.
»Hast du Hunger?« Erin steht vor mir, sie sieht müde, aber zufrieden aus. Ihre Jeans ist an den Knien braun verfärbt und sie reibt ihre erdigen Hände an den Hosen ab. Ich frage mich, was sie den Tag über gemacht hat.
Mein Magen grummelt. Seit Tagen habe ich nichts mehr gegessen, oder zumindest fühlt es sich danach an. Ich nicke. »Dann folge mir unauffällig!«, sagt sie gut gelaunt.
Wir gehen hinunter in den ersten Stock. Ich muss mich konzentrieren, um nicht zu stolpern. Immer noch spüre ich das Betäubungsmittel in meinem Blut. Es schwächt meinen Körper und er fordert Schlaf. Wir betreten einen großen Saal, der mich sehr an unsere Mensa in der Schule erinnert. Gegenüber der Tür und auf der linken Seite befinden sich Fenster, die, wenn das Glas nicht sowieso gesprungen ist, viel Glasreiniger nötig hätten. Die Strahlen der Abendsonne tauchen den kahlen Saal in ein rötliches Licht. Es gibt Leute, die sich über die länglichen Tische hinweg laut unterhalten oder Dinge zurufen, und andere, die für sich bleiben und allein essen. Es ist die Menge der Menschen, die mich in der Tür stehen bleiben lässt.
»Was ist los?« Erin dreht sich um, als sie merkt, dass ich ihr nicht mehr folge.
Ich sehe mich verblüfft um. »Ich habe nicht damit gerechnet –«, fange ich an, traue mich aber nicht, weiterzusprechen.
»Dass wir so viele sind«, beendet Erin meinen Satz. »Um genau zu sein, haben wir momentan dreiundachtzig Mitglieder. Vierundachtzig! Du gehörst ja jetzt auch zu uns. Mich erstaunt selbst, wie viele von uns es schaffen.« Wir reihen uns in die Schlange für die Essensausgabe ein.
»Was meinst du mit ›Wie viele es schaffen‹?«, frage ich nach.
»Bei Überfällen oder Angriffen sterben viele, aber auch durch Krankheit. Wir bekommen kaum Medikamente. Natürlich gibt es in der Stadt alte Vorräte, aber die meisten sind nicht mehr zu gebrauchen.«
Als ich die Bedeutung ihres Satzes erkenne, wird mir schlecht. »Du bist also überrascht, wie viele überleben?«
Sie sieht mich mitleidig an. »Du bist nicht mehr in Concordia, Samantha.«
Schweigend nehme ich mein Abendessen entgegen und folge ihr an einen Tisch, an dem bereits zwei Jungs sitzen. Einer von ihnen, ein schlaksiger Blonder, kommt mir sehr bekannt vor.
»Henry?«, sage ich erstaunt.
Henry fällt vor Überraschung die verbogene Gabel aus der Hand. »Was machst du denn hier, Samy?« Er springt auf, kommt um den Tisch auf mich zu und schließt mich in die Arme. Seine Nähe ist fest und tröstet mich, lässt mich durchatmen. Freudig klammere ich meine Hände in seinen Rücken und versuche meine Gedanken zu ordnen. Henry hat den Kontakt zu mir nicht freiwillig abgebrochen, er wurde auch verurteilt!
Schließlich lösen wir uns voneinander und setzen uns an den Tisch.
»Ihr kennt euch?« Erin rutscht zu mir auf die Bank.
»Wir waren … auf der gleichen Schule«, antworte ich wahrheitswidrig und sehe aus den Augenwinkeln, wie Henry stutzt.
»So ein Zufall!«, lacht sie. »Ich wollte dir die Jungs sowieso vorstellen. Henry ist seit einem Monat hier und Tim haben wir vor zwei Wochen aufgesammelt.« Tim und ich nicken uns zu. Er ist dunkelhäutig, hat breite Schultern und ein freundliches Lächeln. »Du wirst zusammen mit ihnen unterrichtet«, informiert mich Erin. »Natürlich sind sie weiter, aber du wirst schon klarkommen.«
Ich höre ihr kaum zu. Henry ist hier. Trotz der Zerstörung, der Ruinen, des Kampfs der Gangs kommt mir dieser Ort plötzlich viel heller und offener vor. Ich bin nicht mehr allein.
Ich begutachte das Essen auf meinem Teller und bin überrascht, dass es sowohl Fleisch als auch Salat gibt. Ich spieße ein paar Blätter mit der Gabel auf und schiebe sie mir in den Mund. Der Salat ist frisch und knackig, nur ein Dressing fehlt. »Der ist richtig gut!«
»Vielen Dank!« Erin zwinkert mir zu.
»Wieso? Hast du den angebaut?«
Sie lächelt stolz. »Vor zwei Jahren habe ich angefangen im Central Park Gemüse anzubauen. Die Samen habe ich auf meinen Streifzügen durch die Stadt gefunden. Davor gab es immer nur Wildschwein, Bohnen und Reis. Jeden Tag. Irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr sehen.«
»Was ist der Central Park?«, frage ich kauend und erinnere mich, dass bereits David davon gesprochen hat.
»Das ist ein großer Park nicht weit von hier. Du müsstest ihn von deinem Zimmer aus sehen, er liegt im Osten. In der Stadt gibt es ein paar alte Bücher, in denen er als grüne Lunge New Yorks bezeichnet wird. Der Central Park war mal ein öffentlicher Park, wo die Anwohner ihre Freizeit verbracht haben«, erzählt Erin.
»Grüne Lunge?«, wiederhole ich. »Ein schöner Ausdruck!«
Erin nickt. »Mit den Bildern in den Büchern hat er aber nicht mehr viel gemein. Er ist überwuchert. Bevor wir dort überhaupt irgendwas anbauen konnten, waren wir monatelang damit beschäftigt, Büsche und Bäume zu entfernen, damit wir eine Fläche hatten, die groß genug ist.«
Ich verschlinge mein Abendessen. Es fühlt sich gut an, den Magen wieder arbeiten zu spüren.
»Ich hätte nie gedacht, dass du auch hier landest«, bemerkt Henry, als ich an einem Stück Karotte knabbere. Ich verkneife mir ein Lächeln. Er ist ein gutmütiger Mensch, der sich nicht von Vorurteilen leiten lässt. Ich war am Boden zerstört, als er plötzlich verschwand. Die Ungewissheit, was mit ihm geschehen war, trieb mich schier in den Wahnsinn und ich konnte nicht verstehen, warum sich außer mir niemand darüber Gedanken machte.
Ich zucke mit den Schultern. »Stille Wasser sind tief.«
Erin richtet sich neugierig auf, ohne mit dem Essen aufzuhören, aber auch wenn sie offensichtlich hofft, ich würde nun etwas aus meinem Leben preisgeben, enttäusche ich sie nur zu gern. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diesen Grundsatz habe ich immer befolgt und bin damit nicht schlecht gefahren. Zuhören liegt mir viel eher. Nicht mal Henry habe ich viel anvertraut und er ist immerhin die Person, die mir am nächsten stand, obwohl ich ihn nie so weit an mich heranlassen konnte, dass aus unserer Verbindung eine tiefere Freundschaft wurde. Und trotzdem ist er mein Vertrauter.
»Ich frage mich, warum die Regierung uns die Gründe für unsere Verbannung verschweigt«, murmelt Tim.
»Weil wir dadurch eine Frage mit nach New York nehmen, auf die wir nie eine Antwort erhalten werden. Auch wenn sie uns hier drin unserem Schicksal überlassen, haben sie so immer noch Macht über uns. Eine Art Persönlichkeitsfolter.« Als Erin spricht, weicht ihre positive Ausstrahlung einem angespannten Gesichtsausdruck. Mit einem Mal wirkt sie unglücklich. Tatsächlich habe ich mich auch schon gefragt, warum Concordia so ein Geheimnis aus den Straftaten der Verbannten macht. Erins Erklärung dazu klingt absolut plausibel, aber es macht das Wesen der Regierung wiederum noch schlimmer. Henry steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, denn er kann sich als einer der wenigen sicher sein, den Grund für seine Verbannung zu kennen.
»Wo bist du aufgewachsen, Tim?«, wechsele ich schnell das Thema, weil ich Erin aus düsteren Gedanken zurückholen will.
»Ganz im Süden«, antwortet er mit einer tiefen angenehmen Stimme. »Meine Eltern sind sehr arm und haben den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet, bis ihre Körper kaputt waren. Ich habe viel gestohlen, vor allem Geld und Medikamente, deshalb tippe ich bei meiner Straftat auf Diebstahl.« Er kneift die Lippen zusammen. »Ich hätte nie aufgehört ihnen zu helfen.« Ich fühle mit ihm, ein Kloß taucht in meinem Hals auf und setzt sich fest.
»Hast du Geschwister?«, frage ich vorsichtig.
»Zwei kleine Brüder.« Tim lächelt bitter, wissend, woran ich denke. »Sie werden mit Sicherheit auch hier landen und dann sind meine Eltern allein.«
Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich froh, dass ich niemanden habe. Es gibt niemanden, um den ich mir Sorgen machen muss. Es gibt niemanden, der mich vermisst. Es gibt niemanden, dem ich mit meiner Verurteilung Kummer bereite. Ich bin nur für mich allein verantwortlich. Diese Erkenntnis sorgt dafür, dass ich mich entspanne, und die Enge um meine Brust lockert sich etwas.
Wir unterhalten uns noch eine Weile, bis ich mich schließlich verabschiede. Das Betäubungsmittel in mir fordert Ruhe. Ich brauche Zeit für mich. Die Treppen und Flure sind ausgestorben, die meisten Gangmitglieder sind immer noch im Speisesaal.
»Samy!« Ich höre hinter mir Schritte und drehe mich um. Henry kommt aus dem Speisesaal und holt mich ein. »Wie gehts dir?«, fragt er, als er bei mir angekommen ist.
»Großartig«, sage ich tonlos.
Er scheint zu verstehen. »Für mich war es auch nicht leicht. Ist es immer noch nicht«, verbessert er sich. »Aber du kannst jederzeit zu mir kommen und wir können reden.«
Für sein Angebot bin ich dankbar, auch wenn ich es nicht zeigen kann. Ich nicke und wende mich zum Gehen.
»Warum hast du Erin eigentlich erzählt, wir würden uns aus der Schule kennen?«
»Ich wüsste nicht, was sie das angeht«, sage ich leise.
»Das ist schon in Ordnung, ich habe den Anführern erzählt, dass ich Regierungsgegner bin.«
»Wirklich?«
Er zuckt mit den Schultern. »Klar, ich bin stolz auf meine Vergangenheit.«
»Hm«, mache ich nur. Ich habe Henry kennengelernt, als er gerade dabei war, im Waisenhaus heimlich Flugblätter gegen die Regierung zu verteilen. Damals hat er damit gerechnet, dass ich ihn verpfeife, aber das hätte ich nie getan. Auf Hochverrat steht Erziehungsanstalt und es wurde gemunkelt, dass man dort nicht mehr rauskommt, jedenfalls nicht lebend. Niemand hat das verdient, nur weil er für seine Ideale eintritt. Wir haben uns immer wieder getroffen, unterhalten und angefreundet. Durch ihn lernte ich einen neuen Blickwinkel kennen. Erst durch unsere Treffen wurde mir bewusst, wie sehr die Persönlichkeit durch den Staat eingeschränkt wird. Wie ist eine freie Entfaltung möglich, wenn du über dein Leben nicht selbst entscheiden darfst?
Henry sieht mich nachdenklich an, dann schüttelt er den Kopf. »Eigentlich ist es auch total egal. Unsere Vergangenheit ist hier vollkommen unwichtig, also mach einen Neuanfang.«
»Hm.« Wenn es doch nur so einfach wäre. Wie soll ich mein altes Leben hinter mir lassen, das dafür verantwortlich ist, wer ich heute bin? »Gute Nacht, Henry.«
Henry wiederzusehen hat etwas in mir ausgelöst. Gefühle, die ich normalerweise unterdrücke. Die Wärme der Vertrautheit und Freundschaft. Ich bin so erleichtert, dass er lebt. Aber ich habe es nicht einmal geschafft, ihm das zu sagen.
Als ich im achten Stock ankomme, spüre ich hinter mir eine Bewegung. Einen Moment später legen sich kalte Finger auf meinen Mund. Voller Panik trete ich um mich und versuche in die fremden Finger zu beißen.
»Verdammt, lass das bleiben«, knurrt eine bekannte Stimme. »Hilf mir mal, John!« Ein Kerl taucht vor mir auf und presst mir meine Hände an den Körper. Ich bin bewegungsunfähig, werde in eine Kammer geschleppt und mit dem Rücken gegen die Wand gepresst. Endlich sehe ich meinen Angreifer. Jeffrey. Neben ihm stehen der Typ namens John und eine große junge Frau mit raspelkurzen roten Haaren.
»Was wollt ihr von mir?«, keuche ich und reibe mir die Handgelenke.
»Wir wollten dich auf unsere Weise willkommen heißen«, antwortet Jeff mit einem unheilvollen Grinsen.
»Lasst mich gehen«, fordere ich und versuche dabei genervt zu klingen, aber meine unnatürlich hohe Stimme verrät mich. Ich bekomme Panik. Jeff war das erste Mal schon so gemein, dass mich jetzt die Angst überkommt, allein weil er so dicht vor mir steht.
Die Rothaarige schnaubt. »Die wird das niemals überleben.«
»Ich weiß nicht.« Jeff mustert mich aufmerksam und ich versuche seinem Blick standzuhalten. »Sie hat sich getraut, uns beim Verhör einfach ins Gesicht zu lügen. Das ist mutig.«
»Das ist nicht mutig, sondern dumm. Ich sag dir, die sehen wir nicht wieder.«
»Das klingt nach einer Wette«, bemerkt John und sieht beide abwechselnd an. »Los, Leute! Das macht die ganze Sache wesentlich interessanter!«
Meine Beine zittern. Was wollen sie von mir?
Widerstrebend wendet Jeff seinen gierigen Blick von mir ab und sieht zu der anderen hinüber. »Was meinst du, Susan?«
Susan zuckt die Schultern. »Klar, warum nicht. Wenn du auf so ein naives kleines Mädchen wetten willst …«
»Risiko«, meint er nur. Ich will hier weg. Jeff macht mir Angst, die anderen machen mir Angst. Kurz entschlossen hechte ich zur Tür, doch Jeff reagiert schnell, packt mich und schubst mich mit Leichtigkeit zurück an die Wand. Mein Hinterkopf knallt gegen rauen Stein und Sterne flimmern vor meinen Augen. »Hiergeblieben! Wir haben eine kleine Aufgabe für dich.«
»Und warum sollte mich das interessieren?« Habe ich das gerade laut gesagt? Mein Herz pocht mir bis zum Hals. Ich sehe allen dreien an, dass auch sie von meiner Antwort überrascht sind. John reißt die Augen auf, Susan runzelt die Stirn, aber Jeff grinst.
»Gute Frage«, meint er. »Aber wir haben eine noch bessere Antwort. Wenn du deine kleine Mutprobe nicht erfüllst, werden wir dir das Leben hier derart zur Hölle machen, dass du nach einer Woche freiwillig in die Kuppel rennst.« Keine Sekunde zweifle ich an dem, was er sagt. Grausamkeit funkelt in Jeffs Augen und er suhlt sich geradezu in meiner Angst. Es scheint, als hätte ich keine andere Wahl, als mich ihrem kleinen blöden Spielchen zu beugen, und dieses Ausgeliefertsein widert mich an.
»Also gut«, zische ich. »Was muss ich machen?«
»Finde heraus, wo unsere Feinde ihre Basis haben.«
»Wisst ihr das etwa nicht?«, frage ich dümmlich.
Jeff lacht laut auf. »Doch, wir schon. Aber ich will, dass du es uns sagst.« Macht er Witze? Nach allem, was ich gehört habe, ist ein Spaziergang in die falsche Richtung sehr gefährlich. Aber offenbar geht es ihnen genau darum.
»Seht nur, sie fängt gleich an zu heulen!«, spottet Susan. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis zu weinen. Meine Augen sind nicht feucht und mein Kinn zittert auch nicht. Susan provoziert mich und schafft es, dass meine Angst von Trotz überrollt wird.
»Alles klar!«, sage ich selbstbewusst und schlage Jeffs Hand weg. Ich quetsche mich an den dreien vorbei, niemand hält mich auf und ich registriere voller Genugtuung ihre verdutzten Gesichter. Mit dieser Reaktion haben sie nicht gerechnet. Schnell verlasse ich die Kammer und eile die Treppen hinunter. Sie folgen mir nicht. Erst als ich das Gebäude verlasse und die frische laue Abendluft einatme, wird mir bewusst, in welcher Lage ich mich befinde, was ich mir gerade eingebrockt habe. Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Soll ich mich lieber an Erin oder David wenden? Aber auch Jeff ist Anführer. Wie würden die beiden reagieren, wenn ich ihn anklage? Nein. Das ist mein eigenes Problem.
Nur, wie finde ich die Basis der anderen Gang? Die Stadt ist riesig, sie könnte überall sein. Und dann fällt es mir wieder ein. David hat heute von ihnen gesprochen. »Auf der anderen Seite des Central Park«, murmele ich. Also los.
5
In unmittelbarer Nähe zu unserer Basis streifen Wachen paarweise durch die verlassenen Straßen. Beim ersten Mal kann ich ein Zusammentreffen knapp verhindern, indem ich mich gerade noch rechtzeitig in einer Ruine verstecke. Im Nachhinein ärgere ich mich über mich selbst, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass Wachen patrouillieren. Nach allem, was ich heute über das Leben hier erfahren habe, ist das nicht nur logisch, sondern auch bitter notwendig.
Nach drei Querstraßen erreiche ich den Central Park, in dem Erin das Gemüse anbaut. Im verwilderten Park erwarte ich weniger Wachen als auf den Straßen.
Es ist totenstill und ich höre nur meinen eigenen angestrengten Atem und das Knacken der Zweige unter meinen Schuhen. Hin und wieder rascheln die Blätter im Wind.
Wenn es in unserer Gang einen Wachdienst gibt, dann gibt es in der anderen Gang sicher auch einen. Wie schaffe ich es, nicht erwischt zu werden? Ich bin verloren, wenn ich entdeckt werde. Sie könnten mein Eindringen in ihren Bereich als Angriff werten und kurzen Prozess machen. Die Müdigkeit zehrt an mir. Den Gedanken, einfach aufzugeben, verwerfe ich aber nach kurzer Zeit wieder. Jeff und seine Freunde würden mir das Leben zur Hölle machen, sozusagen eine Hölle mit Ankündigung, und darauf habe ich keine Lust. Im Grunde ist es doch egal, ob ich erwischt werde oder nicht. Mein Vorsatz, ein friedliches Leben zu führen, ist seit meiner Verurteilung sowieso dahin. Also warum nicht mal ein Risiko eingehen, um zu verhindern, dass es noch schlimmer wird?
Doch einige Zeit später verebbt meine neu gewonnene Zuversicht. Es ist mittlerweile so dunkel, dass ich meine eigene Hand nur sehen kann, wenn ich sie mir direkt vor die Nase halte. Die schwarzen Bäume stellen sich mir als gruselige Gestalten in den Weg und dichte Wolken lassen das Licht des Mondes nicht hindurch. Ich habe Glück, dass es wenigstens nicht kalt ist, weil die letzte Wärme des Spätsommers noch nicht verschwunden ist. Wie soll ich in der Dunkelheit meine Aufgabe erfüllen, geschweige denn wieder zurückfinden? Als ich plötzlich etwas Nasses an meinem Schuh fühle, quieke ich erschrocken auf. Beinahe wäre ich in einen See gelaufen. Frustriert taste ich mich zu einem Baum, lehne mich dagegen und rutsche am Stamm hinab. Ich hasse Jeff, Susan und John. Nur dieses eine Mal lasse ich zu, dass sie mich erpressen, und ich nehme mir vor in Zukunft dagegenzuhalten. Wenn ich überlebe, natürlich.
Plötzlich höre ich Schritte auf einem Weg. Mir stockt der Atem. Ich versuche etwas oder besser gesagt jemanden zu erkennen, aber es ist sinnlos. Also verkrieche ich mich lautlos hinter einem Busch und warte. Mit meinen hellen Klamotten fühle ich mich in der Dunkelheit wie eine Leuchtreklame. Gute Tarnung sieht definitiv anders aus. Nach einer Weile werden die Schritte leiser und ich atme erleichtert auf.