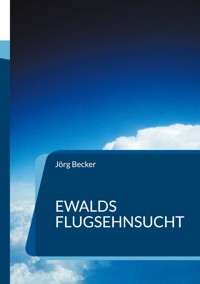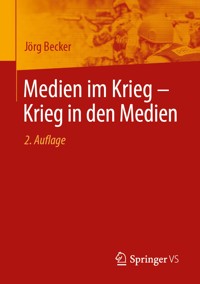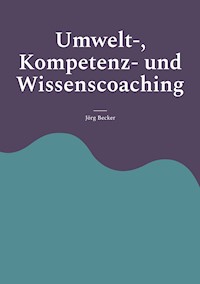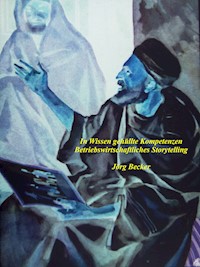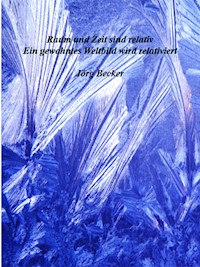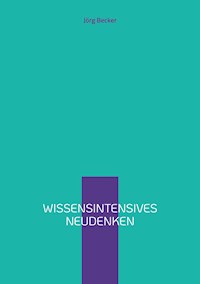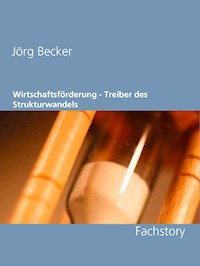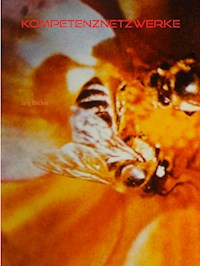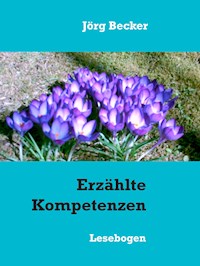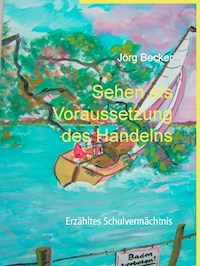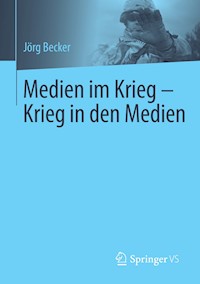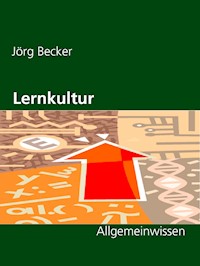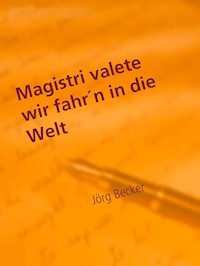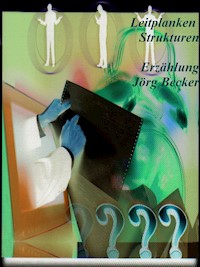
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Mit immer mehr von Big Data schwillt auch die Quantifizierung von Wahrscheinlichkeitskriterien und möglicher Berechnungen hieraus an. Sehr wahrscheinlich ist: was die Verlässlichkeit freihändiger Ahnungen und Schätzungen anbelangt, scheinen mathematische Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung eher im Vorteil und überlegen zu sein. Nüchternes Kalkül ist manchmal besser als Erfahrungswissen: umgekehrt kann auch eine kalt kalkulierte Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Irre führen, wenn hierbei zugrunde gelegte empirische Parameter falsch gesetzt wurden. Philosophisch betrachtet könnte man Wahrscheinlichkeit auch als den Grad des Glaubens an die Wahrheit definieren: es gibt auch so etwas wie ein beobachtungsabhängige subjektive Wahrscheinlichkeit. Eines jedoch ist sicher und nicht nur wahrscheinlich: es gibt immer nur ein begrenztes Wissen über die Zukunft
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leitplanken
Titel123456789101112131415ImpressumTitel
Leitplanken
Strukturen
© 2022 Jörg Becker
Alle Rechte vorbehalten
www.beckinfo.de
www.rheinmaingeschichten.de
www.derStandortbeobachter.de
Business-Netzwerke:
Linkedin (englisch)
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden.
1
Das Bild, das sich allgegenwärtige digitale Sammler von Personen machen, bleibt diesen verborgen, dürfen diese nicht sehen: innerhalb der digitalen Welten gibt es ein und dieselbe Person oft zweimal, nicht selten vielleicht sogar mehrmals.
"Im Schatten unseres rätselhaften Ichs entsteht ein berechenbarer Widerpart aus Zahlen, Entscheidungen, Bewegungen und Kontakten".
"?"
"Digitale Datensammler erheben den Anspruch, über Personen Dinge zu wissen, die diese selbst nicht wissen."
"Und auch verborgene Motive aufspüren zu können, die noch nicht einmal gedacht wurden?"
"Wer seinen digitalen Zwilling gerne einmal kennen lernen möchte: Fehlanzeige."
"?"
"Denn sein Zuhause sind undurchdringliche Server in den Weiten des Internet."
"Das heißt, Personen als eigentliche Eigentümer ihrer Daten haben nicht die geringste Vorstellung davon, wie ihre Daten verwendet werden?"
"Und auch nicht davon, welches Wesen man sich daraus zusammen gereimt hat."
"Wer nur weiß, dass sie alles von einem wissen, weiß nichts".
"Ahnungslose Datenlieferanten werden zu willenlosen Werkzeugen in der Hand riesiger Datenkonzerne."
"Der Siegeszug anonymer Algorithmen scheint unaufhaltsam."
Dabei begann einst alles meist relativ harmlos: mit der Analyse von Kommunikations- und Verhaltensmustern wurde beispielweise versucht, Kunden besser zu verstehen, um ihnen vielleicht bessere Produkte und Dienstleistungen bieten zu können. Bis man mit der Zeit merkte, dass man mit den gesammelten und abgeschöpften Daten noch vieles mehr anstellen könnte: jedes vermeintlich noch so belanglose Schnipsel gewann mit dem Vordringen ungeahnter technischer Möglichkeiten weiter an Aussagekraft. Daten verrieten nicht nur Vergangenes und vielleicht noch Gegenwärtiges, sondern richteten ihren Blick bereits auf Zukünftiges: das Koordinatensystem der Fragestellungen verschob sich, nicht zuletzt auch auf Privates hin. So mancher stellt sich daher die Frage, ob Algorithmen bereits so mächtig geworden sein können, dass sie Denken zu beeinflussen oder gar zu lenken vermögen. Als sicher mag erscheinen, dass sie weit mehr sind als nur harmlose, den Alltag erleichternde Helfer.
Als scheinbar allwissend verehrt können von Algorithmen in der Black Box zusammen gereimte Ergebnisse erhebliche Konsequenzen im alltäglichen Leben haben, beispielsweise: wenn Unbescholtene plötzlich auf No-Fly-Listen landen, wenn Gutverdiener plötzlich keinen Kredit erhalten und vieles andere mehr. Je länger der Datenzwilling in der Black Box von Algorithmen gefüttert wird, desto stärker und unfreier wird er in dieses Datengerüst eingebunden: über viele Lebensphasen hinweg könnte sich jener angeblich so genau berechenbare Wider part des eigenen Ich zu einem regelrechten Datenmonster auswachsen.
"Das Gefährliche am algorithmischen Weltbild ist nicht, dass seine Apologeten so viel über uns wissen."
"?"
"Sondern dass ihnen das, was sie von uns wissen, völlig ausreicht-"
"?"
"Um die Regeln für die digitale Welt daraus abzuleiten."
Der Kosten- und Wettbewerbsdruck im Rahmen der Globalisierung, das Einhalten gesetzlicher Vorschriften, die Volatilität des Marktes u.a. stellen einen Startup vor anspruchsvolle Aufgaben. Will er in diesem Umfeld bestehen, braucht er manchmal auch ein schnell anpassungsfähiges Geschäftsmodell. Der Startup ist regelmäßig gezwungen, taktische und strategische Entscheidungen zu treffen. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen sollten sich weniger auf Intuition oder Halbwissen stützen. Stattdessen besser auf möglichst vollständige Informationen (Business Intelligence bedeutet Analyse von Geschäftsdaten).
Beispielweise: Der Startup möchte herausfinden, wie rentabel ein bestimmter Kunde ist. Oder: Der Startup muss entscheiden, welche Menge eines Artikels er wann bestellt. Oder: Der Startup will wissen, wie viel er von welchem Produkt verkaufen kann. Oder: Der Startup muss die Merkmale eines neuen Produktes bzw. den Umfang einer Leistung festlegen. Dazu müssen im Vorfeld quantitative Daten und Informationen analysiert werden, beispielsweise: Wie viel Umsatz haben wir erzielt? In welchem Zeitraum haben wird diesen Umsatz erzielt? Wo haben wird den Umsatz erzielt? Wie wird sich der Umsatz in Zukunft entwickeln?
Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen kann unter Zuhilfenahme analytischer Systeme wie interaktivem Reporting, Ad-hoc-Analysen, Data-Mining, Simulation oder Prognostik erfolgen. Solche Systeme firmieren unter dem Sammelbegriff Business Intelligence (das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile) und können Daten auf die unterschiedlichste Weise analytisch aufbereiten. Ein großes (oft ungelöstes) Problem hierbei bleicht immer die "Warum"-Frage.
"Während Hilfestellungen bei der Beantwortung von Fragen zu Quantitäten auf Fragen eigentlich selbstverständlich sein sollten."
"Fehlen dem Entscheider aber häufig Antworten auf Fragen nach den Ursachen und Gründen."
"?"
"Denn ein Großteil von geschäftsrelevanten Sachverhalten beruht auf unstrukturierten Daten."
"?"
"In E-Mails, Textdokumenten, Präsentationen. schlummern so manche Informationen."
"Die für die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen meist noch stärker ausgeschöpft werden können?"
"Ja, Ziel ist doch letztendlich die auf zusammengehörenden qualitativen und quantitativen Informationen basierende optimierte Entscheidungsfindung."
Hier können auch Wissensmanagement-Prozesse ansetzen, die nicht nur die systematische Erfassung, die Ablage oder die Organisation von Wissen in den Mittelpunkt stellen, sondern die Wissensträger selbst. Dabei geht es auch um unternehmensübergreifende Kollaboration: ausgehend von klassisch vertraglich abgegrenzten Beziehungen geht die Entwicklung über Added-Value-Beziehungen mit einer engen Bindung des Lieferanten an den Kunden hin zu Joint-Value-Beziehungen (gleichwertige Partnerschaften mit einem gemeinsamen Wertbeitrag). Mit Unterstützung von Location Intelligence-Instrumenten können entscheidungsorientiert aufbereitete Geschäfts- und Marktdaten zusätzlich mit Geo-Informationen, d.h. auch einer räumlichen Dimension verbunden werden. Raumbezogene Karten geben Orientierung und helfen, Fakten, Trends und Strukturen auszumachen, die ansonsten schwerer zu erkennen wären oder leicht übersehen werden. Beispielsweise fließen bei komplexen Standort-Entscheidungen im Einzelhandel viele Faktoren wie die Kaufkraft der Einwohner, die bereits vorhandenen Standorte der Wettbewerber oder die Entfernung der Wohngebiete ein (Entscheidungsunterstützung durch Anschaulichkeit).
Breite Kommunikationsplattform
Eine Personalbilanz kann als breite Kommunikationsplattform für Personal-Entwicklungsmaßnahmen eingesetzt werden. Eine Personalbilanz unterstützt die Früherkennung künftiger Chancen und Risiken. Eine Personalbilanz funktioniert als 360-Grad-Radarschirm für verschiedene Beobachtungszwecke und -ebenen, mit dem insbesondere auch "weiche" Personalfaktoren umfassend identifiziert, differenziert abgebildet sowie systematisch bewertet werden können.
Aus den Ergebnissen der Personalbilanz (beispielsweise einem Potenzial-Portfolio) können für Kreditgespräche fundierte, abstimmfähige Maßnahmen- und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Da eine reine Status-quo-Betrachtung auf Dauer nicht ausreicht, kann diese hinsichtlich künftiger Perspektiven erweitert werden. Viele Darstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Ampel-Diagramme mit rot-gelb-grün-Bereichen für die Bewertung von Personalfaktoren, sind einfach verstehbar und können dadurch die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Entscheidungen erhöhen. Die Personalbilanz ist auf einer auch in der Wirtschaft gängigen Systematik aufgebaut und kommt daher der Controlling-Denkweise entgegen. Nichts ist so überzeugend wie eine Anschaulichkeit, wie sie in Form von Portfolio-, Ampeldiagramm- und Wirkungsnetz-Darstellungen geboten wird.
"Eine Personenbilanz bündelt Potentiale."
"Mit einem gesicherten Gewinn?"
"Ja, durch Zuwachs an Erkenntniswissen."
"?"
"Eine der Hauptursachen, warum der Rohstoff "Wissen" trotz permanenter Bonitätsprüfungen bislang so wenig sicht- und greifbar gemacht wurde, liegt in der komplizierteren Bewertung und Messung immaterieller sogenannter "weicher" Faktoren begründet."
"Und?"
"Und trotz zahlreicher Einzelaktivitäten im Zusammenhang mit dem Zukunftsrohstoff "Wissen" gibt es oft noch Lücken."
"?"
"Die eine bestmögliche Ausschöpfung der in ihm steckenden Entwicklungspotentiale behindern."
"?"
"Insbesondere fehlt vielfach noch ein in sich schlüssiges Konzept bzw. Instrument, mit dem sich alle Einzelkomponenten des Intellektuellen Kapitals vollständig und mit einheitlicher Systematik abbilden lassen."
2
Mit Hilfe einer Personalbilanz kann nicht nur das "Was-ist", sondern auch das "Was-sein-könnte" (Potenziale, Perspektiven) verdeutlicht werden. Bei zahlreichen Bonitätsprüfungen spielen "weiche", oft als nicht bewertbar beurteilte Personalfaktoren eine immer wichtigere Rolle. Über die Personalbilanz können diese "Intangibles" einer transparent nachvollziehbaren und einheitlich durchgängigen Bewertungssystematik zugeführt werden. Eine Personalbilanz kann aber immer nur so gut sein wie die in sie eingespeisten Strukturen, Bewertungen und Beschreibungen.
"Eines ist bereits im Vorfeld gesichert."
"?"
"Die für die Erstellung einer Personalbilanz entwickelte Vorgehenssystematik erzwingt eine intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit allem, was mit Bonitätsprüfungen zusammenhängt."
"Das heißt, allein dadurch fällt ein gesicherter Gewinn an entsprechendem Erkenntniswissen an."
Das Konzept einer Personalbilanz ist auf dem Weg zu einer zahlenmäßigen Erfassung inzwischen ein gutes Stück des Weges vorangekommen und hat hierfür auch praxistaugliche Instrumente und Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen es nicht nur, sich in einem hochkomplexen Wissensumfeld Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, sie machen durch ihre gängige Zahlenwelt auch eine Nachvollziehbarkeit für außenstehende Dritte möglich. Gegenüber der üblichen Bilanzierung materieller Wirtschaftsgüter hätte das Instrumentarium der Personalbilanz bereits einen entscheidenden Vorteil: es werden auch die zwischen einzelnen Faktoren bestehenden Beziehungen hinsichtlich ihrer Wirkungsstärke und Wirkungsdauer sichtbar gemacht. Aus diesem ohne entsprechende Instrumente kaum durchschaubaren Beziehungsgeflecht lassen sich diejenigen Maßnahmen herausfiltern, die aufgrund ihrer hohen Hebelwirkung das größte Potential erwarten lassen.
Die meisten Startups wissen, was zu tun ist, und sogar, wie man es besser machen müsste. Ein Fehler allerdings wäre: es dann doch nicht tun (vielleicht aufgrund vorgeblich dringender Tagesprobleme). Oberstes Ziel sollte immer sein, Wert zu schöpfen, d.h. den Schwerpunkt nur auf den Profit zu legen dürfte ebenso in die Irre führen wie die (besessene) Orientierung an einem Steuerjahr. Finanzielle Ergebnisse hängen zudem von einer Vielzahl nichtfinanzieller Einflussfaktoren ab.
"Rückblicke können den Weitblick fördern."
"Stimmt, sie sind auch als Übung manchmal unverzichtbar."
"?"
"Um auch die Vergangenheit als Leitlinie für die Gegenwart und Zukunft zu nutzen."
Ein Startup sollte (nicht nur aus eigenem Blickwinkel heraus, sondern auch aus Sicht von Kunden, Lieferanten, Partnern) sich darüber im Klaren sein, wie er im Hinblick auf Technologie, Produktivität und Kundenzufriedenheit dasteht. Der Wunsch nach Veränderung trifft oft auf das Verlangen nach Stabilität – was wiederum ein widersprüchliches Hin- und Herpendeln bewirken könnte. Dabei kann der Prozess der Entscheidungsfindung mehrere Stufen durchlaufen: Herausforderung, Reaktion, Wertschöpfung und Messung des Fortschritts, effektives Change Management, Handlungsempfehlungen und Aktionen.
"Erfolge können sich vor allem dann einstellen, wenn der Startup dazu bereit ist, sich unmittelbar und kritisch mit strategischen Fragen auseinanderzusetzen."
"Ja, Startups müssen Regelmäßigkeit mit Improvisation, Ordnung mit Elementen der Spontaneität und manchmal auch Unordnung verbinden können."
"Einstellungen und Denkweisen bestimmen das, was getan wird."
"In unkonventionellen Zeiten hat aber konventionelles Denken geringere Chancen."
"Das heißt?"
"Man muss auch einmal wagen, anders zu sein."
"Dafür braucht es aber eine unverbrauchte, ganzheitliche Sicht: die Fähigkeit den Wald und die Bäume zu sehen."
"Gerade ein Startup sollte ein Gespür für Trends haben."
"Vor allem wenn Veränderungen oder gar Umwälzungen das eigene Geschäftsmodell und die gesamte Strategie bedrohen."
Möglicherweise halten zu konservative und regelgebundene Systeme einem stärker werdenden Krisendruck nicht stand. R. Heller nennt zur Bewältigung von Wandel und Herausforderungen u.a. folgende Grundprinzipien:
den Leistungsgrad im nichtfinanziellen Bereich ständig verbessern,
alle Prozesse analysieren und vereinfachen,
viele Projekte, die schnelle Lösungen und Ergebnisse erwarten lassen, gleichzeitig in Angriff nehmen,
Verbesserungsprojekte auf Bereiche konzentrieren, in denen sie den größten Gewinn erwarten lassen,
die Ziele hoch stecken, die Erwartungen im vernünftigen Rahmen halten.
Existenzgründer stehen vor der bis dahin vielleicht größten Herausforderung ihres Lebens. Sie müssen daher in der Lage sein, auch einmal schwierige Situationen zu überstehen, sich immer wieder selbst zu motivieren und lernen, auch mit Niederlagen umzugehen. Königsweg der Frühwarnung: Für die Früherkennung erlangen sogenannte "weiche Faktoren" -beispielsweise Auftragseingang der Branche, Inflationsrate, Kundenzufriedenheits-Index, Cash Flow, innerbetriebliche Krankheits- und Fluktuationsquote- eine zunehmende Bedeutung.
"Bilanz und BWA liefern ja nur vergangenheitsbezogene Daten."
"Daraus nicht ableiten lassen sich Trends und Innovationen, die wichtige Signale einer aufziehenden Krise sein können."
"Das heißt?"
"Die immer mehr zunehmende Dynamik der Märkte verstärkt gleichzeitig den Druck auf eine perspektivisch ausgerichtete Planungsbasis."
Es geht darum sich schneller als die Konkurrenz auf das zukünftige Umfeld einstellen zu können, d.h. in Zeiten des schnellen Wandels werden Früherkennung und Frühwarnung immer mehr zum Königsweg. Gefahren und Risiken werden hierbei aufgespürt, bevor sie für das Unternehmen bedrohliche Folgen zeigen, Gelegenheiten und Potentiale können erfasst werden, bevor sie verlorengehen. Insolvenzgefahren und Liquiditätskrisen proaktiv entgegen steuern: wer Risiken und strategische Fehler bereits im Vorfeld erkennt, kann Krisen bereits im Vorfeld meistern.
"Frühwarnsignale aus dem Markt sind beispielsweise Zersplitterung des Marktes, Abnahme des Marktes aufgrund Substitutionstendenzen oder eine Vergrößerung des Marktes aufgrund neuer Abnehmer"
"Grundsätzlich ja auch die Globalisierung, stagnierende oder schrumpfende Mengennachfrage,"
"Oder auch abnehmende Preiselastizität, zunehmender Importdruck, verschlechterte Exportmöglichkeiten, absinkende Eintrittsbarrieren für Newcomer, steigende Marktaustrittsbarrieren aufgrund zunehmender Kapitalintensität."
Obwohl man die Geschäftsidee durchaus immer auch von kritischen Meinungen überprüfen lassen sollte, sollte man sich dabei den Erfolgsglauben nicht nehmen lassen. Gefragt sind deshalb auch Beharrlichkeit und Stehvermögen. Die zunächst alles andere in den Hintergrund drängende Frage des Existenzgründers lautet: wo komme ich her, wie schnell will ich wann wohin und wie fit bin ich? Entscheidende Fragen, die der Existenzgründer bereits vor oder zumindest während der Startphase beantwortet haben sollte.
"Dabei wird Schreiben von Hand wird zum Abbild des Denkens im Kopf."
"?"
"Wenn der Stift eine Verlängerung der Hand sein soll, so droht ihm vielleicht die Amputation."
"In der Geschäftswelt verzichtet man ohnehin auf diesen verlängerten Körperteil und tippt alles auf den Tastaturen."
Stellt sich also die Frage, ob Tippunterricht nicht besser als Schreibunterricht wäre, man also Kinder besser am IPad unterrichten sollte anstatt sie mit anstrengendem Handschreiben nur unnötig zu belasten. Schulversager würden dadurch weniger, d.h. Tippen am Computer sei sogar demokratisierend.
"Ganz so klar scheint die Sachlage vor dem Hintergrund widerstreitender Ansichten aber nicht zu sein."
"?"
"Um das Handschreiben ersatzlos zu streichen."
"?"
"Weil der Schreibende gezwungen wird, die seinen Gedanken entspringenden Wörter zu formen."
"Das heißt, die Linie des Stiftes entspricht so gewissermaßen der Linie des Denkens?"
"So ist es, sorgfältiges Schreiben von Hand wird zum Abbild des sorgfältigen Denkens im Kopf."
" Der Schwung des Schreibens fahre also Gedanken nach und pinsele nicht nur Buchstabe für Buchstabe dahin?"
"Genau, gerade weil das Handschreiben anstrengender ist, werden Sätze vielleicht klarer und geordneter."
"In der Konsequenz hieße dies: mit dem Ende des Schreibens von Hand werden nicht nur Stifte sondern auch Gedanken amputiert."
Mit der Hand Geschriebenes zwingt zum klareren Denken. Schüler lernen mit Unvollkommenheiten zu leben und erhalten die Chance, trotz mancher Anstrengungen an diesen zu wachsen und Lernerfolge zu genießen. Die Tastatur dagegen vermittelt lediglich die Illusion einer Welt ohne Fehler und Anstrengungen (alles kann gelöscht, umgestellt und beliebig verändert werden). Es geht um das, was hinter der Fassade ist: "um die lineare Ordnung des Gedankens, die sich zuerst im Kopf, sodann im Fluss der Handschrift verwirklicht".