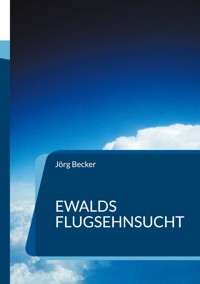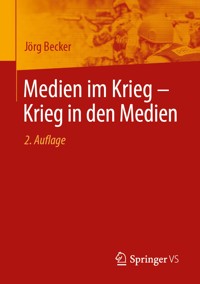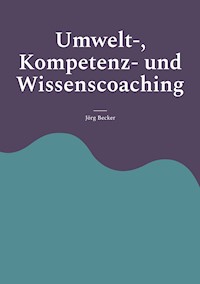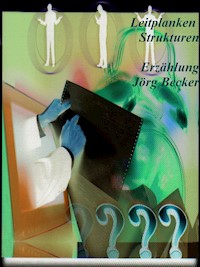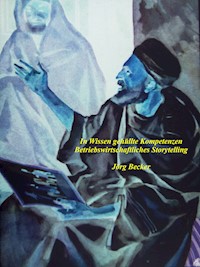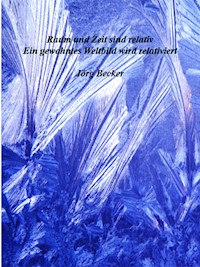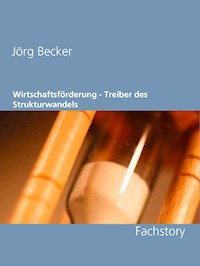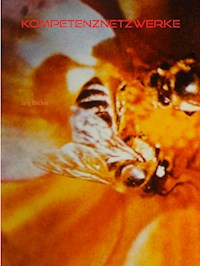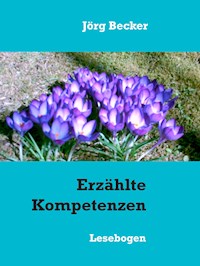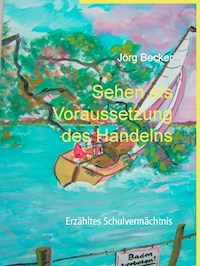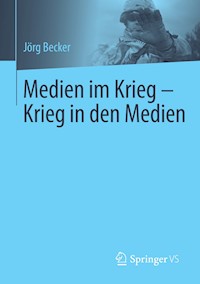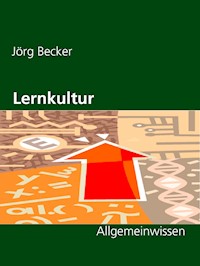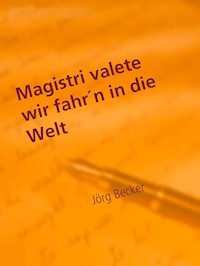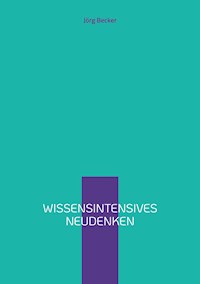
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist die Menge vorhandener Informationen zu umfangreich, geht es darum, diese Vielfalt zu reduzieren und handhabbar zu machen. Man muss Schwerpunkte setzen und abstrahieren, d.h. zwischen wichtigen und weniger wichtigen Aspekten unterscheiden. Der notwendige Schwerpunktwechsel verlangt, sich inmitten einer unüberschaubaren Situation erneut mit Grundsatzfragen zu beschäftigen, also eine Vielzahl von Einzel-Tatbeständen als Ganzes zu betrachten. Diese Form der Gestaltbildung erleichtert die Möglichkeit, Vergleichbares zwischen äußerlich unterschiedlichen, jedoch strukturähnlichen Situationen zu erkennen und zu nutzen. Bei der Reduktion eines Überangebots an Informationen sollte ebenfalls darüber Klarheit geschaffen werden, welche Einflüsse Ursachencharakter haben und welche den Auswirkungen zuzuordnen wären. Für Akteure folgt daraus die Aufforderung, bei Entscheidungen immer ein breites Umfeld im Auge zu behalten. Eigendynamische Systeme erfordern aufgrund ihrer ständigen Bewegung eine Analyse der Trends, um vor diesem Hintergrund gegebenenfalls Entwicklungen extrapolieren zu können. Wenn die Daten ein strenges Verfahren nicht zulassen, müssen Entwicklungen in einer unschärferen Form hochgerechnet werden, damit Handlungen nicht hinter dem Geschehensablauf zurückbleiben: Wer einen Film beurteilen will, darf sich nicht auf Standfotos beschränken. Er muss auch die laufenden Bilder betrachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
1
Wie müssen Gesellschaften beschaffen sein, die gut auf Pandemien eingestellt sind? Wäre eine solche Gesellschaft vielleicht ein genaues Gegenbild von der unsrigen? Eine Gesellschaft nämlich ohne Verdichtung von Individuen im Raum, also ohne Städte? Eine Gesellschaft ohne viel Mobilität, Tourismus und Dienstreisen? Ohne viel Freizeit für Partys oder ähnliche Geselligkeitsformen? Ohne Netzwerke, die weit über lokale oder beruflichen Bekanntschaften hinausreichen? Denn was bisher als globale Verflechtung gelobt wurde, zeigt sich im Rahmen der Pandemie als offene Flanke, als ein Problem ihrer Bekämpfung. Variierende Bereitschaften zur Konformität und Nonkonformität zeigen, dass zugemutete Regeln perspektivisch gebrochen wurden. Durch der Einsichtsfähigkeit vorgelagerte Motive. und entgegen der allgemeinen Vernunft. Der Grad der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist entscheidend für die Reaktion auf pandemiebezogene Regelsetzungen, filtert Konformität, beeinflusst die Akzeptanz der Regelbegründung einschließlich der Resonanz auf Sanktionen von Ermahnungen bis Bußgelder. Maske, Abstand, Handhygiene und Raumlüftung haben als Zeremonien der Vorsicht große Bedeutung für den symbolischen Raum zwischenmenschlicher Beziehungen.
„Die Maske stellt Weichen für die Selbstdefinition der Menschen sowie ihre Zukunftserwartungen.“
„Sie wird zum magischen Mittel der Situationsbewältigung und überbrückt die Zeit bangen Hoffens auf ein baldiges Ende der Pandemie.“
„Der Preis für die Pandemiebekämpfung ist die gravierende Schrumpfung trivialer Alltagskommunikation.“
„Von der Chorprobe bis zu Klassentreffen.“
„Neben den Zufallsgemeinschaften eines Konzert-, Theater oder Sportpublikums ist das soziale Leben aller davon betroffen.“
„Das maskierte Gesicht beraubt das reiche Kommunikationspotenzial von Face-to-face-Kontakten der Spontaneität.“
„Und verstärkt den Stress, der Begegnungen im öffentlichen Raum im Umfeld der Pandemie belastet.“
„Uneinigkeit herrscht insbesondere bei der Frage, was die maßgeblichen Kenngrößen zur Beurteilung der Folgen der Pandemie sind.“
„Das heißt, werden die durch den Kampf gegen die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schäden entscheidend die Zukunft bestimmen?“
Nach Schätzungen von Ökonomen könnten im kommenden Jahrzehnt die Folgen zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von insgesamt über sieben Billionen (!) Dollar führen. Dazu würden Kosten kommen, die durch Infizierte verursacht werden, die an Langzeitfolgen von Covid-19 leiden. Wenn ein Menschenleben mit dem gängigen, aber konservativen Wert von sieben Millionen Dollar veranschlagt werde und mit insgesamt rund 625000 amerikanischen Opfern bis zum Ende der Pandemie zu rechnen sei, entspräche dies weiteren über vier Billionen Dollar. Ein weiterer wichtiger Posten seien die Kosten psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Investitionen in Testkapazitäten und Kontaktverfolgung würden sich vor dem Hintergrund der gesundheitlich verursachten Kosten ökonomisch rund dreißigfach rentieren.
„Unterschiede zwischen Ländern hinsichtlich der Pandemieschäden sind vor allem auf drei Gruppen von Faktoren zurückzuführen.“
„?“
„Erstens charakteristische Eigenschaften der Länder und ihrer Bevölkerung.“
„Wie deren Demographie, die Verbreitung von Vorerkrankungen oder die bestehende Infrastruktur?“
„Genau.“
„Und zweitens?“
„Die jeweilige politische und öffentliche Reaktion auf die Pandemie und deren zeitlicher Ablauf.“
„Und weiter?“
„Drittens der Grad der Vorbereitung auf eine solche Situation und die Robustheit des Gesundheitssystems.“
„Das Virus und die mit ihm verbundenen Einschränkungen haben die Kapitalmärkte mit der ersten Welle der Pandemie ziemlich klar in Gewinner und Verlierer aufgeteilt.“
„?“
„Verlierer sind zunächst vor allem die Luftfahrt und der Tourismus.“
„Und Gewinner?“
„ Auf der Gewinnerseite steht fast alles, was mit Digitalisierung, Homeoffice und insgesamt Zu-Haus-Bleiben zu tun hat.“
Veränderungsprozesse und Change Management als immerwährende Aufgabe: Technologischer Wandel (Digitalisierung, Internet der Dinge, Industrie 4.0, Vernetzung der Produktion, Online-Handel, Big Data, all das stellt auch die hierauf notwendigen Transformationen vor große Herausforderungen. Sowohl Industrie und Handel als auch Dienstleistungsbranchen werden hiervon erfasst, die Digitalisierung verändert die Grundpfeiler von Wirtschaft und Gesellschaft.
„Die Veränderungsprozesse der Digitalisierung lassen sich nicht als abgeschlossenes Projekt handhaben.“
„Genau, sondern diese müssen als immerwährende Aufgabe gesehen werden.“
„Gerade im Unternehmensbereich gibt es viele Gründe für Veränderungen.“
„Zum Beispiel?“
„Beispielsweise sinkendes Wachstum in bekannten Märkten, verändertes Marktumfeld, regulatorische Veränderungen, technische Herausforderungen.“
„Das heißt, ein Transformationsmanager muss immer wachsam und sensibel für sein Umfeld sein.“
„Und muss den richtigen Zeitpunkt zum Handeln bestimmen können.“
„Und auch die Transformation vom analogen zum digitalen bewältigen können?“
„Unbedingt, wo und wie auch immer.“
Zeiten der Transformationen sind Zeiten des (kontrollierten) Übergangs, die an alle im Wirtschaftsleben stehenden Menschen besondere Anforderungen stellen und viel (zusätzliche) Aus- und Weiterbildung verlangen. Von Nachteil wäre ein exzessiver Wandel, in dem sich Prozesse unkontrolliert überlagern: ein Transformationsmanager sollte (muss) genau wissen (erkennen), wie viel Wandel zumutbar und beherrschbar ist. Eine der Kernfragen: soll man sich durch Abschneiden von Randbereichen auf Kerngeschäfte konzentrieren? Oder soll man sich möglichst breit aufstellen? Soll man Transformation in einem radikalen Schnitt vollziehen? Oder soll man besser Schritt für Schritt vorgehen? Soll man Innovation eher intern, mit Kooperationspartnern oder ganz extern vorantreiben? Es gibt wohl keinen Königsweg für die beste und sicherste Transformation: immer aber zählen Kompetenzen und Erfahrungen zu den Schlüsselfaktoren. Transformationen sind häufig auch mit Durststrecken verbunden: es kommt darauf an, diese personell, motivatorisch und finanziell durchzustehen.
2
„Strategischer Planung muss in einer Wertposition festlegen, wie man langfristig Werte schaffen will.“
„Um die Ressource „Wissen“ bewerten und rentabilitätssteigernd ausschöpfen zu können, muss zuvor das relevante Wissen lokalisiert werden.“.
Ziel ganzheitlichen Denkens und Handelns muss sein, die Wertschöpfungskette so zu gestalten, dass keine Werte vernichtet werden und es gelingt, in mehreren Dimensionen erfolgreich zu sein. Aktivitäten müssen sich gegenseitig unterstützen und spezifische Wertpositionen auch langfristige gesichert werden können. Auch alternative Wertpositionen müssen anhand verschiedener Szenarien analysiert werden können und die Wirkungszusammenhängen zwischen verschiedenen Kapitalien (Humankapital, Strukturkapital, Intellektuelles Kapital, Beziehungskapital, Finanzkapital) identifiziert und bewertet werden „Wichtig ist, dass die Wirkungszusammenhänge zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Steuerungsgrößen identifiziert und bewertet werden.“
„Das heißt, im konkreten Einzelfall müssen unterschiedliche Kennzahlen entwickelt werden.
„Mit denen nicht nur kurzfristige sondern auch langfristige, nachhaltige Perspektiven erfasst werden können.“
D.h. innerhalb eines ganzheitlichen, strategiebezogenen Modells werden betriebswirtschaftliche und nichtfinanzielle Konzepte miteinander gekoppelt. Dabei kann in einer Wissensbilanz auch das nicht direkt greifbare Vermögen dargestellt.werden. Obwohl dieses intellektuelle Kapital nicht direkt greifbar ist, ist es für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg von entscheidender Bedeutung, d.h. die systematische Steuerung solcher "weichen" Erfolgsfaktoren rückt immer stärker in den Vordergrund.
„Ein weiteres Problem besteht darin, auch solche Faktoren wie Innovations- und Wissenspotentiale mit nachvollziehbaren Fakten und Indikatoren zu unterlegen.“
„Dabei haben nicht nur Unternehmen selbst, sondern immer mehr auch externe Gruppen (z.B. potenzielle Kreditgeber, Partner u.a.) ein Interesse an größtmöglicher Transparenz aller Strukturen und Kompetenzen, welche die zukünftige Wertschöpfung nachhaltig beeinflussen könnten.“
Das Erste ist nicht immer gleich schon das Beste
Wer das Glück einer guten Genetik hat, eine gute Schule besuchen konnte und ein motivierendes Umfeld hatte, befand sich hinsichtlich seiner Aussichten bereits im Vorfeld auf Erfolgskurs. Wer sich dann noch mit Willenskraft vor allem auf längerfristige Ziele konzentrierte hatte beste Chancen.
„Vor allem pessimistische Personen neigen dazu, gleich die erst beste Gelegenheit zu ergreifen.“
„Anstatt sich für hochgesteckte, aber erst später erreichbare Ziele zu entscheiden?“
„Ja, denn konzentrierte Arbeit mit Durchhaltevermögen mögen manchmal etwas länger dauern, führen später aber umso wahrscheinlicher zum Erfolg.“
„Das heißt?“
„Geduld kann für die Planung oft der entscheidende Erfolgsfaktor sein.“
„?“
„Die Fähigkeit, sich nicht sofort für das Erstbeste zu entscheiden, sondern sich, auch mit Hilfe der Phantasie, konsequent auf die Zukunft zu konzentrieren, wird am Ende oft belohnt.“
„Gibt´s dafür auch Belege?“
„Sicher, geduldige Menschen machen weniger Schulden, planen realistischer, erliegen nicht den ersten, falschen Impulsen, sind zukunftsorientiert und insgesamt zufriedener.“
„Das fängt dann sicher bei der Berufsausbildung an und hört erst bei der Rente auf.“
„Ja, wenn man es so sehen will. Wichtige Entscheidungen sollte man jedenfalls nicht in Stress- und Ausnahmesituationen treffen müssen, sondern in ruhiger Umgebung nüchtern abwägen können.“
„Warum ist das so?“
„Stress aktiviert das „heiße System“ des Ich, das auf Gefahrensituationen spezialisiert und programmiert ist.“
„Und deshalb nur an das Hier und Jetzt denkt?“
„Ja, deshalb ist ja auch für Alltagssituationen ein mehr zukunftsorientierter Brückenschlag „von jetzt auf morgen“ besser geeignet.“
Die beste Strategie, um erfolgreich zu planen, dürfte immer noch ruhiges Abwägen aller Optionen und Potenziale sein. Langfristige betrachtet ist immer noch ein Leben zwischen Autonomie und Selbstkontrolle die beste Vorbereitung auf unausweichliche Transformationen. Mehr Kompetenzen können reifen, wenn man Geduld aufbringen und auch einmal Stolpersteine aus einem vielleicht steinigen Weg räumen musste.
3
Die ursprüngliche Erwartung, dass nach Corona alles wieder so werde wie früher, wird sich so wohl nicht erfüllen und weicht allmählich der Gewissheit eines grundsätzlicheren Wandels. Wobei dieser (trotz aller Umstellungsprobleme) aber nicht nur negativ sein muss. Die Menschen erleben so etwas wie eine Sprung-Digitalisierung. Das heißt, immer mehr Prozesse, ob bargeldloses Zahlen, Bankgeschäfte im Internet, Online-Handel und, und….., werden digitalisiert. Eine robotisierte Fabrik mit weniger Menschen ist zudem auch weniger anfällig für das Virus.
Zwar dacht man bisher, allmähliche Rationalisierungseffekte würden durch demographischen Wandel und neue Geschäftsfelder kompensiert. Aber das Coronavirus dürfte diese Entwicklung noch einmal deutlich beschleunigen. Schon allein aus Hygienegründen sind Firmen gezwungen, künftig mehr Roboter einzusetzen. Auch Verbraucher werden, um Distanz zu wahren, mehr und mehr digitale Dienstleistungen bevorzugen. Wobei sich dieser Prozess aber nicht auf allen Berufsfeldern gleichmäßig beschleunigen dürfte. Die Covid-19-Wirkung unterscheidet sich von herkömmlichen Konjunkturkrisen dadurch, dass neben dem verarbeitenden Gewerbe auch viele Dienstleistungen überdurchschnittlich betroffen sind. Im Rahmen eines disruptiven Reskilling geht es um das Vermitteln neuer Fertigkeiten und digitaler Kompetenzen, um digitales Lernen ebenso wie um kollaboratives Arbeiten.
Erforderlich ist hierfür auch ein Grundverständnis darüber, was Daten eigentlich sind und welche Voraussetzungen man braucht, dass mit ihrer Hilfe bessere Entscheidungen gefällt werden können.
„Der Glaube daran, dass Computer demnächst ein Bewusstsein entwickeln werden und Menschen dann sagen, wo´s langgeht, ist noch fern.“
„Zumindest außerhalb des Silicon Valley.“
„Wenn den Menschen im Wesentlich ausmacht, was in seinem Gehirn vorgeht, ließe sich daraus vielleicht folgern: Wenn es nur gelingt, genauso viel Daten zusammenzubringen wie das menschliche Gehirn, schätzungsweise 10 hoch 16 Operationen pro Sekunde, könne man Bewusstsein auch künstlich erzeugen.“
„Doch damit Daten zu Informationen werden, brauchen sie hierfür auch einen Empfänger.“
„Und zwar einen, der sie versteht!“
„Genau, eine von einem möglichen Adressaten losgelöste Information ist ja bereits ein Widerspruch in sich.“
„Erleben ist damit weit mehr als nur eine Datensammlung im Gehirn.“
„Sondern?“
„Die Simulation von Funktionen des Lebens ist noch lange nicht dasselbe wie das Leben selbst.“
„Gut, natürliche Intelligenz ist ja wirklich mehr als nur eine Sammlung von Algorithmen.“
„Das heißt, menschlichen Geist kann man nicht einfach auf eine Festplatte laden.“
„Nee, manche scheinen dies zwar vielleicht behaupten zu wollen, um ihre Verantwortung einfach auf Apparate abwälzen zu können.“
Wissens-, Personal- und Standortbilanzen können für viele komplexe Probleme als Entscheidungsgrundlage dienen. Auf den ersten Blick mögen diese Bilanztypen nichts oder wenig miteinander zu schaffen haben. Trotzdem gibt es als starke Klammer einen gemeinsamen Nenner: In einer Welt der angeblich so harten Wirtschaftsfakten mit ihrer Scheingenauigkeit von Nachkommastellen richten sie ihr Augenmerk verstärkt auf sogenannte „weiche“ Faktoren. In vielen Entscheidungssituationen sind es nämliche gerade solche, die nicht nur das Salz in der Suppe, sondern ganz wesentliche Entscheidungskriterien ausmachen.
„Entscheidungsprozesse durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen.“
„?“
„Und zwar von der Daten- über die Informations- bis hin zur höchsten Wissensstufe.“
„Richtig, den Schwierigkeitsgrad einer Entscheidung kann man dadurch erfassen, indem man auf das Verhältnis von Daten, Informationen und Wissen schaut.“
„Informationsbasierte Entscheidungen sind eher besser als solche, die ohne Informationen auskommen müssen.“
„Deshalb erfordert ein gutes Wissensmanagement auf der Entscheidungsebene die Bewertung von zirkulierenden Informationen.“
„Im Vergleich zu gut strukturierten Daten werden Wissen und Erfahrungen in der Regel aber nicht explizit dargestellt.“
„Genau diese Informationen sind aber für den Entscheidungserfolg von Bedeutung.“
Ja, schwach strukturierte Prozesse, deren Ablauf nicht genau vorhersehbar ist, werden ja meist auch nur einmal in der gleichen Form durchgeführt..“
Während bei der Vermittlung von Wissen zunächst kognitiven Fähigkeiten im Vordergrund stehen, werden bei der praktischen Umsetzung dieses Wissens in Entscheidungen auch persönliche, soziale und kommunikative Kompetenz benötigt. Alle Stufen der Entscheidungsfindung sollten daher verstärkt auf diese „softfacts“ eingehen. Wissen und Erfahrungen sind an Personen gebunden und daher können nur die Knowhow-Träger selbst diese Potenziale erschließen. Die Halbwertzeit des Wissens sinkt dramatisch ab: d.h. ohne regelmäßiges Aktualisieren könnte wertvolles Knowhow in kürzester Zeit für wichtige Entscheidungsprozesse nur noch die Hälfte wert sein.
„Entscheidungsprozesse ruhen auf einem komplizierten und manchmal schwer zu durchschauendem Gerüst von Personalfaktoren.“
„Neben messbaren Personalfaktoren gibt es viele andere, sogenannte „weiche“ Faktoren, die für den Erfolg einer Entscheidung ausschlaggebend sein können.“
„Die Grenzlinien zwischen beiden Faktorenqualitäten verlaufen nicht immer eindeutig.“
„?“
„Ein sogenannter wichtiger „Hauptfaktor“ muss diese Einordnung nicht für alle denkbaren Situationen beibehalten.“
„Das heißt, je nach Sachlage können „Hauptfaktoren“ und scheinbar unwichtige „Nebenfaktoren“ ihre Wertigkeitsposition auch tauschen?
„So ist es.“
Ein Personalfaktor ist nicht schon allein deshalb wichtig, weil er gemessen werden kann. Umgekehrt ist ein Personalfaktor nicht schon deshalb weniger bedeutsam, weil über ihn keine exakten Bestimmungen vorliegen. Auch für die sogenannten „weichen“ Faktoren gilt: sie sind weit häufiger auch nachvollziehbar quantifizierbar als üblicherweise angenommen. In einem zunehmend dynamischer und wettbewerbsintensiver agierenden Umfeld nimmt die relative Bedeutung der „weichen“ Faktoren gegenüber den üblicherweise gemessenen harten Faktoren weiter zu.
Schlaue Ökonomen haben sich mit der Frage befasst, wie Menschen was entscheiden und dabei auf die Qualität von Entscheidungen abgestellt. Zusammenhänge zwischen Entscheidungen und persönlichen Eigenschaften: Wie auf allen anderen Gebieten auch verfügen Personen über unterschiedliche Fähigkeiten: hier Entscheidungen zu treffen.
Ebenso wenig kann das grundsätzliche Ergebnis solcher Untersuchen verwundern: rationalere Entscheidungen bringen zumindest längerfristig gesehen mehr Vorteile.
„Was aber ist nun rational und was eben nicht??
„Können hierfür eindeutige Kriterien vermessen werden?“
„Und wenn - welche wie?“
„Allein die Bewertung des jeder Entscheidung direkt oder indirekt innewohnenden Risikos ist ein großes Problem.“
„Genau, was dem einen noch als Haltung eines Sicherheitsfanatikers gelten mag, könnten andere bereits als Tun eines Hasardeurs betrachten.“
„Die Börse lässt schön grüßen.“
Globalisierte Standortwelt mit Online-Wirtschaft
Viele Jahre wurde ein düsteres Bild von stadtgleichen Konsumwelten gezeichnet, in denen Menschen nur noch durch Themenparks von Malls und Gated Communities geistern, aber es kommt wohl anders: das Einkaufszentrum im Urbano-Dekor wurde als Inbegriff des Spätkapitalismus selbst zu dessen Opfer. Der Online-Handel kommt mit seinen Paketen bis vor die Haustür und lässt Shoppingkathedralen innerhalb weniger Jahre wie Geisterstädte aussehen. „Die Betreiber wollen die toten nachgebauten Konsumstädte schnell loswerden, der Unterhalt produziert enorme Kosten: Toiletten müssen gespült, Klimaanlagen in Betrieb gehalten werden, Dächer brechen zusammen, die Natur wuchert in die Passagen hinein. Vielleicht sind solche Dead Malls auch nur die Vorläufer einen architektonischen Artensterbens. Der Grund: Digitalisierung und Robotisierung verändern nicht nur Kaufverhalten und Wohnrituale, sondern dazu ebenso die gesamte Stadtplanung. „Städte waren immer um die Idee von Arbeit herumgebaut. Die moderne Met ropole mit ihrem Massenwohnungsbau entstand mit der Industrialisierung, als Zigtausende aus den Dörfern in die großen neuen Fabriken (Bürotürme im Zentrum der Nachkriegsstadt) strömten. Die langfristig ausgerichtete Stadtplanung muss sich dafür interessieren, welche Form von Arbeit es in der nächsten Zukunft überhaupt noch geben wird, für welche Formen von Beschäftigung welche Räumlichkeiten verlangt werden. „Die Zukunft der Stadt ist von der Frage, was mit der Arbeit passiert, nicht zu trennen.“ Wird es dann noch ein Zentrum geben, in das die Angestellten morgens aus ihren Vorstadthäusern pendeln. Angestellte, die ihren Wochenendbummel in der Mall machen, gibt es von mal zu mal weniger. Wenn man in der smart City (mit selbstfahrenden Autos) Arbeit und Leben dichter zusammenbringen will, beantwortet dies nicht die Frage danach, ob und welche Arbeit dies eigentlich sein wird. Selbst wenn Arbeit nicht verschwindet (was anzunehmen ist) werden die heute bekannten Ströme von Arbeiter und Angestellten zur Arbeit, in der Form, wie wir sie (noch) kennen, versiegen. „Was zu der Frage führt, was man mit den leeren Bürotürmen, den Wohnkasernen, den Malls, dem ganzen Mobiliar einer Stadt tun soll, die um eine Form von Arbeit herumgebaut wurde, die es nicht mehr geben wird.“ Was wird der öffentliche Raum sein, wenn es in ihm nicht mehr primär um den Transport von Menschen zur Arbeit geht?“ Was würde dies für eine Einteilung der Stadt in die öffentlichen Welten von Büro und Straße und die private Welt des Zuhauses? Fachleute sehen für leere Büroviertel und Malls aber durchaus Zukunftsperspektiven: sie bilden mit Gassen, Brunnen, Passagen und Plätzen ja schon die Städte nach, die sie zerstören. Auch mit einer Mall, von der ein Rohling einer echten, überdachten Stadt mit Strom und Wasser bleibt. ließe sich danach noch Geld verdienen.
4
„Persönliche Beziehungen werden oft aus Nützlichkeitserwägungen heraus eingegangen und gepflegt.“
„In dieser Sichtweise sind sie eine Art „sozialer Tausch“, an dem man sich mit eigenen Leistungen beteiligt.“
„Weil man sich dadurch Gegenleistungen erhofft.“
Auch falls die Beziehungsarbeit zunächst vielleicht einseitig verteilt sein mag, kann man dies doch als eine längerfristige Investition betrachten, die sich erst später auszahlen wird. Beziehungen stellen ein Sozialkapital dar, auf das man notfalls zurückgreifen kann. Beziehungen können unter Umständen problematisch sein, wenn sie nicht selbst gewählt werden können und deshalb nur beschränkt den eigenen Vorlieben und Vorstellungen gerecht werden. Worauf beispielsweise der Tatbestand hindeutet, dass oft nahe Familienangehörige als schwierig wahrgenommen werden. Bei ihnen entfällt die Möglichkeit der freien Wahl der Beziehungspartner, und man begegnet sich in unterschiedlichen Situationen, in denen es mal um Geselligkeit, mal um Hilfe und Unterstützung geht. Wobei es dann leicht zu Inkonsistenzen und Reibungen kommen kann. Bestätigt wird dies auch für die Arbeitskontakte, die im Vergleich zu Freunden deutlich häufiger als anstrengend empfunden werden.
„Doch nicht nur die Rollen und Situationen, in denen man anderen begegnet, haben einen Einfluss auf die Störanfälligkeit von persönlichen Beziehungen.“
„Stimmt, wichtig ist dabei auch die Art des Austauschs: Wenn es um Geselligkeit, Vertrauen und Hilfe im Notfall geht, erhöhen oder verringern sich die Chancen auf eine harmonische Beziehung kaum.“
„Aber?“
„Dreht sich die Beziehung dagegen um Unterstützungsleistungen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Beziehung schwierig wird.“
Jemandem unter die Arme zu greifen wird nicht nur als lästig empfunden, sondern lässt auch die betroffene Person in einem problematischen Licht erscheinen. Kontexte, in denen man seine Partner nicht selbst wählen kann, kreieren oft schwierige Beziehungen. Auch Neid ist ein zerstörerisches Gefühl, allerdings auch ein Tabu, über das man nicht spricht. Was andere haben, will ich auch haben, und auf keinen Fall will ich dabei meine eigene Unzulänglichkeit spüren. Neid kann ein ganzes Team schwerwiegend kontaminieren: Es bildet sich ein regelrechter Giftcocktail mit Gefühlen der Ungerechtigkeit, der Trauer, der Unzufriedenheit.
Geschämt haben sich die Studenten damals dem Vernehmen nach nicht, als sie von Wissenschaftlern für ein berühmtes Experiment befragt wurden: Wollt ihr lieber ein Jahreseinkommen von hunderttausend Euro haben, während alle anderen hier im Raum zw, eihunderttausend verdienen? Oder zieht ihr die zweite Möglichkeit vor, nämlich fünfzigtausend Euro zu verdienen, wenn alle anderen nur fünfundzwanzigtausend erhalten? Die Mehrheit entschied sich für die zweite Variante, nämlich die der Missgunst.
„Digitale Zeiten sind herrliche Zeiten des Neidischseins.“
„Warum?“
„Durch das Internet wird ein großer Teil des Lebens, der repräsentative, öffentlich geführt, erfolge werden hergezeigt.“
„Und möglichst auch nur die Erfolge: Genau diese vorab gefilterten, in ihrer Kompaktheit unrealistischen Glanzlichter, verzerren das Bild.“
„Berufliche Details, die vorher nur erahnbar waren und zwischen den Deckeln der Personalakte in Frieden ruhten, sind plötzlich halböffentlich dokumentiert.“
„Das nervöse Schielen auf das, was andere auszeichnet, nährt Begehrlichkeiten für die eigene, auf einmal so glanzlos erscheinende Biographie.“
Eine beliebte Währung in der Neiddebatte sind Verurteilungen und Vorverurteilungen, besonders in einer Gesellschaft, die dazu neigt, Gerechtigkeit mit Gleichheit gleichzusetzen. Um uns und unsere Leistungen einschätzen zu können, müssen wir uns vergleichen. Das tun wir meist mit jenen, die uns relativ ähnlich sind, die es aber in unserer Wahrnehmung weiter gebracht haben.
„Das heißt, Neid kann auch eine Triebfeder zum Erfolg sein.“
„Wer aber mit sich selbst im Großen und Ganzen im Reinen ist, der kann auch anderen etwas gönnen.“
„Der hat damit dann auch sein Auch-haben-wollen-Kindheitsgefühl abgelegt.“
„Was wiederum für persönliche Beziehungen nur von Vorteil sein kann.“
Intelligentes Management
„Es bringt nichts, wenn man etwas im Kopf hat, aber keine Lust mitbringt, die PS auf die Straße zu bringen.“
„Stimmt, die notwendige Grundmotivation und Leistungsbereitschaft erlangt nur der, der sich mit seiner Arbeit identifiziert.“
„Für Wohlbefinden und Gesundheit kommt es ja auch deshalb für den Einzelnen darauf an, dass er im Gleichgewicht ist.“
„?“
„Man muss eben in Bewegung bleiben.“
„Aber auch die Balance halten“.
„Auch reicht es nicht, nur innovativ sein zu wollen.“
„Nee, man braucht auch die Fähigkeit, die Balance nicht zu verlieren.“
„Und wie?“
„Um die Balance zu halten, muss man auch einmal innehalten.“
„Das heißt?“
„Nur in Bewegung bleiben birgt die Gefahr, wie ein Hamster im Rad zu werden.“
„Also bedeutet doch Balance halten auch, dass ich auch links und rechts gucke“.
„Richtig, man braucht Raum, um quer zu denken.“
„Wer aber nicht schnell und vor allem effizient arbeitet, dem fehlt auch letztendlich die Zeit, quer zu denken.“
„?“
„Er ist quasi in einer völlig atemlosen Bewegung.“
„Man kann aber auch für eine Idee brennen und dabei noch der tollste Innovator sein: wenn man nicht das nötige Rüstzeug hat, um Balance zu halten, dann war es das.“
Der Markt dreht sich eben immer schneller, die Halbwertzeiten von Produkten und Leistungen werden immer kürzer. Die Digitalisierung entfacht eine neue Dynamik an Informationen, Kommunikation und Entscheidungen. Und alles dies passiert mit hoher Geschwindigkeit und Komplexität. Umso wichtiger wird das In-Bewegung-Bleiben, ohne dabei die Balance zu verlieren. Man kommt nicht umhin, sich Räume zu schaffen (zu bewahren), um kreativ zu sein und Zeit zu haben.
5
Wirtschaftsförderung auf Kommunalebene
Beispielsweise will ein Standort mit einem neuen Einkaufszentrum insbesondere auch den Abfluss von Kaufkraft aufhalten. Denn mit einer rechnerischen Verkaufsfläche von o,8 Quadratmetern je Einwohner liegt der Standort unter dem bundesweiten Durchschnitt von 1,4 Quadratmetern. Das Angebot eines Einkaufscenters soll sich an ein Einzugsgebiet von ca. 100.000 Einwohnern richten. Ein reichhaltig sortierter Lebensmittelmarkt soll neben Mode und Elektronik als Frequenzbringer fungieren. Weitere Rahmendaten in etwa wären: 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, Supermarkt, Elektronikmarkt, Drogerie, Schuhgeschäft, kleinere Läden, Tiefgarage mit 400 Plätzen.
Gewerbegebiete am Standort: Im Wege einer kürzlich neu erstellten Entlastungsstrasse wurde auch die Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes gestärkt. Bei Standortakteuren geht man davon aus, dass die entsprechende Nachfrage nach Gewerbeflächen im Bereich von Büroflächen in Verbindung mit Hallen- oder Produktionsflächen vorhanden ist. Es sollen daher mit Projektentwicklern, Investoren u.a. hierzu detaillierte Nutzungs-konzepte ausgearbeitet werden. Nach einem der Konzepte sollen für hinzukommende Mietinteressenten Einheiten im voraus erstellt werden, um so eine zeitnahe Ansiedlung zu unterstützen. Die Kommune will als wichtiges Standbein des Standortes die Ansiedlung von handwerklich orientierten oder produzierenden Unternehmen fördern.
Eine Organisation errichtet am Standort ein neues Gebäude für ihre Deutschland-Zentrale. Einer der Gründe: viele der Mitarbeiter als wichtigstes Kapital der Organisation sind mit dem Standort fest verwurzelt. Zudem liege der Standort verkehrsgünstig in Deutschland.
Auch der nah gelegene Flughafen sei für Reisen zu vielen Projekten sehr wichtig. Nicht zuletzt sei auch die Wirtschaftsförderung bei Überwindung bürokratischer Hürden immer sehr behilflich gewesen.
Für den Bau der neuen Zentrale werden Maßstäbe der Nachhaltigkeit angelegt. Insbesondere würde die Wärmeversorgung durch Geothermie, eine Photovoltaikanlage und hohe Dämmwerte weit über dem ökologischen Standard liegen.
„In der Metropolregion Frankfurt studieren und arbeiten etwa 5.000
Chinesen.“
„Von rund 10.000 in ganz Hessen.“
„Ja, von der steigenden Zahl chinesischer Besucher profitieren insbesondere Hotels, Restaurants oder der Einzelhandel.“
„In der Innenstadt gibt es ja eine Reihe von Geschäften, die sich speziell auf chinesische Kundschaft eingestellt haben.“
„Und der Flughafen beschäftigt im Transitbereich sogar spezielle Personal Shopper.“
„?“
„Mitarbeiter, die Chinesen beim Einkauf beraten.“
„Im Schnitt gibt jeder Chinese in Deutschland pro Tag und Kopf mehr als 500 Euro aus.“
„Skyline, Goethehaus und Börse schaffen ein Image, das bei chinesischen Gästen der Stadt hoch geschätzt wird.“
„Ein wichtiger Impuls war zudem der Start des ersten Renminbi-Offshore-Centers der Eurozone.“
„?“
„Zum Handel mit der chinesischen Währung.“
Der Wirtschaftsförderung Hessen zufolge kam ein Drittel der neu gegründeten ausländischen Unternehmen in der Region aus China. Über zweitausend chinesische Firmen haben sich bereits in Deutschland angesiedelt, fünfhundert davon im Rhein-Main-Gebiet (es gibt mehr als siebzig Städte- und Provinzpartnerschaften). Diese Unternehmen beschäftigen Chinesen, aber auch örtlich verfügbare Mitarbeiter. Zu den Schwerpunktbranchen chinesischer Geschäftstätigkeiten gehört vor allem der Bankensektor: Ein Teil der größten chinesischen Banken haben in Frankfurt Niederlassungen eröffnet. „Dank seiner zentralen Lage ist Frankfurt die erste Wahl für Unternehmen, die ihr europäisches Geschäft vor Ort pflegen und von Frankfurt aus agieren möchten. Dazu gehören Energiekonzerne, Technologiefirmen oder auch Maschinenbauer. Die drei wichtigsten chinesischen Fluggesellschaften bieten jede Woche über sechzig Direktverbindungen zwischen Frankfurt und China und bilden damit eine stabile Luftbrücke.
„Nicht zuletzt könnte Frankfurt auch von der chinesischen Seidenstraße-Initiative profitieren.“
„Wie?“
„Die Seidenstraße ist historisch nicht nur ein wichtiger Handelsweg gewesen.“
„Sondern?“
„Sondern hat auch eine große Rolle für den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Austausch zwischen Ost und West gespielt.“
„Der Aufbau des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels bedeutet für die Metropolregion Frankfurt noch mehr Chancen und Erleichterungen in der Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit sowie im Personalverkehr mit China“.
Menschliche Wertschöpfungsquellen
„Menschliche Arbeit wird zunehmend als Quelle für betriebliche Wertschöpfung erkannt.“
„Sie ist aber nicht von den Personen, die sie leisten, zu trennen.“
„So ist es, wobei die Ressource "Humankapital" eine Reihe charakteristischer Merkmale aufweist.“
„?“
„Die kleinste Einheit des Wissensmanagements ist das Individuum als Träger von Fähigkeiten.“
„Aber auch als Besitzer von Erfahrungen.“
Häufig ist nur ein Teil dieser Fähigkeiten (z.B. Ausbildung, Sprachkenntnisse) bekannt. Diese bekannten Daten bilden aber nur einen Teil der Mitarbeiterfähigkeiten ab: wer die Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht kennt, verpasst die Gelegenheit, sie zu nutzen (mangelnder Zugriff auf internes Expertenwissen).
„Stimmt, denn Erfolg hängt zuerst immer von Mitarbeitern ab“
„Denen wichtig ist, dass sie sich ernst genommen und gerecht behandelt fühlen.“
„Genau, als Mitarbeiter sind dann motivierter und engagierter.“
„Weil sie sich dann auch selbst für den Erfolg verantwortlich fühlen.“.
Menschen sind keine passiven Gestaltungsobjekte, sondern Träger von Zielen, Bedürfnissen, Wertvorstellungen und der Möglichkeit des (re)aktiven Handelns, was sich u.a. in der Aversion gegenüber (zusätzlicher) Steuerung und Kontrolle manifestiert.