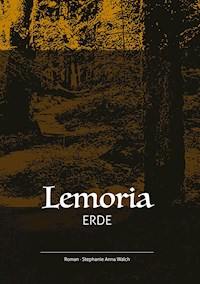
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Und erst dann, als man keine Angst mehr vor der Wahrheit hatte, war man dazu bereit, alles loszulassen und den Dingen ihren unweigerlichen Lauf zu geben ... Eigentlich war ich müde von der oberflächlichen, grauen Welt, meinem persönlichen Kampf des Lebens und von den Menschen, die nur ihrem Trott und den nichtssagenden Dingen nachgingen. Bis ich einst unverhofft auf Joseph traf. Schon sehr schnell stellte sich heraus, dass er einer Gattung von Zeitgenossen angehörte, von denen ich bisher noch nie in meinem Leben etwas gehört hatte. Von diesem Tag an war nichts mehr so, wie es einst einmal war ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Mutter
und ihren unermüdlichen Glauben daran,
dass am Ende alles gut werden wird.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Danksagung
Figurenverzeichnis
1
»Manchmal weiß ich nicht, wie ich das alles ohne euch aushalten soll.« Auf das war ich nun wirklich nicht vorbereitet. Aber auf was in meinem Leben wurde ich schon jemals vorbereitet? Mein Leben ist wohl ein Chaos! Ein einziger Trümmerhaufen. Und ich? Spiele ungefragt die Hauptrolle. Still seufzte ich und knüllte das geschriebene Stück Papier zusammen. Ich warf es an die Wand und starrte auf meinen Kugelschreiber, der mich irgendwie fordernd ansah. Er erinnerte mich an das Versprechen, das ich Mum und Dad gegeben habe, nämlich ihnen regelmäßig Briefe zu schreiben. Seufzend sah ich aus dem Fenster. Die Landschaft verblasste ringsum und ich war in Gedanken versunken. Das leise Surren der Gleise beruhigte mich. Auf eine gewisse Weise. »Endstation. Bitte steigen Sie aus!« Der Schaffner deutete ein kleines Lächeln an, das aber sofort darin erstickte, indem er streng Richtung Waggontür starrte. Schnell hob ich mein weggeworfenes Stück Papier auf und faltete es wieder auseinander. Ich strich das bereits Gekritzelte durch, denn mir fiel ein, dass ich nur noch dieses eine Blatt dabeihatte. »Ich liebe euch. Rosalie.« Das musste für heute reichen. Ein paar Straßenecken vor dem Haus meines Bruders Ryan, bei dem ich von nun an wohnen würde, befand sich ein alter Briefkasten. Dort warf ich es in einem bereits adressierten Kuvert ein, als ich mich auf den Weg zu ihm nach Hause machte. Ryan ist ein paar Jahre älter als ich. Er schloss damals das College mit Bravour ab, während ich krampfhaft versuchte, mein Leben zu ordnen. Mein Bruder war das totale Gegenteil von mir: erfolgreich, organisiert und beliebt. Das Glück schien bereits das ganze Leben lang auf seiner Seite zu sein, ohne dass er sich groß dafür anstrengen musste. Alles ging ihm leicht von der Hand. Ryan hatte viele Freunde. Er – für seinen Teil – hatte unserem Dad versprochen, dass er auf mich achtgeben würde. In unserer Familie hielt man noch sein Wort. »Na dann …!«, seufzte ich. Es blieb mir wohl keine andere Wahl, als mich auf mein neues Zuhause einzustellen. Es würde schon alles irgendwie gehen. So, wie es das eben immer tat.
»Du bist heute spät dran. Das Essen ist schon fast kalt.« Ryan sah mich vorwurfsvoll und gleichzeitig fragend an. »Es … tut mir leid«, erwiderte ich und versuchte seinem strengen Blick auszuweichen. »An deiner Ironie musst du unbedingt noch arbeiten, junge Dame.« Ryans Mimik verdunkelte sich. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Er schien besorgt zu sein. »Was ist denn nur mit dir los?«, fragte ich ihn und musterte seinen Gesichtsausdruck. »Ist dir meine Anwesenheit im Haus etwa jetzt schon zu anstrengend oder sind dir letzte Nacht auf Streife wieder zu viele Geister begegnet?« Ryan arbeitete bei der Polizei. Er erzählte mir unlängst von einer Reihe mysteriöser Fälle, die bislang ungelöst blieben. Es gab seltsame Spuren und manchmal eigenartige Zeugenaussagen, die nicht auf normale Verbrechen hindeuteten. Diese Fälle schienen sich zu häufen. Er machte seinen Job gewissenhaft und gut. Lange würde es wohl nicht mehr dauern, bis er Chief Officer in dieser kleinen Stadt, außerhalb des Schusses, wurde. Die Leute mochten ihn. Sie fühlten sich in seiner Nähe wohl. Durch seine Anwesenheit schien alles immer unter Kontrolle zu sein. Dafür bewunderte ich ihn. Schon immer. »Du weißt ganz genau, ich habe dir verboten, noch um diese Uhrzeit allein herumzustreichen. Es ist zurzeit sehr gefährlich hier. Die Stadt ist momentan nicht sehr sicher.« Er schöpfte Suppe in meinen Teller und musterte mich immer noch. »Lass mich raten! Tierangriffe? Was ist es dieses Mal? Werwölfe? Vampire? Das ist ein Irrsinn, Ryan. Geschichten und Legenden. Nichts weiter. Am Ende wissen wir doch alle, wie es ausgehen wird, wenn wir die Märchenbücher kennen. Pass bloß auf, dass dich dieses ganze übersinnliche Gedöns nicht irgendwann irre macht. Du solltest dir weniger Gedanken dazu machen. Für deine eigenartigen Fälle gibt es sicher eine ganz logische Erklärung – da bin ich mir absolut sicher. Alles andere passiert nur im Fernsehen und in Büchern, aber nicht im realen Leben …«, schmunzelte ich dabei kopfschüttelnd. Ryan tat so, als hätte ich recht. In seinen Augen aber schien ihn irgendetwas vom Glauben daran nicht abzubringen. »Du bist ganz schön frech geworden, weißt du das?«, lachte er immerhin kurz, jedoch verfinsterte sich sein Blick schnell wieder. »Nein, keine deiner weisen Theorien, du schlaue Eule. Es ist … etwas anderes. Nur weil manche Fälle gerade sehr seltsam sind, heißt das nicht, dass es gleich irgendwelche Fabelwesen gewesen sein mussten.« Und dennoch, sein Ernst dahinter war schon fast erschreckend. Mein Bruder stand auf und zog seine Dienstjacke an. »Du, junge Lady, bleibst genau in diesen vier Wänden, wo du gerade bist. Hast du das verstanden? Das war keine Bitte!« Ryan hatte heute Nachtdienst. Nichts Ungewöhnliches. Ich versuchte, meinen Hohn ihm und seinen Geistertheorien gegenüber so gut es ging zu verstecken, aber an seinem Tonfall merkte ich, wie ernst es ihm war. Auch wenn er nichts offiziell aussprach, merkte man, dass es für ihn etwas war, was er bislang noch nie so gesehen hatte. »Keine Ausrisse heute Nacht und keinen Geistereinlass. Verstanden, Officer«, gelobte ich Gehorsam und stand dabei straff vor ihm. Nun lächelte er zufrieden und packte seine Sachen zusammen. »Pass eher du auf, dass dich kein übersinnliches Wesen auf dem Posten überfällt, hier draußen ist es denen doch sowieso zu langweilig. Hier ist ja nichts!«, scherzte ich. »Halt die Klappe, Rose, und sperr die Tür ab, wenn ich weg bin.« Nun denn. Heute schien er wohl wirklich keinen Spaß zu verstehen.
Ich sah seinen Jeep aus der Einfahrt wegfahren. Auf der Straße hielt er nochmals kurz an, wagte einen kurzen Kontrollblick in den Rückspiegel. Ryan betrachtete nochmals das Haus. Und somit verschwand die Silhouette des Wagens nach und nach immer mehr in der Dunkelheit. Ich holte mir ein Glas Milch aus dem Kühlschrank und setzte mich vor den Fernseher. Nachrichten. Uralte Filme aus der Steinzeit, die man schon zu hundertfach gesehen hat. Auf allen Kanälen etwa dasselbe. »Was für ein Leben.« Und noch während ich mir das dachte, hielten meine Augen nicht mehr stand und ich schlief unter der Decke ein. Im Traum ist man frei. Frei von den ganzen Sorgen. Dem Leben, das man führt. Man hat Pause von der ganzen Katastrophe. Einen Moment lang fühlte ich mich leicht in meinem Geist.
Die Sonne schien durch das Fenster direkt auf mein Gesicht. Ich erwachte plötzlich, als morgens die Haustür aufging. Ryan war zwischenzeitlich von der Arbeit zurück. Na wunderbar! Das wäre es dann mit meinem Schlaf gewesen. Ich strich die Decke über meinen Kopf, aber vergebens. Ryan schmiss mich sachte von der Couch. Er nahm seine Aufgabe, auf mich achtzugeben, wohl etwas zu ernst. »Ab mit dir in die Stadt! Du hattest jetzt genügend freie Tage, um dich von allem zu erholen. Du bist hierhergekommen, um etwas aus dir und deinem Leben zu machen. Also, lerne das Zentrum kennen und suche dir einen passenden Job! Du musst ja nicht sofort deinen Traumjob finden, aber ein wenig Abwechslung und Regelmäßigkeit in deinem Alltag würden dir guttun. Also Kleine, los!« Seufzend gab ich ihm nach. Ich hatte mir das alles etwas anders vorgestellt. Zumindest ein paar Tage hier Urlaub zu machen und dann langsam zu starten, wäre ideal gewesen. Aber ich wusste, Ryan würde so oder so keine Ruhe geben. Also machte ich mich auf den Weg.
Meine neue Stadt hatte nichts Aufregendes. Ich erntete fragende Blicke, da mich die Einwohner nicht kannten. Ein neues Gesicht fiel auf, denn hier kannte jeder jeden. Nun war ich die Neue – die Dazugestoßene. Tja, so eine Situation war in meinem Leben nichts Neues. Ich genoss seit Anbeginn meines Lebens die Rolle der Außenseiterin. Manchmal eben mehr und manchmal eben weniger. Während ich so von Schaufenster zu Schaufenster dahinschlenderte, um die Umgebung etwas besser kennenzulernen, versank ich in Gedanken. »Liam! O nein!« Er würde sich bestimmt schon fragen, was mit mir los sei. Liam war meine erste große Liebe. In einem Alter von 21 Jahren klang es sehr altbacken, über dieses Thema zu sprechen, aber er war schon immer an meiner Seite. Er war das, was ich als Liebe bezeichnete, denn er hatte all diese unschönen Dinge mit mir durchlebt und ist mir nie von der Seite gewichen. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Vermutlich war ich hier sowieso nur für eine kurze Weile, bis ich mein Leben wieder im Griff habe. Liam blieb vorerst in meiner Heimatstadt. Er war mitten in seiner Ausbildung und wir hatten vor, nach seinem Abschluss wieder zusammenzuwohnen. Wo auch immer das dann sein wird, Hauptsache er und ich sind wieder vereint. Mehr brauchten wir nicht. Ich ging durch die Straßen und hoffte, nicht angesprochen zu werden.
Am Busplatz angekommen, stieß ich zufällig auf eine Bäckerei, die meine volle Aufmerksamkeit bekam. Da ich Hunger hatte, ging ich hinein. Ich sah mich nicht großartig um, sondern steuerte sofort den Tresen an. »Hey, du bist doch Rosalie!«, ertönte es im Hintergrund aus einer kleinen Sitznische. Ich presste die Lippen fest zusammen. Verdammt, dachte ich mir. Das fehlte mir jetzt gerade noch. Anstandshalber drehte ich mich um und versuchte, meine Verachtung zu verbergen, war jedoch überrascht, als ich eine sehr sympathische Gestalt vor mir sah, die mir freundlich entgegenlächelte. »Woher um Himmels Willen kennst du meinen Namen?«, fragte ich nicht sehr freundlich. Das war schräg. So etwas war mir noch nie passiert. »Naja. Es spricht sich eben sehr schnell herum, wenn jemand neu in der Stadt ist, schließlich kennt man sich hier untereinander. Ich bin übrigens Joseph!«, stellte er sich vor, indem er mir die Hand reichte. »Rosalie«, erwiderte ich, obwohl er meinen Namen ja offensichtlich schon kannte. Joseph hatte eine dunkelbraune Haut und wunderschöne Augen, in fast derselben Farbe. Er strahlte etwas Sanftes, Beruhigendes aus und ich beschloss wider Erwarten, das Gespräch nicht abzublocken, sondern sah ihm freundlich in die Augen. Als ich näher an ihn herantrat, färbten sich seine dunkelbraunen Rehaugen für einen kurzen Augenblick in einen goldfarbenen Schimmer. »Du … du hast deine Augenfarbe gewechselt! Was um Himmels Willen war das …?«, fragte ich, und noch während ich die Worte aussprach, versuchte ich zu realisieren, was hier gerade vor sich ging. Er erschrak. »Äh, nichts weiter«, entgegnete er überrascht, drehte sich zur Seite und rieb seine Augen. Joseph lief wortlos nach draußen und ich stand immer noch wie angewurzelt mitten in der Bäckerei, während die Dame an der Theke langsam ungeduldig wurde. Also bestellte ich eine Semmel und einen Kakao, bezahlte und lief nach draußen. Plötzlich rumpelte mich von der Seite eine langbeinige, Kaugummi kauende Blondine an. Mit abwertendem Blick durch ihre viel zu große Sonnenbrille musterte sie mich verächtlich von oben bis unten und drehte sich ihren Freundinnen zu, die wie ihre persönlichen Bodyguards aussahen. »Bist du fertig?«, schnaubte ich verärgert und wollte einfach weiterlaufen, als sie mir ein Bein stellte und ich zu Boden fiel. »Pass ja auf, Neue! Du bist hier nicht willkommen! Komm mir ja nicht in die Quere!«, drohte sie mir und zog von dannen. Ihre Gefolgschaft pfiff sie wohl zu sich und ich sah sie alle davonlaufen. Einen Moment blieb ich liegen. Stille. Ich hatte keine Kraft mehr – für all das. Mein Leben war ein einziger Kampf. Manchmal war es schwer, meinen Platz darin zu sehen.
»Rosalie? Ist alles in Ordnung?«, hörte ich eine mir bekannte Stimme. Joseph stand plötzlich wie aus dem Nichts vor mir und half mir auf. Ich versuchte, den Dreck von meinen Jeans abzuwischen und zwang mich dazu, ein Lächeln anzudeuten. Der Kakao lag verschüttet am Boden und mein Essen war nun ungenießbar. »Du warst schnell weg!?«, sagte ich. Joseph wirkte verlegen, seine Augen hatten wieder die ursprünglich braune Farbe – kein Gold, kein Schimmer, alles normal. Es kam seinerseits keine Reaktion auf meine Bemerkung, deshalb bedankte ich mich bei Joseph und stieg in den Bus, der schon zur Abfahrt bereitstand. »Bis bald!«, rief er mir hinterher. Ich erwiderte nichts mehr darauf und sah ihn nur mit einem kleinen, angedeuteten Lächeln an. »Was für ein Anfang!«, sagte ich zu mir selbst. Das reichte für heute. Ich nahm die Umgebung nur beiläufig wahr, als ich aus dem Fenster sah. In Gedanken war ich ganz woanders. Ich nahm den Stift aus meinem Rucksack heraus und begann zu schreiben:
»Hallo Mum! Langsam werde ich wohl verrückt. Heute war mein erster Tag hier in der neuen Stadt bei Ryan und ich sah diesen Jungen in der Bäckerei. Nicht was du jetzt denkst, ich kann dich bis hierher hören!!! Nein. Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Ich sah, wie sich seine Augen einen Moment lang golden verfärbten. Ich glaube langsam, dass es an der Zeit ist, mich aufzuraffen. Sonst lande ich irgendwann noch in der Irrenanstalt.« Ich holte meine Kopfhörer heraus, um meine Lieblingsmusik zu hören, und schrieb weiter:
»Liam muss sich wohl schon große Sorgen machen. Vielleicht tut uns beiden die Pause aber ganz gut. Es hat sich alles verändert. Ryan gibt sein Bestes und ich hoffe, ich muss ihm hier nicht allzu lange auf den Geist gehen. Richte Dad von mir liebe Grüße aus und pass auf, dass er sein Gemüse isst. Du weißt, zu viel Süßigkeiten tun seinem Herzen nicht gut. XX. Rosalie.«
An meiner Endstation angekommen, stieg ich aus, warf den bereits frankierten Brief beim nächsten Briefkasten ein und lief nach Hause. Endlich war ich da. Die Haustür klemmt manchmal ein wenig, deshalb zog ich sie etwas zu mir her, um sie leichter öffnen zu können. Meine Jacke warf ich auf das Sofa und ging dann auf mein Zimmer. Ausruhen wäre jetzt genau das, was ich brauchte. Ich hatte meinen guten Willen heute zumindest gezeigt.
2
»Hat sie etwas bemerkt?« Fuchtelnd und völlig aus dem Häuschen ging Tyrese den Flur auf und ab, als gäbe es allen Anlass zur Beunruhigung. Joseph saß am Küchentisch und schaute verschämt auf den Boden. »Du bist zu weit gegangen! Du weißt, dass du keinen engen Kontakt zu Menschen knüpfen sollst. Die Menschheit ist noch nicht soweit! Ruf die Familie zusammen!«, befahl sie ihrem Sohn in einem sehr strengen Tonfall. Er gehorchte demütig auf Anhieb. Als sie alle in der Küche versammelt waren, schnitt Joseph die Tomaten fertig, die Tyrese angefangen hatte zu zerkleinern. Ob bei der aktuellen Situation irgendjemand an ein Essen dachte? Yaris sah etwas besorgt aus dem Fenster. Yaris und Tyrese waren Josephs Eltern und zugleich die ältesten ihrer Art hier in ihrem Viertel.
Sie hatten drei Kinder: Joseph war mit seinen neunzehn Jahren der älteste Sohn, Nilai war fünfzehn Jahre alt und der zweite männliche Nachkomme und Sennah war fast zwölf Jahre alt und das Nesthäkchen der Familie. Am Esstisch besprach die Familie die ernst zu nehmende Lage nach dem Vorfall in der Bäckerei. Durch die Stille hindurch konnte man das Ticken der Küchenuhr hören. Die Blicke waren voneinander weggerichtet. Niemand wusste so recht, was hier vor sich ging oder hatte eine Antwort darauf. »Rosalie hätte das niemals sehen sollen oder können!«, unterbrach Joseph letztendlich die Stille im Raum. »Unsere Augen verfärben sich ja erst, wenn wir uns mit dem Element verbinden und ich habe nichts gemacht, ich schwöre es bei den Ältesten!«, fügte er hinzu und hoffte, dass ihm seine Familie Glauben schenkte. »Dennoch hat sie es gesehen. Was hat das auf sich?«, entgegnete Tyrese sehr besorgt. Ahnungslos starrten alle ins Leere. »Vielleicht sollten wir den Zirkel befragen. Wäre das nicht unsere Pflicht, ihn zu informieren?«, brachte sich nun Nilai in die Diskussion mit ein. In diesem Moment beschloss Tyrese, die zwei jüngeren Familienmitglieder aus diesen Dingen herauszuhalten. Auch wenn Nilai recht hatte, das Thema war nur für Erwachsene. Die Jugendlichen sollten unbeschwert aufwachsen, denn der Ernst des Lebens würde noch früh genug kommen. »Das kommt überhaupt nicht infrage!«, wurde Yaris nun zornig und sprach weiter. »Der Zirkel erfährt es noch früh genug. Wir wecken nicht unnötig schlafende Wölfe!« Nach seinen scharfen Worten waren alle erst einmal still. Man konnte sehen, dass sie die Sache verdrängen und es als seltsamen Zufall abstempeln wollten. »Aber Mum!«, wehrte sich nun Joseph gegen ihr Vorhaben. Er wusste, dass es sich um keinen Zufall handeln konnte. Das Universum spielte nicht. Und er war sich sicher, dass auch seine Eltern so empfanden. Tyrese schaute dabei auf die jüngeren Kinder und warf Joseph einen verstehenden Blick zu. Er seufzte und gab auf. Und somit beschlossen sie, bis auf weiteres nichts zu unternehmen, ihrem bisherigen Alltag nachzugehen und ihre Aufgaben als Lemoren weiterhin zu erfüllen. Sie verboten Joseph, erneuten Kontakt zu Rosalie aufzunehmen. Sie hofften, dass er sich daran hielt, denn er nahm es mit den Regeln nicht immer sehr genau. Ein gemeinsames, vertrautes Ritual würde sie jetzt alle beruhigen.
Sie versammelten sich hinter dem Haus und knieten sich im Kreis auf den Boden nieder. Die Hände auf den Erdboden gelegt, verbanden sie sich mit ihrem zugeordneten Element
– der Erde.
Es war ihr eigenes Ritual – als Familie. Mit dem Element Erde traten sie in Verbindung und synchronisierten sich auf geistiger Ebene mit ihm. Hier waren sie zu Hause. Hier bekamen sie ihre Kraft.
Ihre braunen Augen bekamen einen wunderschönen, goldfarbenen Schimmer. Aus dieser Vereinigung konnten sie die heilende Kraft der Natur schöpfen. Alle Lebewesen entstammten der Natur. Für die Lemoren war es eine logische Schlussfolgerung, dort ihre Kraft zur Heilung zu erhalten. Und während diese heilsame Energie floss, kam ringsum um ihren Kreis, sogar ein paar Meter von ihnen entfernt, alles, was verletzt oder aus der Norm war, wieder in seinen geordneten heilen Ursprung: Pflanzen, die dürr waren, erhielten wieder Lebenssaft. Die umliegenden Bäume standen nun aufrechter. Schmetterlinge suchten die Nähe dieses Kraftfeldes und tankten Energie. Es herrschte für einen Augenblick Frieden. Etwas Schönes, Weiches und Reines floss durch ihre Augen. Güte und Barmherzigkeit waren ihre Begleiter hier auf der Erde. Sie waren die Heiler auf diesem Planeten. Ihrer Art galt die Aufrechterhaltung des Guten. Wo auch immer sie sich mit ihrem Element Erde verbanden, fand Heilung statt, sofern es vom Zirkel vorgesehen war. Ihre Aufgabe war nicht darüber zu bestimmen, sondern sie dienten mehr als eine Art Gefäß für den Zirkel. Sie transformierten die Energien und waren als eine der vier Grundpfeiler für das Gleichgewicht der Erde zuständig. Die Menschen hatten keine Ahnung von ihrer Existenz. Und das sollte auch weiterhin so bleiben. Lemoren, die man als Vertreter der Elemente bezeichnete, hatten die Aufgabe, der Entwicklung der Menschheit zu dienen. Äußerlich schienen sie wie normale Menschen zu sein, aber sie waren weit mehr als das. Äußerlich unterschieden sie sich jedoch nur in Verbindung mit ihrem Element, indem sie ihre Augenfarbe wechselten. Lemoren waren so gut wie unsterblich – zumindest für die Menschen. Der Tod konnte nur von den Ältesten des Zirkels ausgelöst werden. Dieses Privileg galt nur ihnen. Sollte ein Lemor jedoch einen anderen töten, so war ihm gewiss, dass sein Leben nicht mehr für lange Dauer sein würde und er selbst zu Staub zerfiel. Wo genau sich der Zirkel befand, wusste keiner. Das blieb wohl für immer ein Mysterium. Er war überall und nirgendwo. Er befand sich irgendwo im Ursprungselement
– dem Äther.
Der Äther ist das übergreifende Element. Durch dieses entstanden einst die vier Grundelemente. Es zeichnet sich durch das Prinzip des ewigen Guten aus. Seine Natur liegt im Unsichtbaren. In ihm fand man die Unendlichkeit. Und so waren auch seine Ältesten, die im Äther für Recht und Ordnung sorgten. Sie vertraten, als jeweils einer für jedes Element, den Ursprung allen Seins. Durch ihr allgegenwärtiges Dasein waren sie allwissend, zumindest was die Erde betraf. Nichts konnte dem Zirkel verborgen bleiben. Jeder einzelne Schritt eines jeden Menschenlebens auf der Erde wurde im Äther gespeichert und konnte jederzeit von den Ältesten abgerufen werden. Der Zirkel glich einer Art Bibliothek. Darin befand sich das gesamte Wissen der Menschheit. Die Aufgabe der Ältesten war es, die Menschheit zu schützen, zu lehren und mithilfe der Lemoren das ewige Gleichgewicht zu wahren. Ihre Wortwahl war stets überlegt und weise. Nichts konnte man vor ihnen verbergen. In ihren Augen spiegelten sich die vier Grundelemente in einer wundervollen Pracht wider:
Erde – Feuer – Wasser – Luft.
Die Welten waren von den Elementen abhängig. Sie hielten die Erde zusammen, dadurch stiegen und fielen die Universen mit ihrer Kraft. Jedes Element wurde durch einen der Lemoren im Zirkel vertreten. Manche behaupten, dies unterliegt keinem Zufallsprinzip, sondern war von der Schöpfung bereits so vorgegeben. Durch eine sorgsame Auswahl wurde man in den Zirkel berufen. Hatte man einmal eine solche Position inne, so gab es kein Zurück mehr.
Wenn eine Lemorin ein Kind gebar, war es unter ständiger Beobachtung des Zirkels, von Anbeginn seiner Zeit. Wenn die Zeit reif war, wurde es nach oben gerufen und verließ die Erde und seine Familie.
»Es wird schon kein Drama geschehen«, unterbrach Joseph die friedvolle Stille, nachdem sie ihr Ritual beendet hatten. »Der Zirkel wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Vermutlich haben die das sowieso so eingefädelt. Wie hätte das sonst Rosalie sehen können, Mum? Du weißt, ich lüge dich nicht an!« Tyrese sah – nicht gerade sehr überzeugend – ihrem Sohn tief in die Augen und bat ihn, die Sache einfach zu vergessen. Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn, stand auf und ging zurück ins Haus. Es war genug für heute.
3
In der Kleinstadt, Rosalies neuem Heimatort, war es bereits dunkel geworden. Der Nebel versperrte die Sicht auf die Häuser und Straßen, sodass man auf jeden einzelnen Schritt aufpassen musste, den man machte. In einer Nebengasse am Stadtrand war ein kleiner Imbiss, den ein etwas älterer Mann in Schuss hielt. Harry war zu jedem freundlich. Er war alleinstehend und hatte den Tod seiner Frau noch immer nicht überwunden. Ob er das jemals konnte? Harry lachte viel. Vielleicht auch eine Art, den Schmerz zu überwinden. An diesem Abend war er gerade dabei, seinen Laden abzuschließen, als sich drei junge Kerle von hinten an ihn heranschlichen. Es war so dunkel, sodass man keine Gesichter erkennen konnte. Zudem trugen sie Kapuzen über ihren Köpfen. Einer von ihnen hatte einen Baseballschläger in der Hand. Offensichtlich hatten sie vor, den Imbiss auszurauben. Sie überwältigten Harry, als er gerade den Schlüssel im Türschloss umdrehte. Der ältere Mann hatte keine Chance, sich mit seiner etwas übergewichtigen Statur gegen die jungen Kerle zu wehren. Trotz aller Aussichtslosigkeit schimpfte Harry lauthals und rief nach Hilfe. Als hätte er jemals eine Chance gehabt … Einer der Dreien schlug mit dem Baseballschläger auf ihn ein, worauf Harry im selben Augenblick sein Bewusstsein verlor und zu Boden fiel. Regungslos blieb er liegen. »Lass uns den Laden auseinandernehmen!«, befahl Jason, der Anführer der Gruppe, seinen Freunden. Mit dem Baseballschläger zerbrach er die Glasscheibe der Eingangstür in nur wenigen Sekunden, dafür war keine besondere Anstrengung nötig. Harry hatte nie viel Geld zur Verfügung, dementsprechend qualitativ minderwertig war die Eingangstür. Schadenfreudig jauchzten die drei Kerle und machten sich über den Laden her, als plötzlich bei der Eingangstür ein Schatten vorbeihuschte. Erschrocken fragte der Kleinste von allen: »Was war das?« Die anderen beiden nahmen das Huschen nicht wahr und kümmerten sich weiter um die Ausbeute. »Nun komm schon, Ralph, sei kein Muttersöhnchen und hilf uns, die Sachen einzupacken, sonst bleibst du nächstes Mal zu Hause bei Mami«, mahnte ihn Jason, jetzt besser das zu tun, was sie ausgemacht hatten. Und noch eher Ralph sich umdrehte und auf die beiden zuging, ergriff ihn von hinten aus der Finsternis ein Wesen in dunkler Gestalt und riss ihn aus dem Raum hinaus auf die Straße. Ralph schrie sich die Seele aus dem Leib, noch mehr, als er begriff, was hier gerade passiert war. Die beiden anderen, Jason und Ron, kauerten in der Ecke und starrten zitternd auf die noch immer offen stehende Tür. Es war außer ein wenig Nebel, der vorbeizog, nichts zu sehen. Von Ralph fehlte nun jede Spur. Keine Geräusche waren zu hören, als wäre er regelrecht vom Erdboden verschluckt worden. Ron hatte sich mittlerweile aus Angst in die Hose gemacht. Falls sie das überleben sollten, schworen sie sich, nie wieder einen Einbruch zu begehen. Von der Angst gezeichnet, krochen sie langsam Richtung Ausgang, als plötzlich erneut etwas vorbeihuschte. Eine dunkle Silhouette. »Da! Da ist noch ein Zweiter!«, flüsterte Jason Ron zu, der sich die Augen zuhielt. Als sie um ihr Leben laufen wollten, versperrten zwei große, schlanke Gestalten den beiden den Ausgang – Gerrit und Cayden. Sie gehörten dem heißblütigen Element an
– dem Feuer.
Ihre schwarzen Pupillen verwandelten sich in ein stechendes Feuerrot. Sie waren wunderschön und ehrfürchtig zugleich. Ihre Haut war kreidebleich und ihre Haarfarbe tiefschwarz. Man konnte fast meinen, jedes einzelne Haar lag sorgsam an seinem vorgesehenen Platz. Die Wesen des Elementes Feuer waren eitel, gnadenlos, hatten einen scharfen Geist und einen durchdringenden Blick. Ihnen war es im Handumdrehen möglich, ein Feuer zu entfachen, wenn sie es wollten. Ihren Platz hier auf der Erde hatten sie einst eingenommen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wo auch immer Unrecht geschah, war es ihre Aufgabe, sich der Sache anzunehmen und Frieden zu stiften. Sie waren die Wächter der Gerechtigkeit. »Na, was machen diese zwei kleinen Biester hier nachts in der Stadt?«, fragte Cayden in den Raum. »Habt ihr euch zufällig verlaufen?«, fragte Gerrit, indem er sie musterte. »Hier kann es sehr gefährlich werden für so kleine Klugscheißer, wie ihr es seid. Für solche, die meinen, Menschen Schaden zufügen zu müssen!« Cayden sah heute nicht so aus, als wolle er die Jungs bloß zurechtweisen, so wie es das Gesetz eben vorsah. Dieser Grundsatz beinhaltete nämlich, dass es nicht erlaubt war zu töten. Dieses Privileg war nur dem Zirkel vorbehalten. Er war von seiner Wut so getrieben, dass sich seine Augen immer intensiver im Rot entfachten. Die beiden Jungs bekamen vor lauter Angst kein Wort heraus, ihre Stimmen versagten beim Versuch zu sprechen. Gerrit, der Vernünftigere von beiden, schritt langsam auf die beiden zusammenkauernden Jungs zu und sah ihnen direkt in die Augen. »Wenn ihr noch einmal auf eine solche Idee kommt, werdet ihr euch wünschen, diese Stadt niemals betreten zu haben. Habt ihr mich verstanden?« Caydens Hände zitterten vor lauter Zorn. Er hatte seine Wut kaum unter Kontrolle, doch er musste sich an die Regeln halten. Gerrit musste ihn festhalten, damit er den Jungs keinen Schaden zufügt. »Lauft! Und kommt nie mehr zurück!«, befahl ihnen Gerrit, bevor es böse mit ihnen geendet hätte. Jason und Ron rannten um ihr Leben. Keiner der beiden sah sich um, um nach Ralph Ausschau zu halten. »Du bist viel zu weich geworden, Gerrit! Wegen dir werden wir noch alle untergehen!« Cayden spähte auf die halb ausgeraubte Kassa und nahm sich ein Stück Brot, das auf der Theke lag. Er fand, dass es ihm nach seiner Rettungsaktion ehrenhaft zustand. Wut und Zorn waren die Antriebskräfte der Lemoren im Zeichen des Feuers. Zerstörung war ein wichtiger Teil des Gleichgewichtes. Ohne Schatten gab es nun einmal kein Licht und ohne Zerstörung keinen Wiederaufbau und Neuanfang.
Die Kraft nutzten sie, um für Ordnung zu sorgen. Sie waren die Gesetzeshüter dieses Planeten. Wo auch immer ein Mensch Schaden auf der Welt anrichtete, waren die Feuerelemente nicht weit davon entfernt. Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis sie zuschlugen. Niemand war vor ihnen sicher. Und das war zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes auch gut so. Sie sollten aber ihr wahres Ich niemals der Menschheit preisgeben, so wie Cayden es gemacht hatte, in dem er sich vor den Jungs mit der Kraft verband und ihnen seine Augen zeigte. In letzter Zeit war das öfters der Fall gewesen.
4
Immer mehr Menschen, die von übersinnlichen Begegnungen berichteten, wurden verwiesen. In der Stadt gab es keinen Platz für Geschichten über Geister und Fabelwesen. Niemand glaubte den betroffenen Menschen, sodass viele von ihnen aus Angst einfach nicht darüber sprachen. Jeder verdrängte es. Der Stadtrat war sich in dem Punkt einig: Wer dieses Thema aufkommen lässt, wird von der menschlichen Zivilisation weggesperrt. Mit allen Mitteln – ohne Wenn und Aber.
Gerrit hatte mittlerweile gelernt, mit seiner Wut umzugehen – im Gegensatz zu Cayden. Er hatte noch viele unkontrollierte Wutausbrüche und somit entfachte er auch des Öfteren ein ungewolltes Feuer. Das machte Gerrit wiederum manchmal Sorgen. »Machen wir uns auf den Nachhauseweg! Es ist schon spät und ich will heim – wir sind hier fertig.« Und noch in derselben Sekunde verschwanden sie spurlos und waren nicht mehr zu sehen. Sie konnten sich in Windeseile fortbewegen. So als gäbe es weder Raum noch Zeit. Es machte den Anschein, als müssten sie nur an einen Ort denken, an den sie hinwollten und der Körper folgte ihnen nach, wie eine Art Transformation über den Geist. Harry kam langsam wieder zu Bewusstsein. »Was ist passiert? Wo bin ich?« Fragend lag er in einem Scherbenhaufen. Genauer gesagt neben seiner zerbrochenen Tür, und versuchte krampfhaft, seine letzten Erinnerungen aufzurufen. Vergeblich. Ein Schmerz im Kopf ließ ihn aufschreien. Aus der Ferne waren bereits die Sirenen der Polizeiwägen zu hören. Die Uniformierten wurden wohl bereits von hellhörigen Nachbarn gerufen. So traf einer nach dem anderen am Unfallort ein. Ryan stieg aus einem der Einsatzfahrzeuge aus und lief direkt auf Harry zu. »Sir? Geht es Ihnen gut? Die Rettungskräfte sind gleich da.« Harry weigerte sich, in das Krankenhaus mitzufahren und winkte vehement ab. Er tat, als wäre alles nicht so schlimm, aber Ryan sah, dass es ihm alles andere als gut ging. »Kommen Sie! Fahren wir erst einmal in mein warmes Büro, ich mache Ihnen Tee«, schlug er Harry vor. Er half dem Mann in das Auto, den Rest erledigten seine Mitarbeiter. Ryan tat das, was er immer tat: Er brachte das Chaos in Ordnung und rief trotzdem die Rettung an. Für diesen Job wurde er wohl geboren. »Hier geht es mir ja besser als in meinem Imbiss, Officer!«, lächelte Harry und bemerkte zugleich, wie stark es im Kopf pochte und drückte dadurch schmerzhaft die Augen zusammen. »Ruhen Sie sich erst einmal aus!« Ryan wies seine Assistentin an, sich um den alten Herrn zu kümmern, denn es sollte ihm an nichts fehlen. Er bekam eine Decke als Umhang, warmen Tee und ein paar Kekse. Wie lange hatte er schon keine mehr gegessen, schwelgte Harry in Gedanken und dachte dabei an seine verstorbene Frau, die ihm jeden Abend ein paar Kekse gebracht hatte.
Er konnte sich an nichts mehr erinnern. »Sie mussten sehr weggetreten gewesen sein, Harry. Sie wurden überfallen. Von dem Täter fehlt jedoch noch jede Spur.« Harry versuchte sich krampfhaft an den Vorfall oder die letzten paar Stunden zu erinnern, aber da war nichts.
Im selben Augenblick ging die Eingangstür auf und Ryans Schwester betrat das Büro. »Rose? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Der Rettungsdienst sollte jeden Augenblick kommen, ich bin im Dienst«, erklärte ihr ihr Bruder etwas halbherzig und genervt. Der alte Mann wollte nicht in das Krankenhaus mitfahren, denn seine Versicherungsbeiträge waren längst überfällig. Er versuchte aufzustehen, aber noch ehe er sich ganz erhob, knickte er vor Schmerzen ein. An die Verletzungen seines Rückens konnte er sich wohl nicht mehr erinnern, die im Schockzustand kaum spürbar gewesen waren. Mit dieser Traurigkeit im Gesicht sah er wirklich alt aus. Der sonst so fröhliche Harry kauerte jetzt verbittert auf seinem Stuhl, blickte zu Boden und war sehr still geworden. Nicht einmal die wunderbaren Kekse konnten ihm ein Lächeln entlocken. »Ok, kein Problem. Ich warte zu Hause auf dich, Bro. Ich mache uns Essen«, versprach sie ihm und wollte gerade zur Tür hinaus, als zwei schöne Gestalten Rosalie den Weg hinaus versperrten. Es waren Gerrit und Cayden, die nun im Eingang vor ihr standen. Sie wollten sich versichern, dass es dem Mann gut ginge. Gerrit war mehr besorgt als Cayden, aber er tat es seinem Bruder zuliebe. »Guten Tag, junge Dame! Verzeihen Sie, dass wir Ihnen im Wege stehen. Wir kommen gerade aus der Kälte und wollten schnellstens in eine warme Räumlichkeit, da wir uns aus dem Haus gesperrt haben. Wir sind von nebenan«, stellte sich Gerrit mit seinem Bruder vor und reichte mir die Hand. Sein Atem fror noch von der Kälte, die langsam in der Stadt den Winter andeutete. Sie hatten irgendetwas Faszinierendes an sich. Cayden, etwas misstrauisch, reichte mir nur sehr widerwillig die Hand, als Gerrit ihm mit seinem Blick unmissverständlich zu verstehen gab, dass er jetzt besser das tat, was er ihm auftrug. Cayden antwortete nur, wenn er musste und blieb seines Bruders Willen freundlich. Von ihm aus könnten sie schon längst wieder zu Hause sein. »Es war sehr schön, Sie kennenzulernen«, entgegnete ich und lief von dannen. Ryan empfing die beiden Männer. Sie berichteten, dass sie den Vorfall gesehen hätten und gaben ihm hilfreiche Hinweise. Er schrieb ihre Namen auf, bedankte sich und begleitete Harry mit den Sanitätern zum Rettungswagen hinaus, die zum selben Zeitpunkt eintrafen. »Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann rufen Sie mich jederzeit an. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern«, versprach ihm Ryan, indem er ihm eine Visitenkarte mit seiner Privatnummer zusteckte. In Harrys Augen konnte man sehen, wie sich langsam Tränen bildeten. Er war es nicht gewohnt, dass jemand in seinem Leben so gut zu ihm war. Nicht in letzter Zeit.
Ryan beendete danach seinen Dienst und schickte auch seine Assistentin nach Hause. Er fuhr mit seinem alten Jeep in die Einfahrt seines Hauses. Es roch bereits vor der Haustür herrlich nach Abendessen. Er dachte dabei an Liv, seine Freundin. Es war kompliziert. Und eigentlich wusste er nicht einmal mehr, ob er sie als Freundin bezeichnen durfte. Ryan nahm seine Arbeit sehr ernst und somit war jede Beziehung oft schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Die Stadt zu schützen stand über allem. Auch über Liv. Er blieb einen Moment vor der Haustür stehen, seufzte und trat ein. Es war herrlich warm, der Ofen knisterte. »Kaum zu glauben, dass du auch für etwas nützlich bist«, lachte Ryan und freute sich über sein Lieblingsessen – Rührei mit Speck. Heute meinte ich es gut mit ihm und machte noch Salat dazu. »Was war das für ein Fall heute?«, fragte ich etwas neugierig. »Junge Lady, das interessiert dich doch sonst auch nicht? Hast du denn keine wichtigen Dinge, um die du dich kümmern solltest?« Mein Bruder verzog sein Gesicht und starrte in seinen Teller. »Irgendetwas ist hier sehr merkwürdig und ich … kann es einfach nicht benennen«, führte er nun das Gespräch von selbst fort. Dass es ihm Sorgen bereitete, hatte er weggelassen. Ich kannte aber meinen Bruder, also sah ich es an seinem Gesichtsausdruck. Mir konnte er jedenfalls nichts vormachen. Das funktionierte noch nie. »Wenn du Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest«, brachte ich humorvoll ein. »Alles klar, selbsternannter Officer, ich melde mich, wenn ich nicht mehr weiterkomme.« Ich räumte die Teller ab und ging nach oben auf mein Zimmer.
»Hi Mum und Dad!«, begann ich mit meiner furchtbar unleserlichen Schrift hinzukritzeln. Mehr stand noch nicht auf dem Blatt Papier, ich kam einfach nicht wirklich weiter. Ich wurde müde und legte den begonnenen Brief auf den Nachttisch. Ein schlechtes Gewissen überkam mich, weil ich ihnen nicht regelmäßig geschrieben hatte. Ich wusste nicht, was ich ihnen gerade erzählen sollte. Verlor ich die Verbindung zu ihnen? Was passiert hier mit mir? Ist es ein gutes Zeichen oder bin ich einfach nur eine sehr miserable Tochter? Dazu noch eine ganz miserable Freundin, wenn ich so an Liam denke. Irgendetwas verändert sich. Noch ehe ich über all dies nachdenken konnte, überkam mich eine Schwere. So deckte ich mich zu und schlief sofort ein.
5
Am nächsten Morgen klingelte unerwartet das Telefon. Ich nahm den Hörer ab. Es war Liam. Irgendwann musste er sich ja einmal melden. Ich hatte, seit ich weggegangen war, nichts mehr von mir hören lassen. »Hör zu, Rose, ich befürchte, irgendetwas läuft nicht mehr richtig mit uns beiden. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns nicht nur räumlich, sondern endgültig trennen, ohne dass wir noch weiter zusammen sind.« Die Realität wusste, wie sie mich mit Fausthieben zu Boden brachte. Sie nahm mir jedes Wort, das ich im Moment zu ihm sagen wollte. Ich hoffte in diesem Augenblick, dass es nur ein schrecklicher Traum war, von dem ich gleich aufwachen würde. Aber ich stand hier. In der traurigen Wirklichkeit. Mir lief lautlos eine Träne an der Wange entlang. Liam ging davon aus, dass es vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder funktionieren würde. Ich sagte ihm sehr kühl, dass es für mich keine halben Sachen gibt – entweder war man zusammen oder eben nicht. Wir wollten uns ja ursprünglich nur auf kurze Dauer räumlich trennen. Liam meinte daraufhin, dass wir uns dann besser ganz trennen sollten, wenn ich ihn jetzt vor diese Entscheidung stellte. Er konnte das im Moment einfach nicht beziehungsweise stellte er sich das anders vor. Die Vorstellung einer räumlichen Trennung bereitete ihm bereits Schwierigkeiten, bevor ich überhaupt hier angekommen war. In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass unsere Beziehung sowieso zum Scheitern verurteilt war, ganz egal, was er jetzt noch gesagt hätte. Liam ging trotzdem davon aus, dass es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder funktionieren würde. Auf die Frage, warum er sich jetzt plötzlich trennen wollte, obwohl wir ja einen Plan für die Zukunft hatten, so hatte er nicht einmal wirklich eine Antwort parat. In diesem Moment verlor ich den Halt in der Welt, quasi den Boden unter meinen Füßen. Es lief doch alles wunderbar. Welche Zeichen habe ich übersehen? Waren die erlebten vergangenen Jahre jetzt in vier Sätzen einfach so zu Ende? Wenn das die Vorstellung der Welt ist, dann würde ich gerne aussteigen, dachte ich mir für mich und legte wortlos den Hörer auf. Ich brach in mir auf dem Fußboden zusammen. Ein erneutes Klingeln. Ich saß barfuß auf dem kalten Fliesboden und versuchte die Welt zu verstehen. Ich musste hinaus. Eigentlich wollte ich zu einem späteren Zeitpunkt die Stadt weiter erkunden, aber das war jetzt alles andere als sinnvoll. Ich würde sowieso nichts wahrnehmen. Ich zog meine Jacke über und ging hinaus an die frische Luft. Das war das, was ich jetzt brauchte.
Ich lief über die Straßen Richtung Waldrand. Ich wollte allein sein mit mir und der Welt. Was läuft hier bloß nur so verkehrt? Muss tatsächlich immer irgendetwas schieflaufen? Bin ich so ein schlechter Mensch, dass es das Schicksal offensichtlich immer wieder schlecht mit mir meint und ich für etwas büßen muss?, dachte ich so vor mich hin, als ich dahinschlenderte. Tränen kullerten über meine Wangen. Ich lief unbeirrt in den Wald hinein. An einer Lichtung angekommen, machte ich Halt. Ich war völlig außer Atem und hatte wohl in Gedanken versunken gar nicht mitbekommen, wie weit und schnell ich schon gegangen war. Ich verlor völlig das Gefühl für Zeit und Raum. Ich konnte nichts fühlen. Einatmen. Ausatmen. Mehr nicht. Keinen Grund sich zu beeilen. Ich hatte Zeit. Ich schaute mich kurz um und setzte mich dann in das Gras. Im Hintergrund waren Waldtiere zu hören, die über Äste sprangen. Sonst nichts. Nicht einmal die Kälte fühlte ich von dem Frost, der sich schon auf den Gräsern festgesetzt hatte. Ich dachte an Liam und an unsere schöne gemeinsame Zeit. Bis vor ein paar Wochen war doch alles noch in Ordnung gewesen. Zumindest das. Und ehe man sich halbwegs von etwas erholt und wieder Fuß gefasst hatte, änderte sich plötzlich mein Leben. »Soll ich ihn noch einmal anrufen? Nein. War ich gemein? Nein. Es änderte sich nichts an der Tatsache, dass er nicht mehr will. Vielleicht muss das jetzt so sein, damit wir beide loslassen können. Vielleicht kommt jetzt ein völlig neues Kapitel auf mich zu«, flüsterte ich leise vor mich hin. Wer wusste schon, welchen guten Grund das Schicksal dieses Mal hatte. Wir lebten vorwärts, verstanden es aber rückwärts. Vielleicht mache ich mir aber auch zu viele Gedanken über das Leben und dessen Sinn darin. Das sagt man mir nach. Vielleicht sollte ich das wirklich weniger tun und wie die anderen meinem Alltag einfach nachgehen und nicht mehr so starr über meine Aufgaben darin nachdenken. Aber welchen Sinn hatte es dann? Einfach nur zu leben, ein Haus zu bauen? Kinder zu haben und dann zu sterben? Ist das der einzige Sinn auf der Welt? Irgendwie fühlt sich das alles leer an. Auch wenn das ein schönes Leben sein konnte, da muss es doch noch mehr geben, ratterte es in meinem Kopf.
In diesem Augenblick dachte ich an Lyria. Sie war meine beste Freundin. Mein Halt im Leben. Wir gehörten zusammen, wie Pech und Schwefel. Sie war es, die mich zu einem besseren Menschen machte. Ja, Lyria. Ich konnte sie jetzt in meinen Gedanken hören, was sie jetzt sagen würde, wäre sie da. Sie würde jetzt das tun, was eine beste Freundin tun würde. Den halben Eisladen mitbringen und sich zu mir hersetzen. Zusammen schweigen, solange ich das eben brauchte. Ihr musste ich mich nie groß erklären. Wir verstanden uns blind. Mit ihr zusammen in der Stille zu sitzen, war eines der schönsten Dinge im Leben. Für einen Moment lang war dann die Welt wieder in Ordnung. Ich vermisste sie. Zuhause würde ich ihr einen langen Brief schreiben. Ich hoffte, dass sie mich bald besuchen kommen würde. Ich hatte hier in der Stadt sowieso nicht den Eindruck, große Freundschaften knüpfen zu können. Ich war eben nun einmal anders. Sie war jetzt wohl das Einzige, das mir aus meinem alten Leben blieb. Ein kleines Lächeln huschte über mein Gesicht, als ich an unsere gemeinsamen Erlebnisse dachte. Plötzlich wurde die Stille durch einen Schrei in der Ferne unterbrochen, ich erschrak. Mit einem Schlag war mein Gedankenausflug weg und ich blickte in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Ich konnte nur verschwommen sehen, dass es sich wohl um zwei Frauengestalten handelte. Durch die Äste blickend versuchte ich wahrzunehmen, was hier vor sich ging. Ein Feuer war zu sehen, das plötzlich den Weg der hinterherlaufenden Person versperrte. Wieder ein Schrei. »Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen?«, fragte ich laut, als wäre sonst noch jemand da. Ich rieb meine Augen und zweifelte an meiner Wahrnehmung. »Wo kam das plötzlich her?« Ich beschloss, in dieselbe Richtung zu laufen. Ich rannte schon immer in die Gefahr hinein als davon. »Hey!«, rief ich mit aller Kraft, die meine Stimme aufbringen konnte. Von meinem Anblick erschrocken, schauten die beiden in meine Richtung. Das Feuer verschwand daraufhin in das Nichts und so auch die beiden Gestalten. Ich starrte noch immer auf die wohl verlassene Bühnenaufführung und konnte meinen Augen nicht trauen. Ich glaubte, langsam wirklich verrückt zu werden, zweifellos. Einen Moment hielt ich inne, schüttelte den Kopf und als ich mich umdrehte, um wieder nach Hause zu gehen, versperrte mir ein junger Mann den Weg. Er stand direkt vor mir und sah mir in die Augen. Es war
– Vincent.
Für einen Moment lang stand die Erde still. In diesem Augenblick gingen mir Tausende Gedanken durch den Kopf und doch keiner, der sich wirklich fassen ließ. Mein Körper fror und gleichzeitig schoss eine Hitze durch meine Adern. Ich spürte eine Spannung, die nicht auszuhalten war und gleichzeitig wusste ich nicht, wie ich vor dieser schönen Gestalt weglaufen konnte. Noch immer mit offenem Mund staunend, entkam ihm währenddessen ein kleines, leises »Hallo«. Es war so intensiv und doch nicht besonders freundlich, sondern eher kühl und musternd. Vincent hatte eine schmale, große Positur. Seine Haare waren schwarz wie die Nacht und er hatte die schönsten Augen, die ich bisher je gesehen hatte. Sie waren sehr dunkel, fast schon schwarz. Ich schämte mich allein schon für den Gedanken, da ich noch vor einigen Augenblicken um Liam geweint habe. Es durfte nicht sein, dass mir jetzt schon ein anderer Mann gefiel. Doch in seiner Anwesenheit war Liam aus meinen Gedanken verschwunden. Er war faszinierend und irgendwie beängstigend zugleich und daher für mich schwer einzuschätzen. Ich versuchte, freundlich zu grüßen, aber mehr als ein gestottertes Krächzen entkam mir wohl nicht. Woher kommt er? Wohin geht er? Wer ist er? Es gingen mir Hunderte Fragen durch den Kopf, doch bevor ich eine stellen konnte, lief er einfach, ohne sich zu verabschieden, davon. »Hey warte!« Schnaubend rannte ich ihm hinterher. Nur sehr widerwillig drehte er sich um und sah mich etwas genervt an. »Wer bist du?«, erkundigte ich mich bei ihm etwas verstört, aber ich ließ nicht locker und lief weiter neben ihm her. Ich konnte mit seinen langen, schnellen Schritten kaum mithalten, aber so einfach gab ich nicht auf. Nach ein paar Momenten des Schweigens, die sich wie eine peinliche Ewigkeit angefühlt hatten, stammelte er leise, ohne mir in die Augen zu sehen, vor sich hin: »Vincent«. Ich war überrascht. Sofort traf mich sein außergewöhnlich schöner Name wie ein Blitz. »Das freut mich … sehr. Ich bin Rosalie. Was machst du hier?«, versuchte ich weitere Informationen über ihn zu sammeln. »Das geht dich nichts an!« Seine Worte knallte er mir beinhart in das Gesicht. Erneut wirkte er unfreundlich und lief weiter vor sich her, ohne ein bisschen langsamer zu werden oder den Anschein zu machen, weiteres Interesse an einem Gespräch zu haben. Schließlich gab ich es auf, wurde immer langsamer und blieb irgendwann stehen. Ich sah ihm noch lange nach, wie er die Wiese am Waldrand entlangging, bis ich eine Frau weiter unten entdeckte, die offensichtlich auf ihn wartete. »Kommst du endlich? Wir haben sie abgehängt!«, rief sie ihm triumphierend zu. Na gut, diese Art von Abfuhr hatte ich jetzt verstanden. Ich wollte diesen Mann eigentlich nie wieder sehen. Schweigend und wie ferngesteuert machte ich kehrt und schlenderte nach Hause.
Daheim angekommen, machte ich mir Tee. Ich konnte Tee normalerweise nicht ausstehen. Ich bereitete ihn meist für Ryan zu, wenn er uns besuchte. Ihm zuliebe trank ich ihn auch ab und an, damit er mit seinen ewigen Gesundheitsvorträgen aufhörte. Doch jetzt brauchte ich den Tee, um mich zu beruhigen oder es mir zumindest einzubilden. Ryan war wohl noch immer im Dienst, er sollte eigentlich schon längst zu Hause sein. Irgendwie konnte ich keinen klaren Gedanken fassen, aber ich war eigentlich auch zu müde, um nachzudenken. Ich saß mit meiner heißen Tasse Tee auf der Couch und versuchte erneut, meine Gedanken zu ordnen. In dem Moment klingelte das Telefon. Mein Bruder meldete sich und meinte: »Es wird heute wohl später. Wir sind auf einer heißen Spur, was den Überfall in Harrys Laden angeht. Warte besser nicht auf mich und pass auf dich auf Kleine, ja?« Erfreut über die Nachrichten, hielt ich das Gespräch kurz. »Geht klar, Boss. Bis dann.« Ich brauchte jetzt die Stille. Sie hat mir schon immer geholfen. In schwierigen Momenten war ich am liebsten allein. Ich dachte an das gesehene Feuer. An Vincent. Hier passierte innerhalb eines Vormittages mehr als in einem halben Jahr in meiner alten Heimat. Meine Tasse haltend beruhigte ich mich und merkte, dass mein Inhalt wohl langsam schon kalt geworden war. Ich stellte die Tasse auf den kleinen Tisch und machte die Augen zu, als es an der Tür klingelte. Als ich sie öffnete, erkannte ich ein bekanntes Gesicht. »Joseph?«, fragte ich etwas überrascht. In dem Moment wusste ich für mich selbst noch nicht, ob ich mich über seinen Besuch freuen sollte oder ob es mich jetzt gerade nervte. Ich war nicht besonders gut darin, neue Menschen kennenzulernen, aber Joseph hatte irgendwie etwas Freundliches an sich. Man konnte ihn einfach nicht abweisen. »Ich habe dir einen Stapel Papierkram mitgebracht: Stadtplan, Busfahrkarte und was man hier alles so braucht, wenn man neu in der Stadt ist.« Ich war erstaunt über die Aufmerksamkeit, die er mir entgegenbrachte. Das war ich aus meinem alten Zuhause nicht gewohnt. Da interessierte es den einen nicht, was der andere tat. Kaum einer wusste nicht einmal den Namen des anderen, geschweige denn den seines Nachbarn. Ich lächelte, bedankte mich bei ihm und sah auf den Stapel, den ich nun in der Hand hielt. Zufrieden nickte er, lief die Ausfahrt hinaus und drehte sich noch einmal kurz um. »Rosalie? Hast du vielleicht mal Lust, etwas mit mir zu unternehmen?« Irgendwie erschrak ich aufgrund dieser Frage. Angesichts der Tatsache, dass Joseph absolut nicht mein Typ war, erwiderte ich dennoch überraschenderweise sein Angebot. »Okay, ja!« Offensichtlich freute er sich darüber, winkte mir zu und lief von dannen. »Als Freunde!«, rief er mir noch zu, als ich gerade zurück in das Haus ging und die Tür schließen wollte. »Geht klar!«, rief ich zurück und schmunzelte etwas peinlich berührt. Es beruhigte mich aber unheimlich, denn ich hatte absolut keine Lust auf ein Date. Ein weiteres Problem konnte ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Erst als die Eingangstür hinter mir zuging, fiel mir auf, dass Joseph nun gar keine goldleuchtenden Augen hatte, sondern ganz normal dunkelbraune Augäpfel. Wahrscheinlich war ich mit den vielen Eindrücken wohl nur überfordert, sodass ich mir Dinge schlichtweg einbildete. Ich glaube, ich habe das einmal irgendwo gelesen, dass es das tatsächlich gibt. Das muss irgendwie vom Gehirn ausgehen, erinnerte ich mich an einen kürzlich gelesenen Bericht. Ich beschloss, morgen zu einem Arzt zu gehen, so konnte es jedenfalls nicht mehr weitergehen. Mit diesem Gedanken beruhigte ich mich und schlief friedlich und ruhig ein.
6
»Sie sind kerngesund, junge Dame!« Musternd, aber zufrieden leuchtete unser Stadtarzt in meinen Augen herum, konnte aber nichts Abweichendes feststellen, das auf eine Krankheit hinwies. »Leiden Sie unter ständigem Stress, Kummer oder Sorgen? Das kann unseren Organismus kurz- oder langfristig aus der Bahn werfen. Organisch sind Sie gesund, ich konnte nichts weiter feststellen«, fuhr er fort. Er kramte in seiner Schublade, um einen Rezeptblock hervorzuholen und machte den Eindruck, als erwartete er sowieso keine Gegenreaktion. In der üblichen unleserlichen »Doktorhandschrift« kritzelte er ein Rezept für mich hin. »Hier! Holen Sie diese Tabletten aus der Stadtapotheke. Die nehmen Sie dann zwei Mal täglich mit ein wenig Flüssigkeit ein, bis es Ihnen wieder besser geht! Ansonsten kommen Sie wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« So schnell verabschiedete er sich von mir, noch ehe ich irgendetwas dazu sagen konnte. Sprachlos saß ich immer noch da. Zielstrebig verließ Dr. Phanell das Behandlungszimmer. Als die Tür aufging, sah ich eine Reihe an vergrämten Patienten, die schon ungeduldig auf ihren Aufruf warteten. Ich wollte so schnell als möglich weg, der Geruch in der Praxis allein bereitete mir schon Kopfschmerzen. Draußen an der frischen Luft atmete ich tief ein. Wie herrlich kalt die Luft war, so rein und klar. Seufzend sah ich auf mein Rezept, knüllte es zusammen und warf es in den nächsten Mülleimer. Ich machte mich auf den Weg zu Ryans Haus. Als ich am nächsten Briefkasten vorbeikam, machte sich mein schlechtes Gewissen bemerkbar, meinen Eltern nicht mehr geschrieben zu haben. Nagende Gedanken begleiteten mich, bis ich schließlich in die Einfahrt einbog. Joseph bog von der anderen Straßenseite aus in meine Richtung ein und wie immer hatte er ein wunderbares Lächeln aufgesetzt. »Na, Frau Nachbarin? Lust auf einen Spaziergang Richtung Wald? Ich muss für meine Mutter irgendwelche Kräuter sammeln. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mit mir mitkommen, vorausgesetzt du bist für spontane Abenteuer zu haben.« Ich überlegte, was hier der Begriff »Nachbar« bedeutete, denn man ging schon einige Meter bis zu seinem Wohnhaus. Hier war eben alles anders. Ein Nachbar ist bei uns jemand, der direkt nebenan wohnt. Etwas überfordert mit der Frage, lehnte ich sein Angebot jedoch ab. »Nein danke. Ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen, aber gerne ein anderes Mal. Wir werden uns hier ja öfters sehen.« Ich hatte jetzt einfach das Bedürfnis, meinen Eltern zu schreiben. Irgendwie hatte ich Angst, sonst den Draht zu ihnen zu verlieren. »Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dir so ein kleiner Ausflug in die Natur auch ganz guttun würde«, konterte Joseph unnachgiebig, während seine wunderschönen dunkelbraunen Rehaugen direkt in meine Richtung blickten. Wie konnte man diesen auch nur widerstehen … »Also gut, überredet. Aber nicht zu lange. Bis Sonnenuntergang möchte ich zurück sein, ich habe wirklich noch zu tun.« Erfreut über meine Einwilligung wollte er keine Minute verstreichen lassen, um loszugehen, bevor ich es mir wieder anders überlegte. Joseph sollte eigentlich keinen engen Kontakt zu den Menschen pflegen, da dies die Gefahr mitbrachte, dass sie Kenntnis von der Existenz der Lemoren erlangen. Dennoch konnte er sich nicht wirklich von mir fernhalten. Er wusste um den Verstoß, den es über kurz oder lang mit sich bringen würde, aber es interessierte ihn keinesfalls. Im Moment hatte er ja noch nichts Falsches gemacht. Er würde das Geheimnis trotzdem gut wahren können. Was sollte auch schon groß passieren? Seine Mutter war nicht zu Hause. Also wen sollte es schon kümmern? Die Ältesten vom Zirkel waren schon lange nicht mehr gesehen worden. Vielleicht hatte sich auch zwischenzeitlich Vieles geändert. Man wusste es ja nicht.
Wir verließen unsere kleine Ortschaft und schlenderten langsam in den nächstgelegenen Wald, in dem Joseph während unserer Gespräche immer wieder Ausschau nach den Kräutern hielt. Ich mochte seine Anwesenheit. Er war sehr hilfsbereit, hörte zu. Er war genau das, was ich jetzt brauchte – ein Freund. »Sag einmal, wofür braucht deine Mutter eigentlich die Kräuter?«, erkundigte ich mich neugierig. »Für Heilungen«, schoss es mir aus seinem Mund entgegen, ohne den Blick von der Suche abzurichten. »Hier. Ich habe sie gefunden. Sie wachsen äußerst selten und nur unter bestimmten Voraussetzungen.« Fröhlich und erfreut zugleich zog er sein Messer aus der Hosentasche und erntete behutsam seine ersehnte Errungenschaft. Anschließend faltete er die Hände zusammen, schloss seine Augen und schien sich nicht von meiner Gegenwart beirren zu lassen, einen Augenblick lang in dieser Position zu verweilen. »Was machst du denn da Seltsames?« Fragend blickte ich ihn an, aber es hatte nicht den Anschein, als hätte er es eilig, mir meine Frage zu beantworten. Seine Augen verfärbten sich kurzzeitig zu einem wunderschönen, goldigen Schimmer. Das war jedoch für mich nicht zu erkennen, denn seine Augenlider blieben während seines Rituals geschlossen. Als er sie öffnete, hatten sie sich bereits wieder in ihr ursprüngliches Braun zurückverwandelt. Er sagte nichts.
Wir gingen nebeneinander weiter, bis er schließlich die Stille durchbrach. »Wir danken der Erde für alles, was sie uns gibt«, lächelte Joseph etwas verlegen und schaute dabei zu Boden. »Aha!? Okay Joseph, sowas ist mir neu …«, aber während ich es aussprach, spürte ich innerlich ein Gefühl, das alles andere als fremd war. »Aber wen meinst du eigentlich mit ,wir‘?« Ich war selbst über mein wirkliches Interesse überrascht. Die letzten Monate meines Lebens waren von so viel Unglück geprägt, dass irgendwie ein Teil meiner Lebensfreude dabei verloren ging. Ich lebte so dahin, Tag für Tag, wie eine Art Gestalt oder leere Hülle. Es war nicht so, dass ich in mir eine Sehnsucht verspürte zu sterben, aber wäre mein Leben plötzlich vorbei gewesen, so hätte ich keinen Widerstand geleistet. »Unsere ganze Familie. Wir sind zum Heilen geboren und gehören zu …«. Noch bevor Joseph den Satz fertig aussprach, unterbrach er sich selbst, weil ihm bewusst wurde, dass er sich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Er beschloss, kein Wort mehr darüber zu verlieren, denn es war bereits zu viel gesagt worden und er bedachte die Konsequenzen. Es fühlte sich alles so vertraut an. »Du meinst also so ein Hokuspokus-Firlefanz?«, fragte ich lächelnd, aber dieses Gefühl hatte etwas Warmes, obwohl ich mich darüber lustig machte. Manche Dinge konnte man sich einfach nicht erklären. Tief in mir drinnen fühlte ich, dass es etwas gab, das über uns stand, wie auch immer man das nennen mochte. Dennoch hatte ich bisher in meinem Leben nicht sehr viel mit solchen Dingen zu tun gehabt. »Genau so ein Firlefanz!«, versuchte er das Gespräch humorvoll zu beenden, um so keine weiteren Fragen darüber beantworten zu müssen, und lenkte das weitere Gespräch in eine völlig neue Richtung. Er fragte mich, warum ich hierhergezogen bin und was mich dazu veranlasste, meine Heimatstadt hinter mir zu lassen. Als Antwort gab ich ihm meinen Bruder an, dass ich eine Auszeit brauchte und hier einige Zeit verbringen wollte. »Und deine Eltern ließen dich einfach so gehen? Du bist doch noch sehr jung«, sagte er nun etwas besorgt. Ich versuchte schnell davon abzulenken, da mir seine Fragen sehr unangenehm wurden und antwortete mit einem knappen »Äh ja.« Er nickte. Auf unser Gespräch folgte wieder Schweigen. Das machte mir aber nichts aus. Seine Gegenwart allein war sehr angenehm und mit ihm war alles auf eine Art friedlich. Auf dem Heimweg erzählte Joseph von seiner heimlichen Liebe, insofern man es so nennen konnte. Die besagte »Dame« wusste nichts von ihrem Glück. Noch nicht wirklich. Ich fühlte mich geehrt, dass er es mir erzählt hatte und er mir offensichtlich vertraute. Obwohl ich nur freundschaftliche Gefühle für Joseph hegte, war es eine Erleichterung, dass auch er so für mich empfand. Das entspannte die ganze Situation enorm, was mich dazu bewegte, meinen Arm bei ihm einzuhängen und seine Anwesenheit einfach zu genießen. Einmal nicht nachdenken oder reden zu müssen. Ich hatte ihn jetzt schon in mein Herz geschlossen, ich konnte gar nicht anders. »Wer auch immer einmal an deiner Seite landet, hat in seinem Leben einen echten Glücksgriff gemacht!«, sagte ich nicht nur so dahin, sondern meinte es auch. Er war zu gut für diese Welt. Wenn man im Leben sehr viele Schatten durchleben musste, dann fiel einem so ein Sternchen wie Joseph sofort ins Auge. Zu schade, dass er nicht auf meiner Wellenlänge war. Man konnte so etwas nicht erzwingen, das war einfach da oder eben nicht. Ich war dankbar dafür, dass ich ihn zu meinen Freunden zählen durfte. Das allein schätzte ich schon enorm und es entstand ein kleines Lächeln in meinem Gesicht. »Wie heißt denn eigentlich deine Auserwählte, von der wir seit einer gefühlten Ewigkeit sprechen? Und warum weiß sie nichts von deinen Gefühlen zu ihr?«, hakte ich jetzt bei ihm nach, als ich merkte, dass er nichts mehr weiter darüber erzählte. Sein Blick fiel sofort wieder zu Boden. Er wurde etwas nervös. »Seraphine. Das ist schwierig. Meine Eltern stehen da etwas im Weg. Sie würden sich für mich einfach eine andere wünschen«, erklärte er nur äußerst widerwillig. Es roch förmlich nach einer Halbwahrheit, ich konnte es sofort fühlen. Ich hatte keinerlei Beweise für eine Lüge, aber innerlich wusste ich es einfach, wenn man mich belog. Dennoch. Er war mein neuer Freund und ich hatte kein Recht dazu, ihn zu zwingen, mir die ganze Wahrheit zu sagen. Vielleicht würde er es mir eines Tages von selbst erzählen. Ich wollte, dass er mir vertraut und beschloss daraufhin, ihn in seiner Komfortzone zu lassen. Ich gab mich für das Erste zufrieden und heiterte ihn mit ein paar lieben Worten auf. Wenn etwas im Leben sein soll, dann findet das Schicksal einen Weg. Dieses Gefühl trug ich schon immer in mir. Menschen, die zusammengehörten, fanden immer zusammen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. In diesem Augenblick dachte ich an Vincent und an seine vollkommene Schönheit. Aber damit meinte ich nicht nur sein Äußeres, es war vielmehr das, was er ausstrahlte. Ich konnte seinem ganzen Wesen einfach nicht widerstehen. Seine äußerliche Schönheit war einfach nur eine Zugabe, seinem wunderbaren Inneren ein passendes Kleid zu geben. Noch in dem Gedanken versunken, unterbrach mich Joseph. »Was ist mit dir? Hast du jemanden?«





























