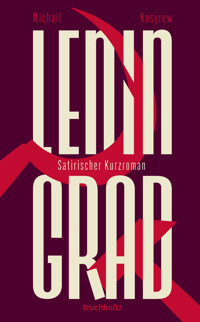
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem neu zu entdeckenden Roman gerät der namenlose Ich-Erzähler vom Anfang des 20. Jahrhunderts durch eine Zeitreise in das ihm fremde Leningrad der 1950er-Jahre. Allerdings hat er den Weltkrieg ebenso »verschlafen« wie die Russische Revolution. Dadurch fällt sein Vergleich der »alten« Zeit mit der fiktiven Gegenwart der 50er-Jahre besonders deutlich aus. Er bewegt sich wie ein Fremder im eigenen Land, in dem der Bestohlene aufgrund ihres »Reichtums« verurteilt werden und Diebe aufgrund ihres proletarischen Hintergrundes straffrei bleiben. Vor dem Auge des Lesers entsteht das Zerrbild einer zukünftigen Gesellschaft, das damals im Entstehen war und bis heute in eine beängstigende Gegenwart Russlands hinein wirkt: Die Presse existiert lediglich zu Propagandazwecken, die Kultur ist zensiert und uniformiert, die Gesellschaft ist auf Lüge und Doppelmoral aufgebaut, und die Menschen versuchen, in dieser »verkehrten Welt« jeder auf seine Weise und nach seinem Verstand zurechtzukommen. Mit Leningrad hat Michail Kosyrew vor genau100 Jahren einen bemerkenswerten negativen Staatsroman und zugleich einen prophetischen Text verfasst. Er geriet ab Mitte der 1920er-Jahre ins Visier der Kulturpolitik, in den 1930er-Jahren wurde er seiner Publikationsmöglichkeit beraubt, und 1942 starb er in Haft in Saratow an der Wolga, vermutlich in einem Gefängnishospital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LENINGRAD
Michail Kosyrew
LENINGRAD
Satirischer Kurzroman
Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von Michael Düring
Inhalt
Vorwort
Erstes KapitelEINFÜHRUNG. MEINE BIOGRAPHIE
Zweites KapitelDie Katastrophe
Drittes KapitelLENINGRAD
Viertes KapitelEine unverhoffte Erkenntnis
Fünftes KapitelVor Gericht
Sechstes KapitelIch stehe auf der Schwelle zur Glückseligkeit
Siebtes KapitelDie Stadt lernt mich kennen
Achtes KapitelIch lerne die Stadt kennen
Neuntes KapitelNeue Bekanntschaften
Zehntes KapitelWohnung Nummer Neun
Elftes KapitelMeine Enttäuschung beginnt
Zwölftes KapitelDer Vorschlag
Dreizehntes KapitelSie heißt Mary
Vierzehntes KapitelIch erlebe unangenehme Minuten
Fünfzehntes KapitelIch weigere mich, etwas zu verstehen
Sechzehntes KapitelIch spreche mit dem Zensor
Siebzehntes KapitelIch beginne zu verstehen
Achtzehntes KapitelIch erreiche die höchste Stufe der Weisheit
Neunzehntes KapitelAn der Universität
Zwanzigstes KapitelIch besuche Mary auch weiterhin
Einundzwanzigstes KapitelIch beginne zu handeln
Zweiundzwanzigstes KapitelDie Presse stürzt sich auf mich
Dreiundzwanzigstes KapitelDie Strafe
Vierundzwanzigstes KapitelIch arbeite in der Fabrik
Fünfundzwanzigstes KapitelStellvertreter
Sechsundzwanzigstes KapitelDie ersten Schritte
Siebenundzwanzigstes KapitelDas Unglück
Achtundzwanzigstes KapitelEine allgemeine Versammlung
Neunundzwanzigstes KapitelIch spreche mit dem Philosophen
Dreißigstes KapitelAm Vorabend
Einunddreißigstes KapitelMary
Zweiunddreißigstes und letztes KapitelDer erste Mai
Anhang
Die ›verkehrte Welt‹ Michail Kozyrevs: Anmerkungen zu einer unbeachteten frühsowjetischen Dystopie
Über den Autor
Über den Herausgeber
Vorwort
Vor kurzem verstarb in der psychiatrischen Anstalt nahe der Station Udelnaja 1 ein merkwürdiger Patient. Er war im Jahre 1913 2 aus dem Wyborger Gefängniskrankenhaus 3 eingeliefert worden: Offensichtlich war er während einer Maidemonstration 4 in ein Handgemenge und dann unter ein Pferd geraten. Im Krankenhaus hatte sich gezeigt, dass mit zunehmender Besserung der physischen Konstitution des Patienten dessen geistige mehr und mehr abnahm. Einige Jahre lang hatte er auf seinem Bett gelegen, war nur im äußersten Notfall aufgewacht und hatte auf alle Fragen nur geantwortet:
»Ich bin tot. Weckt mich nicht.«
Doch dann kam es zu einer bemerkenswerten Verbesserung seines Zustands. Er ging durch die Krankenzimmer, sprach wie ein ganz normaler Mensch, las Zeitungen und Bücher. In diesen Momenten konnte man seine Verrücktheit nur noch daran erkennen, dass er auf die Frage »Welches Jahr haben wir?« antwortete:
»Neunzehnhunderteinundfünfzig.«
Diese Zwangsvorstellung ließ ihn nicht eine Minute los. In seinem Wahn begann er sogar mit unbeseelten Gegenständen zu reden, gab ihnen merkwürdige Namen, prägte sich Absätze eines Lehrbuches ein, die mit nichts in Einklang zu bringen waren, obwohl er gar kein Buch in der Hand hielt, und trug Anklage- und Verteidigungsplädoyers vor. Manchmal schien es ihm, als verfolge ihn jemand, dass man über ihn zu Gericht sitze, dass man ihn zum Tode verurteile.
Schließlich gewährte man ihm einige Freiheiten, man erlaubte ihm sogar, auf die Straße hinauszugehen. Er nutzte diese Möglichkeit stets zum Besuch ein- und derselben Orte und kehrte pünktlich zur festgelegten Stunde in die Klinik zurück. Seine Lieblingsplätze waren der Lesnoj Park 5, der Sampson-Prospekt 6 und der Trojckij-Platz 7. Er hielt es zudem für seine Pflicht, sich an politischen Kundgebungen zu beteiligen sowie an Vorlesungen und Aufführungen im Arbeiterklub teilzunehmen. Wenn ihn irgendein Anwesender ansprach, gab er einleuchtende, logische Antworten, musste sich aber stets bekreuzigen, wenn er an den Porträts der Führer der Revolution vorbeikam. Diese Porträts nannte er Ikonen. Alle Ereignisse des Alltags verfolgte er mit außerordentlicher Aufmerksamkeit, beurteilte sie jedoch auf äußerst ungewöhnliche Weise.
Etwa zwei Wochen vor seinem Tod bat er um Tinte und Papier und schrieb ohne Pause Tag und Nacht, ohne dass er sein Krankenzimmer für eine Minute verließ oder mit irgendjemandem sprach. Seine Aufzeichnungen kamen der Klinikadministration verdächtig vor und wären zweifelsfrei vernichtet worden, wenn sie nicht zufällig in die Hände des Autors dieser Zeilen gelangt wären.8
Von einigen Stellen abgesehen, verstoßen diese Aufzeichnungen nicht gegen die Gesetze der Logik und den gesunden Menschenverstand, und ich denke, dass sie für den zeitgenössischen Leser durchaus von Interesse sind.
Michail Kosyrew
Moskau, 3. Oktober 1925
1 Heute eine Station der seit 1955 in Petersburg fahrenden Metro, zu Zeiten Kosyrews aber auch schon Verkehrsknotenpunkt, etwa 15 Kilometer nördlich vom Zentrum gelegen. Unmittelbar an der Station, von der hier die Rede ist, befindet sich das Psychiatrische Krankenhaus Nummer 3, gegründet 1870 und seit 1931 den Namen I. I. Skworzow-Stepanows (1870–1928) tragend, der im November 1917 für vier Tage erster Volkskommissar für Finanzen gewesen war. Skworzow-Stepanow ist eine für die Sowjetgeschichte nicht unbedeutende Person, was daran erkennbar wird, dass man ihn an der Kremlmauer beerdigte.
2 Damit ist ein expliziter Zeithinweis gegeben – das Vorwort als Beglaubigungstopos verweist auf das Jahr 1913, der namenlose Patient wird also vier Jahre vor der historisch nachweisbaren Oktoberrevolution in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Maidemonstration, während derer der Patient verletzt wird, scheint aber bereits früher stattgefunden zu haben, denn anders ist nicht zu erklären, dass später davon die Rede ist (vgl. Fußnote 42), dass »vor vierzig Jahren« eine proletarische Revolution stattgefunden habe.
3 Vermutlich das an der ›Arsenalnaja nabereschnjaja‹ liegende, zu Zeiten Katharinas II. (1729–1796) errichtete Gefängnis ›Kresty‹, das seinen Namen (›Kreuze‹) seiner Form verdankt. In den 1930er- und 1940er-Jahren war das Gefängnis berüchtigt, viele der damals dort Inhaftierten verschwanden spurlos. Ob dieses Gefängnis gemeint ist, bleibt allerdings unklar, auch wenn der Ich-Erzähler es im ersten Kapitel als Teil seiner Biografie erwähnt.
4 Damit ist wohl die traditionelle Parade zum 1. Mai gemeint.
5 Vermutlich ist hier der unmittelbar an das Klinikum angrenzende Udelnyj Park gemeint.
6 Der Bolschoj Sampsoniewskij-Prospekt befindet sich an der südlichen Spitze der Wyborgskaja storona (Wyborger Seite), einem der großen Stadtbezirke Sankt Petersburgs.
7 Überquert man den Trojckij-Most (Trojckij-Brücke) nach Norden, befindet sich der Trojckij-Platz rechts und damit gegenüber der Petropawlowskaja-Festung. Die Petropawlowskaja-Festung ist das historische Herz Sankt Petersburgs und wurde im Gründungsjahr der Stadt 1703 angelegt. Für die Geschichte der sozialrevolutionären Bewegung im Russländischen Imperium vor allem des 19. Jahrhunderts ist die Festung von Bedeutung, weil sie als Gefängnis genutzt wurde. Der namenlose Kranke legt somit beachtliche Entfernungen zurück, denn vom Trojckij-Platz bis zum Krankenhaus sind es etwa zehn Kilometer.
8 Kosyrew stellt seinem Kurzroman hier also einen klassischen Beglaubigungstopos voran und datiert ihn auf das Jahr 1925; seit der Maidemonstration, auf der der Anonymus verletzt wurde, sind also mindestens zwölf, vermutlich aber fünfzehn Jahre vergangen, wenn man die im Roman erwähnten expliziten Zeitangaben zusammenführt. Von diesen Jahren hat der Patient zudem »einige Jahre auf seinem Bett gelegen«.
Zweites KapitelDie Katastrophe
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug. Morgen also ist schon der erste Mai. Ich riskierte mehr als alle meine Genossen – denn ich hatte die längste Liste mit Vorstrafen, sollte unser Plan misslingen, drohten mir Sibirien oder der Galgen.
Doch dachte ich darüber nach? Kaum. Mich beschäftigten zwei Fragen: die Kundgebung und … die Liebe. Die Nacht vor der Kundgebung verbrachte ich im Zimmer des erwähnten Studenten. Mary war besonders zärtlich zu mir, und es kostete mich große Mühe zu gehen, ohne ihr meine Liebe gestanden zu haben. Und vielleicht hätte ich etwas gesagt, wenn Korschunow nicht auch anwesend gewesen wäre. Sein kalter Blick und sein trockenes, ironisches Lächeln verfolgten mich und vergifteten mein kaum erblühtes Gefühl. Wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich begonnen, Korschunow zu hassen …
Aber genug davon. Es kam der Tag der Kundgebung. Zu unserem Treffpunkt hatte man den Pargolowskij-Wald 17 bestimmt. Bereits seit dem Morgen hatten sich dort einzelne Arbeiter eingefunden, Papierfetzen und bunte Tücher, die an Bäumen aufgehängt worden waren, wiesen den Weg. Als sich alle versammelt hatten, stellte ich mich auf einen Baumstumpf und hisste die rote Fahne. Jemand begann die Marseillaise zu singen, andere stimmten ein, die mächtigen Klänge dieser Revolutionshymne wurden emporgetragen und verwandelten die bis dahin verstreute Menge der Arbeiter in eine erregte, wie trunkene, eng zusammenstehende, unaufhaltsame Lawine.
Ich begann zu reden. Ich sprach über die bevorstehende Revolution, über die Macht der Arbeiterklasse. Ich sagte, dass die Stunde unseres Sieges nicht mehr fern sei. Und auch, wenn ich meine Rede nicht vollständig wiedergeben kann, so war sie in ihrem revolutionären Pathos sicher die beste, die ich je gehalten habe. Ich bemerkte das Feuer in den Augen meiner Zuhörer, ich spürte, dass sie sich alle wie ein Mann erheben, ihrem Untergang und Entbehrungen oder sogar dem Tod entgegengehen würden …
Plötzlich nahm ich in der Nähe ein für die damalige Zeit typisches Geräusch wahr: Pferdegetrampel, Äste knickten. Jemand schrie:
»Bringt euch in Sicherheit! Kosaken 18!«
Schon tänzelten die Pferde vor uns, Peitschen knallten. Um mich herum Schreie, Flüche und Stöhnen. Trotzdem halte ich die Fahne fest in meinen Händen. In meinem Kopf blitzt sogar ein verführerischer Gedanke auf – ›ich sterbe mit der Fahne in der Hand‹. Ob der Tod mit einer Fahne in der Hand allerdings besser ist als ein anderer Tod, das kann ich dem Leser nicht erklären. Und gewiss war dieses Verhalten leichtsinnig, aber in unseren Kreisen nannte man Leichtsinnigkeit damals Heldentum. Ich erinnere mich noch an Pferdehufe, an das bärtige Gesicht eines Kosaken mit hervorquellenden, blutunterlaufenen Augen – und dann an nichts mehr.
Ich kam in einem Gefängniskrankenhaus zu mir. Nachdem ich meine Augen geöffnet hatte, warf ich einen Blick auf die über meinem Bett hängende Tafel, und wie groß war mein Erschrecken, als ich auf ihr meinen wirklichen Namen las, den eines aus einem Straflager Geflüchteten. Mich erwartete jetzt entweder eine lange Reise nach Sibirien oder eine sehr kurze, aber nicht weniger unangenehme Reise in die andere Welt mit Hilfe eines gewöhnlichen Seils und zweier einfacher Pfosten mit einem Querbalken.
Doch ich war jung, und so gab ich mich nicht der Verzweiflung hin. Da ich aber keinen Rettungsplan zur Hand hatte, benötigte ich Zeit, um mir einen zurechtzulegen: Aus einem Krankenhaus zu fliehen ist schließlich leichter als aus einem Gefängnis. So stellte ich mich schwächer, als ich tatsächlich war, und bemühte mich, Zeit zu gewinnen.
Ein Zufall kam mir zu Hilfe.
Im Bett neben mir lag ein großer, hagerer Mann mit einem tief gebräunten Gesicht, mit großen schwarzen, durchdringenden Augen und einem schwarzen Stoppelbart. Wer er war, warum man ihn eingesperrt hatte, welchen Beruf er ausübte und welcher Nationalität er war, konnte ich trotz all meiner Bemühungen nicht herausfinden. Doch der Unbekannte bemerkte mein Interesse an ihm und wandte sich mit einer belanglosen Frage an mich.
Seine Stimme und sein Akzent verwirrten mich vollends, so dass ich ihn ohne Umschweife fragte, wer er sei, womit er sich beschäftige und wie er an diesen unangenehmen Ort geraten sei.
Der Unbekannte hatte nicht die Absicht, seinen Namen und seinen Beruf zu verheimlichen.
»Ich bin ein bekannter indischer Fakir«, sagte er.
Seinen Namen kann ich nicht wiederholen, aber ich erinnere mich daran, dass Plakate mit seinem Namen mir auf der Straße nicht nur einmal aufgefallen waren. Es stellte sich heraus, dass das Experiment der Öffnung des Bauches eines »Freiwilligen aus dem Publikum« missglückt war und er sich dabei selbst verletzt hatte.
Ich war froh, dass sich die Gelegenheit ergab, mit einem so bemerkenswerten Menschen zu reden. Wir nutzten die Abwesenheit der Krankenschwestern, die uns ohnehin nur wenig Aufmerksamkeit schenkten, und unterhielten uns viele Tage. Der Fakir erzählte mir aus seinem Leben, machte mich mit indischer Weisheit vertraut und zeigte mir sogar Experimente, die die Wahrheit seiner Lehre belegten. Er sagte, dass der moderne Europäer sich die Kräfte, die in ihm wohnten, nicht zunutze machen könne, dies aber auch nicht lernen wolle, wohingegen die Inder ihre vergängliche Hülle dergestalt angeleitet hätten, dass sie längst keine Rücksicht mehr auf die Launen ihrer Körper nehmen müssten. Er selbst – der weltbekannte Fakir – könne drei Monate ohne Essen auskommen und zu jedem beliebigen Moment das Schlagen seines Herzens unterbrechen.
Das glaubte ich ihm nun aber nicht.
»Ich kann es Ihnen zeigen«, entgegnete der Inder.
Und nach zwei, drei Minuten schien es mir, als sei mein Bettnachbar verstorben. Er lag wie ein Leichnam und erkaltete. Ich war schon so weit, eine Krankenschwester zu rufen, als der Fakir sich plötzlich bewegte, die Augen öffnete und – als sei nichts gewesen – sagte:
»Ich könnte so eine beliebige Zeit lang liegen. Ein Jahr, zwei …«
Nach dieser Demonstration seiner Fähigkeiten konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Es war nicht zu glauben! Dieses Spektakel nicht von einer Zirkusgalerie aus anzusehen und zu wissen, alles sei ohnehin Scharlatanerie, sondern unmittelbar neben mir, in einem Gefängniskrankenhaus mitzuerleben!
Aber schon bald dachte ich entsprechend der mir eigenen praktischen Veranlagung darüber nach, wie ich die ungewöhnlichen Kenntnisse des Fakirs für meine eigenen Interessen nutzen könnte.
Schließlich fällte ich eine Entscheidung.
»Könnten Sie mich nicht vielleicht auch in einen Toten verwandeln?«, fragte ich den Fakir. »Wenigstens für eine Stunde?«
»Wann immer Sie wollen«, antwortete der Fakir, »möchten Sie es nicht gleich ausprobieren?«
Ich signalisierte Zustimmung.
»Schauen Sie zur Sonne.«
Ich merkte mir den Standort der Sonne nach dem Schatten, der vom Gefängnisgitter geworfen wurde.
Was er mit mir angestellt hatte, kann ich nicht sagen, aber als ich – so kam es mir vor – nach einer Sekunde die Augen öffnete, stand die Sonne schon beträchtlich tiefer.
»Es sind anderthalb Stunden vergangen«, sagte der Fakir, »Sie haben einen wirklich leicht zu beeinflussenden Organismus und hätten in Indien geboren werden sollen.«
Da erklärte ich ihm meinen Plan. Er war so einfach, dass er schon fast genial war: Der Fakir macht mich für zwei Tage zu einem Verstorbenen – nach meinen Berechnungen war mehr Zeit nicht notwendig. Der Gefängnisarzt bescheinigt meinen Tod, man bringt mich in die Leichenhalle und von dort zum Friedhof.
Ich kenne die Gefängnisgewohnheiten nur zu gut: Ein Wagen mit einer Schindmähre davor, auf dem Wagen ein Sarg, auf dem Sarg ein Wächter, der in aller Ruhe eine Zigarre raucht. Schließlich ist ein Toter der ruhigste aller Inhaftierten. Sobald ich aufwache, öffne ich mit einem kräftigen Schlag den Sargdeckel, springe heraus und fliehe vor den Augen des erschrockenen Kutschers.
»Aber vielleicht führen Sie ja eine Obduktion durch?«, kam mir in den Sinn.
»Keine Sorge«, entgegnete der Fakir, »sobald man Sie mit einem Messer berührt, werden Sie wach.«
Also riskierte ich nichts, denn selbst die schlimmsten Vorahnungen waren nichts im Vergleich zu dem Schicksal, das Richter und Henker mir zugedacht hatten.
Am zehnten Mai 19 führte ich meinen Plan aus. Ich erinnere mich: Mein Bewusstsein trübte sich, dunkle Visionen flackerten wie im Traum vor meinen Augen auf – an mehr kann ich mich nicht erinnern …
17 Im Dorf Pargolowo unweit von Sankt Petersburg gelegen. Der Park trägt heute den Namen Schuwalowskij-Park und ist inzwischen Teil der Stadt. Benannt ist er nach den ehemaligen Besitzern des Dorfes Pargolowo, den Grafen Schuwalowy.
18 Die Kosaken, Angehörige freier Reiterverbände aus der Umgebung um den Unterlauf des Dnipro, haben sich im Verlauf ihrer Geschichte verschiedenen Herren angedient. In der hier geschilderten Szene stützen sie die Macht des Zarenhauses. Zur Rolle der Kosaken in der revolutionären Umbruchszeit im Russländischen Imperium am Beginn des 20. Jahrhunderts vgl. Andreas Kappeler, Die Kosaken. Geschichte und Legenden, München 2013, S. 63–82.
19 Im Zeitgerüst des Romans ist damit vermutlich der 10. Mai 1910 gemeint.
Drittes KapitelLENINGRAD
Ein frischer Frühlingswind weckte mich. In einer ersten instinktiven Bewegung wollte ich meine Hand heben und mir die Augen reiben. Aber die Hand stieß gegen etwas Hartes. Da erinnerte ich mich an alles, stieß noch einmal gegen den Deckel und verlor erneut das Bewusstsein.
Als ich meine Augen wieder aufschlug, sah ich die Sonne, die im Westen unterging, ich bemerkte ein gepflügtes Feld und in einiger Entfernung ein kleines Dorf. Mit Mühe stand ich auf, sah mich um und erblickte rauchende Fabrikschlote.
Hatte man mich denn nicht zum Friedhof gebracht, sondern einfach irgendwo auf einem Feld vom Wagen geworfen? Wo ist der Kutscher?
Aber plötzlich erblickte ich den halb verfaulten Sarg, der von allen Seiten mit Erde bedeckt war. Also hatte man mich doch verscharrt. Doch warum so nah an der Oberfläche? Und: Wie viel Zeit hatte ich im Grab verbracht?
Für Unschlüssigkeit blieb jedoch keine Zeit. Ich fühlte mich schwach und musste so schnell wie möglich Nahrung und eine Unterkunft finden. Die Stadt in der Nähe – das ist natürlich Sankt Petersburg, nur schien es mir, als sähe ich sie von einer mir unbekannten Gegend aus.
Ich machte mich also auf den Weg.
Öde Felder passierend, gelangte ich auf eine breite Chaussee, auf der mir vereinzelt Menschen entgegenkamen, in Lumpen gekleidet, die den meinen ähnlich sahen. Sie betrachteten mich finster.
»Wie komme ich zur Lesnaja?«
Ein Bettler sah mich erstaunt an. Was ist, wenn dies nicht Sankt Petersburg ist, schoss es mir durch den Kopf, und ich fragte ihn:
»Welche Stadt ist das?«
Er sah mich misstrauisch von oben bis unten an und antwortete:
»Leningrad 20.«
Diese Antwort verwunderte mich. Ich durchforstete mein Gedächtnis, konnte mich jedoch an keine Stadt eines solchen Namens erinnern – weder in Russland noch im Ausland. ›Aber da der Bettler Russisch versteht und spricht, sind wir ja wohl in Russland‹, dachte ich bei mir. Doch mich irritierte der Name der Stadt, und ich hätte den Bettler gern weiter ausgefragt, wenn er nicht in großer Eile, die von Misstrauen gegenüber meiner Person zeugte, weitergegangen wäre. Nachdem ich einige Minuten in Gedanken versunken stehen geblieben war, machte ich mich wieder auf den Weg – sollte doch kommen, was wolle.
Ich hatte die Hoffnung, mich zu einem Bahnhof durchzuschlagen und mit dem erstbesten Zug nach Sankt Petersburg zu fahren, denn es konnte doch nicht sein, dass eine so große Stadt nicht per Eisenbahn mit der Hauptstadt verbunden war.
Also ging ich über ein großes, unbewohntes, ödes Sumpfgelände mit einigen Dutzend schiefen Holzhäusern, die von Palisadenzäunen und verkümmerten Sumpfbirken umgeben waren. Die Häuser waren in ungewöhnlicher Regelmäßigkeit angeordnet, so als hätte jemand daran gedacht, hier eine Datschensiedlung zu errichten, diesen Plan dann aber aufgegeben. Davon überzeugte mich ein gewaltiges Schild mit den durch die Zeit verwitterten Buchstaben »Gartenstadt N. A. Semaschko« 21. Jetzt wurde mir klar, dass die vor mir liegende Stadt von dem gleichen Bauherrn errichtet worden war, der, wenn auch ohne Erfolg, diese Gartenstadt geplant hatte. Bin ich also doch in der Nähe Sankt Petersburgs?
Schon bald erreichte ich die städtischen Randgebiete. Graue, heruntergekommene kleine Häuser enttäuschten mich: Nein, diese Stadt wurde schon vor langer Zeit errichtet. Auf den Straßen war zunächst niemand zu sehen, und die vereinzelten Passanten sahen mich so misstrauisch an, dass ich beschloss, sie nicht anzusprechen und mich tastend, als hätte ich verbundene Augen, fortzubewegen.
Mit der Zeit nahm die Zahl der Häuser zu, die Chaussee endete und mündete in eine lange, breite Straße, an deren Seiten sich große Häuser aus Stein erhoben. Und hier erwartete mich eine erste Prüfung: Auf der Kreuzung stand eine Person, die eine Mütze mit karmesinroter Borte sowie einen Revolver trug. Der Instinkt des alten Revolutionärs sagte mir, dass es sich um einen Polizisten handeln musste. Hatte er mich schon bemerkt? Nein, denn zu meinem Glück schaute er gerade in die entgegengesetzte Richtung, und ich verschwand schleunigst in einer nahebei liegenden Gasse.
Ein Zusammentreffen mit der Polizei wäre für mich aus mehreren Gründen unerfreulich gewesen. Erstens, ich wusste nicht, wer ich war und woher ich kam; zweitens, ich war ein ehemaliger Häftling und hatte, drittens, keinen Pass. Aber als ich in meinen Taschen wühlte, fand ich darin doch etwas in der Art eines Dokuments, den Betriebsausweis der Fabrik »Nowyj Ajwas« mit einem Foto. Aber vielleicht war er nicht mehr gültig? Und so nahm ich für alle Fälle nur die dunkelsten Gassen.
Allerdings wurden diese Gassen immer weniger. Ich trat auf einen mit vielgeschossigen Häusern bebauten Prospekt hinaus und fand schnell heraus, dass er Prospekt des 17. Juli 22 hieß. Diese Bezeichnung sagte mir ebenfalls nichts.
Schließlich bemerkte ich an einem der Häuser eine große, wie mir schien, goldene Flagge mit einem ebensolchen Wappen. Das Wappen selbst konnte ich nicht erkennen, aber es stellte sicher nicht den doppelköpfigen Adler 23 dar. So verlor ich mich in Vermutungen, schreckte aber davor zurück, den erstbesten Passanten danach zu fragen, wo ich mich befand, denn die gut gekleideten, soliden Herrschaften, die diese Straße bevölkerten, könnten mich für einen Bettler halten und die Polizei rufen. Zudem sahen alle sehr misstrauisch nicht nur mich, sondern auch die anderen Passanten an.
Die Straße war ganz offensichtlich eine der bedeutendsten in der Stadt. Neben mir fuhr eine Straßenbahn, rot gestrichen 24, verziert mit Losungen und Zeichnungen, die ich während des Gehens aber nicht erkennen konnte. Ich bemühte mich auch, Schilder zu lesen – doch dies gelang mir nicht, denn merkwürdige, oft genug sinnlose Wörter 25 sahen mich an. Ohnehin war ich nicht ganz bei mir – alles flimmerte vor meinen Augen, die Umgebung tauchte auf, verschwand wieder – vielleicht kann ich die Schilder einfach nicht so lesen, wie es sich gehört? Ich war auch schon früher in solchen Situationen gewesen und wusste, dass sie stets mit schrecklichen Kopfschmerzen endeten.
Ab und zu schloss ich die Augen und fühlte mich wie in Sankt Petersburg, sobald ich sie nur für eine Sekunde öffnete. Zum Beispiel dieses hohe, mit roten Kacheln verzierte Haus 26 – mir scheint, ich habe es irgendwo schon einmal gesehen. Oder diese Kirche – auch sie kommt mir bekannt vor. Diese Gasse – hier bin ich doch schon einmal gewesen – aber wann? Vielleicht nur im Traum? Aber der Name der Gasse, das Schild, die goldene Flagge anstelle des Kreuzes auf dem Kirchturm 27 – nein, das alles ist mir fremd. Selbst ein mir bekanntes Geschäft – mir schien, ich sei erst gestern dort gewesen – trägt einen merkwürdigen, sinnlosen Namen: »Lepo«. Entweder ist das der Besitzer des Geschäfts irgendein Franzose 28, oder der Name bezeichnet eine Ware. Manchmal gibt es anstatt eines Namens aber auch nur eine Nummer 29, vereinzelt finden sich lediglich Initialen.
Indes, je weiter ich ging, umso mehr schien es mir, als sei ich doch in Sankt Petersburg. Aber warum hatte die Stadt sich so verändert? Wie viele Jahre hatte es dafür gebraucht? Vielleicht sind meine Bekannten und Freunde schon lange tot, und ich bin nur ein seltsamer und lächerlicher Schatten aus der Vergangenheit? Als ich mir dies vorstellte, zog sich mir das Herz zusammen, meine Schwäche und die rasenden Kopfschmerzen verstärkten die Hoffnungslosigkeit meiner Lage.
Ich stehe also auf dem Bürgersteig und muss einen zweiten, noch breiteren Prospekt überqueren. Der rege Verkehr wird von einem Polizisten geregelt – ich erriet, dass der Mann mit der karmesinroten Mütze ein Polizist war. Er hebt seinen Stock, und zusammen mit anderen gehe ich auf die andere Seite. In der Mitte der Straße bewegt sich ein zweiter Strom von Fahrzeugen. Ich bleibe stehen und schaue mich um. Tatsächlich: Nicht weit entfernt stehen vier bronzene Pferde 30, und am Ende des Prospekts eine golden glänzende Nadel 31.
Nun gab es keinen Zweifel mehr:
»Ja, das ist der Newskij-Prospekt« 32.
Und auch, dass auf dem Straßenschild »Prospekt des 25. Oktober« 33 zu lesen war, konnte mich schon nicht mehr stören – jetzt wusste ich ja, dass ich mich in Sankt Petersburg befand.
Ich atmete erleichtert auf und begab mich auf den Weg auf die Wyborger Seite, machte aber einen großen Bogen um Polizisten.
Mir schien meine Rettung nicht mehr fern.
20 Die von Peter dem Großen 1703 in der Newa-Mündung angelegte Stadt wurde 1712 zur Hauptstadt des Russländischen Imperiums und trug den Namen Sankt Peterburg bis zum Jahr 1914. Von 1914 bis 1924 hieß sie Petrograd, danach, bis 1991, Leningrad.
21 N. A. Semaschko (1874–1949) war von 1918–1930 erster Volkskommissar für das Gesundheitswesen der RSFSR. Kosyrew wählt diesen Namen sicher nicht ohne Hintersinn, gilt Semaschko doch als Begründer des sowjetischen Gesundheitswesens und leitete die Obduktion W. I. Lenins (1870–1924).
22 Ein Datum allergrößter Symbolkraft; an diesem Tag wurde im Jahr





























