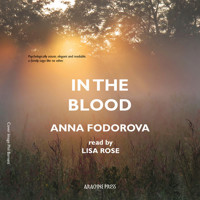11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Über die große Dame der deutsch-tschechischen Literatur – Weggefährtin von Anna Seghers, Egon Erwin Kisch und Max Brod.
Sie war die letzte deutschsprachige Autorin Prags, die große Dame der deutsch-tschechischen Literatur, Jüdin, und sie hat sie bis zu ihrem Tod 2008 in Prag alle überlebt: Anna Seghers, Egon Erwin Kisch, Max Brod. Vor den Nazis flüchtet sie über Paris, Marseille und Casablanca bis nach Mexiko-City, nach ihrer Rückkehr wird sie im Zuge der stalinistischen Säuberungen in der Tschechoslowakei inhaftiert – Lenka Reinerová lebte ohne Zweifel eine der bewegendsten Biografien des vergangenen Jahrhunderts.
In ihrem so poetischen wie persönlichen Buch nimmt ihre Tochter Anna Fodorova, die heute als Psychotherapeutin in London lebt, Abschied von der berühmten Mutter. Es ist die Geschichte der letzten Jahre von Lenka Reinerová, es ist eine neue Begegnung mit der großen Dame der deutsch-tschechischen Literatur, und es ist der Blick einer erwachsenen Tochter auf das Leben mit ihrer Mutter – persönlich, poetisch und tief berührend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Sie war die letzte deutschsprachige Autorin Prags, die große Dame der deutsch-tschechischen Literatur, Jüdin, und sie hat sie bis zu ihrem Tod 2008 in Prag alle überlebt: Anna Seghers, Egon Erwin Kisch, Max Brod. Vor den Nazis flüchtet sie über Paris, Marseille und Casablanca bis nach Mexiko-City, nach ihrer Rückkehr wird sie im Zuge der stalinistischen Säuberungen in der Tschechoslowakei inhaftiert – Lenka Reinerová lebte ohne Zweifel eine der bewegendsten Biografien des vergangenen Jahrhunderts.
In ihrem so poetischen wie persönlichen Buch nimmt ihre Tochter Anna Fodorova, die heute als Psychotherapeutin in London lebt, Abschied von der berühmten Mutter. Es ist die Geschichte der letzten Jahre von Lenka Reinerová, es ist eine neue Begegnung mit der großen Dame der deutsch-tschechischen Literatur, und es ist der Blick einer erwachsenen Tochter auf das Leben mit ihrer Mutter – persönlich, poetisch und tief berührend.
Zur Autorin
Anna Fodorová, 1946 als Tochter der Prager Schriftstellerin Lenka Reinerová (1916–2008) in Belgrad geboren, wuchs in Prag auf. Sie studierte an der Akademie der Künste in Prag Architektur und Design, seit 1968 lebt sie in England und machte ihren Filmabschluss am Royal College of Art in London. Sie drehte mehrere Animationsfilme, veröffentlichte ein Kinderbuch und schrieb Drehbücher für die BBC. Heute lebt sie in London und arbeitet als Psychotherapeutin mit den Schwerpunkten psychoanalytische Psychotherapie generationenübergreifende Traumata.
Anna Fodorová
Lenka Reinerová
Abschied von meiner Mutter
Aus dem Tschechischen von Christina Frankenberg
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Lenka« bei Labyrint, Prag.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Genehmigte Ausgabe April 2022
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Anna Fodorová und Labyrint Verlag, Prag
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Marion Michelle/Lenka Reinerová Privatarchiv und Labyrint Verlag
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
mr · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-28492-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
»Trauer bleibt, füllt für immer einen Winkel der Seele. Wenn man das weiß, kann man mit ihr auch zurechtkommen. Trauer haßt und verzeiht nicht, ist still und tief versunken. Von ihr berührt, kann man sogar beinahe mehr aus dem Leben schöpfen …«
– Lenka Reinerová, Mandelduft
Wiedersehen
Es war das letzte Mal, dass sie uns besuchen kam. Das konnte ich damals aber nicht ahnen. Oder genauer gesagt, ich wollte nichts in der Art an mich heranlassen.
Ich wartete auf dem Londoner Flughafen, und als sie auftauchte, winkte sie mir zu wie immer, ganz Lächeln und Freude darüber, dass wir uns wiedersehen. Nur wurde sie diesmal von einem Flughafenangestellten in einem Rollstuhl geschoben. Das war zwar zuvor so vereinbart worden, trotzdem war es ein Schock, sie so zu sehen, und das umso mehr, weil ein Fuß von ihr unausgesetzt über den Boden stuckerte. Das kam mir würdelos vor, wegen dieser Nachlässigkeit rügte ich sofort den Angestellten und stellte ihren Fuß energisch auf die Fußraste, wo er hingehörte. Aber es war wohl einfacher, nach einem Schuldigen zu suchen, als die Angst, die mich ob der plötzlichen Verwandlung ergriff, zuzulassen. Sie war immer klein gewesen, von zierlicher Gestalt, aber seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hatte sie sehr abgenommen, es war weniger von ihr da als je zuvor.
Sie heißt Lenka Reinerová. Sie war Schriftstellerin, auch wenn sie gern von sich sagte, dass sie Erzählerin sei. Ihr sehr bewegtes Leben war von vielen Widerständen und damit verbundenen Tragödien geprägt, aber auch von Erfolgen und Freuden. Sie kam in einer bürgerlichen jüdischen Familie in Prag zur Welt, besuchte das deutsche Gymnasium und Deutsch wurde zu der Sprache, in der sie schrieb. In der Jugend wurde sie Kommunistin, den Krieg überlebte sie im Exil, während all ihre nächsten Angehörigen in Konzentrationslagern ums Leben kamen. In der Zeit der politischen Prozesse in den Fünfzigerjahren wurde sie von der Kommunistischen Partei ins Gefängnis gesperrt. Ich war damals sechs Jahre alt und hatte anderthalb Jahre lang nichts von ihr gehört. In meinen Erinnerungen ist sie erst seit der Zeit anwesend, als sie aus dem Gefängnis zurück war. Davor ist nur ein leerer Fleck. Sie hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, in denen sie auf unverwechselbare Art von ihrem Leben, von Freunden und Bekannten, von den unterschiedlichsten Menschen erzählt, die sie getroffen und die sie verloren hat. Sie arbeitete als Journalistin, mein Vater war ebenfalls Journalist. Der, eigentlich Arzt, veröffentlichte unter dem Pseudonym Theodor Balk, das er bewusst wählte, weil er seine Herkunft vom Balkan betonen wollte. Folglich wuchs ich mit dem Geklapper von Schreibmaschinen auf, mit Schubladen voller Manuskripte und hauchdünnen Bögen Kohlepapier, welche die Finger schwarz färbten wie Ruß.
In diesem Sommer hatte sie eine lange Chemotherapie zu Ende gebracht. Man konnte gar nicht mehr zählen, der wievielte Krebs, die wievielte Chemotherapie das schon waren. Die erste hatte sie nach eigenem Bekunden mit zweiunddreißig Jahren durchgemacht. Damals hatte man ihr gesagt, dass sie kein weiteres Kind haben solle. Jetzt hatte sie ihren einundneunzigsten Geburtstag gefeiert und ihr behandelnder Arzt in Prag hatte mich zur Seite genommen: »Hören Sie«, flüsterte er, »Ihre Mutter ist ernsthaft krank, und Sie sollten einen Plan haben, wie es weitergeht, wenn sie nicht mehr allein leben kann.« Dann dämpfte er die Stimme noch weiter: »Und da ist noch eine Sache. Ich habe einen Test bei Ihrer Mama gemacht, und es hat sich herausgestellt, dass sie eine genetische Mutation hat, welche die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung stark erhöht. Dadurch stehen – leider – bei Ihnen die Chancen fifty-fifty, dass Sie dieses fehlerhafte Gen geerbt haben.«
Das wusste ich freilich schon seit Längerem. Aber was sollte ich mit dieser Information anfangen? Ich bat ihn nur, Mutter damit nicht unnötig zu belasten. »Verstehe«, entgegnete er. »Sie hat es schon hinter sich. Aber jetzt geht es um Sie. Lassen Sie den Test machen?« Ich zuckte mit den Schultern.
Wenn es etwas gibt, das ich ganz bestimmt nicht von Mutter geerbt habe, dann ist das meine Unentschlossenheit. Und dabei muss es nicht immer um Leben und Tod gehen, schon wenn ich eine Speisekarte studiere, erstarre ich in einer Agonie. Genauso erging es mir mit einem Plan für Mutters Zukunft: Ich hatte keinen. Aber auch er, der Arzt, hatte ihr doch gerade die Reise nach London gestattet! Mutter und ich hatten das viele Male zusammen am Telefon durchgesprochen, ihre (und auch meine) Vorstellung war, dass sie bei uns wieder zu Kräften kommen sollte. Sie würde sich ausruhen, kurze Spaziergänge machen oder im Garten sitzen, und ich würde gutes Essen kochen, das sie wieder auf die Beine brächte.
Sie kam uns regelmäßig besuchen, mindestens zweimal im Jahr, zu Beginn des Sommers und zu Weihnachten. Sie reiste mit einem kleinen Köfferchen, ihr genügten einige wenige Blusen, ein Seidenschal und zwei Paar Hosen. Dafür war ihre Reisetasche immer prall mit Geschenken und vor allem mit Essen gefüllt: mit Schnitzeln, Weihnachtsplätzchen, Würsten, Strudeln …, einfach mit all dem, was wir in England nicht hatten. Dies waren meist die Erzeugnisse anderer Leute, fürs Kochen hat Mutter sich nie groß interessiert. Bei uns zu Hause hatte stets Vater gekocht und wie wir alle, die im Ausland leben, hatte er sich nach den Düften und Aromen der Kindheit zurückgesehnt – so grillte er für uns Ćevapčići, schnitt frische Zwiebeln, bereitete üppige Balkansalate zu, nicht ohne zuvor die Schüssel mit Knoblauch ausgestrichen zu haben, und wenn sich die Gelegenheit ergab, was in einem Land ohne Meer nicht ganz einfach ist, aßen wir Fisch. Und im Sommer natürlich Melonen. Man musste die Frucht zuerst ans Ohr halten, ordentlich zudrücken und sie nur dann kaufen, wenn sie hörbar knackte.
Auf dem Weg vom Flughafen schlängelten wir uns mit dem Auto durch die Londoner Straßen, voller Lärm, Fußgänger und roter Doppelstockbusse. Alles hier erkannte sie wieder, alles hier hatte sie sich in den vergangenen Jahren zu Fuß erschlossen. Jetzt kommentierte sie die letzten Veränderungen: Hier sei ein neuer Wolkenkratzer emporgewachsen, dort das Geschäft verschwunden, in dem sie mir vor langer Zeit einen Minirock und dann wieder einen Maxirock gekauft hatte, was eben gerade in Mode war, hier müsse man jetzt anders entlangfahren, und das preiswerte chinesische Restaurant, wo wir immer die Wan-Tan-Suppe gegessen haben, sei nun ebenfalls nicht mehr da … Ach London! London war auch zu ihrer Stadt geworden, war ihre Enkelin doch hier zur Welt gekommen.
Und dann überquerten wir den breiten braunen Strom der Themse mit all den Touristenbooten, Dampfern und Schonern, die meine Mutter an weite Reisen erinnerten. Das breite Flussbett und die aufgepeitschte Wasserflut riefen ihr die sprudelnden Gezeiten des Meeres und die salzige Luft ins Gedächtnis. Am Südufer befand sich ihre Lieblingscafeteria mit modernen bunten Tischen, zu der sie von uns aus immer mit dem Bus gefahren war. Wiederholt hatten wir sie darauf hingewiesen, dass es mit dem Zug und der U-Bahn schneller ginge, weil sich der Bus durch endlose und nicht besonders einladende Viertel quälen muss. Aber sie hatte es nicht eilig und gerade diese Viertel gefielen ihr. Das Ufer säumten immer Bücherstände und es war voller Obdachloser, die interessierten sie auch.
Im Lauf der Jahre hatten wir zusammen ein kleines Ritual entwickelt, das inzwischen ein fester Bestandteil ihrer Besuche bei uns, ihrem zweiten Zuhause, geworden war: Auf dem Weg vom Flughafen machten wir in einem Selbstbedienungsladen in der Nähe Halt, damit sie sich etwas aussuchen konnte. Sie war jedes Mal sehr bescheiden, außer Orangenmarmelade, Oliven und Avocados hatte sie keine besonderen Wünsche. Und sie war immer aufs Neue schockiert – zumindest tat sie so –, wenn ich nach dem Studium des Etiketts auf der Packung erklärte, dass wir diese Marmelade nicht kaufen würden, weil sie Preservatives (Konservierungsstoffe) enthält. Sie ermahnte mich jedes Mal: »Sei so gut und sag das in Prag niemals laut.«
Heute aber ist es anders. An Essen mag sie nicht einmal denken. Sie will direkt nach Hause, ist zu erschöpft von der Reise, und Essen verursacht bei ihr nur Appetitlosigkeit. Und trotzdem oder gerade deshalb, ist sie mit der Vorstellung zu uns gekommen, dass wir sie hier aufpäppeln würden.
Ich mache mich ans Kochen, ich rühre, mahle, brate. Ich backe ein leichtes Biskuit mit ganz viel Butter. Sie liebt Desserts, aber dieses betrachtet sie misstrauisch und legt nach dem ersten Bissen die Gabel zur Seite. Ich biete ihr Hühnersuppe mit Fadennudeln an, die mochte sie immer sehr gern; locker aufgeschlagenen Kartoffelbrei, in den ich Sahne hineinschmuggele; fein geschnittenes mageres Rindfleisch. Alles vergeblich.
»Wenn ich jetzt in Prag wäre«, höre ich sie seufzen, »würde ich Knödel mit Soße essen.« Ich studiere das tschechische Kochbuch, fabriziere etwas, das Knödeln ähnelt, überschwemme es mit Tomatensoße und stelle es vor sie hin. »Verzeih, aber ich kann nicht mehr«, entschuldigt sie sich nach ein paar Bissen.
Am nächsten Tag versuche ich etwas anderes. »Eine Portion wie für ein Baby!«, rufe ich sie an den gedeckten Tisch im Garten. Anfangs hatte sie uns geholfen, den Garten zu bepflanzen und noch im letzten Sommer hatte sie täglich mit Sorgfalt das Gedeihen jeder Pflanze verfolgt, auch wenn ihre Spezialität immer Zimmerpflanzen gewesen sind. Sie ist in einer Wohnung im Prager Stadtviertel Karlín aufgewachsen, und die Vorstellung, dass ihre Tochter jetzt nicht nur ein Haus, sondern auch ein Stück Land in London besitzt, das Bewusstsein, dass wir hier etwas pflanzen, das Wurzeln treibt, verblüffte sie immer aufs Neue.
Sie setzt sich auf den neuen, mit Kissen gepolsterten Klappstuhl, isst ein klein wenig und sonnt sich eine Zeitlang. Über den Stuhl ärgert sie sich ein bisschen, jedes Mal, wenn sie aufstehen will und sich an den Seitenlehnen festhält, klappt er unvermittelt unter ihr zusammen, wie aus Bosheit. »Bin ich denn schon so dick geworden?«, kommentiert sie das lachend. Ich versuche, sie zum anderen Ende des Rasens zu locken, wo der Pfirsichbaum blüht. »Morgen«, sagt sie. »Heute mag ich nicht.«
Morgen jedoch ist alles unverändert. Selbst die paar Schritte die Treppe hinunter geht sie nur mit Mühe, alles tut ihr weh, die Wirbelsäule, die Hüfte, die Beine, alles. »Das wird schon wieder«, beruhigt sie mich, wenn sie meinen besorgten Blick auffängt. Und so geht das Tag für Tag.
Schicksalhafter Dienstag
Die nächste Woche begann ganz gewöhnlich. Am Montagvormittag hatte ich einige Patienten, und danach kam meine Tochter zu Besuch. Als wir im Garten das Barbecue vorbereiteten, verkündete Mutter unvermittelt: »Das Wetter ändert sich, ich spüre es in den Knochen.« Kaum hatte sie das ausgesprochen, schon donnerte es irgendwo in der Ferne. Aber mich beunruhigte eine Ahnung, ob ihre Knochen nicht etwas Schlimmeres als Regen prophezeiten …
Wir leben schon lange in London. Mein Mann stammt auch aus Prag, beide haben wir ein Studium an der Kunsthochschule abgeschlossen, er Malerei, ich Filmanimation, und heute unterrichten wir beide an ähnlichen Institutionen. Unsere Tochter hat Anthropologie studiert und arbeitet an einer angesehenen Londoner Universität. Als ich um die fünfzig war, entschloss ich mich zu einem neuen Studium, diesmal der Psychotherapie. Ich hatte mich selbst mehrmals einer Psychotherapie unterzogen und war jedes Mal fasziniert, dass die Person, die mir gegenüber schweigend im Sessel zuhört, etwas darüber weiß, wie mein Geist funktioniert, während ich das nicht zu fassen bekomme … Dieses Etwas wollte ich auch begreifen. Das Abendstudium hatte sechs Jahre gedauert. Es war sehr anspruchsvoll, manches verstand ich, auch, dass sich dieses illusorische Etwas schwer in Worte fassen lässt. Nichtsdestotrotz ist die Folge, dass ich neben der Lehre an der Hochschule auch als Psychotherapeutin in einer Privatpraxis arbeite. Meinen Arbeitsraum habe ich bei uns im Haus eingerichtet, das bringt viele Vorteile, aber auch Probleme mit sich: Immer wieder weise ich alle darauf hin, dass sie während der Sitzungen auf Zehenspitzen über die Treppe gehen müssen, dass sie nicht mit den Türen knallen und auch nicht laut fernsehen dürfen. Ich ermahne sie, daran zu denken, wann eine Sitzung beginnt und wann sie endet, damit sie auf dem Flur nicht in einen meiner Patienten laufen. An den Therapietagen herrscht bei uns nämlich sanfter Terror. Alle zeigen ihren guten Willen und alles geht glatt, nur mein Mann wendet gelegentlich ein, dass er nicht fliegen könne.
Seit Mutters Ankunft gebe ich mir Mühe, alles ihren Bedürfnissen unterzuordnen. Jeden Morgen bringe ich ihr Haferbrei mit Honig ans Bett, fein püriert, so wie man ihn für kleine Kinder zubereitet, und sie sagt: »Du bist jetzt meine Mama.« Manchmal erwähnt sie ihre Mutter und ihre Schwestern und beklagt, was die im Leben alles durchmachen mussten, während sie jetzt im warmen Bett liege, wo die Tochter ihr das Frühstück serviert. So redet sie nur ausnahmsweise, meist wiederholt sie, dass sie sich nicht selbst bemitleiden dürfe.
Man darf sich nie selbst bemitleiden – ihr unbarmherziges Mantra. Mehrere Menschen haben schon voller Bewunderung diesen Ausspruch zitiert, er stand auch in der Überschrift eines Artikels über sie. Seine Logik ist mir jedoch unverständlich: Warum sollte ein Mensch so unerbittlich zu sich selbst sein und sich nicht manchmal ein wenig Selbstmitleid erlauben? Das ist doch ganz normal, menschlich. Im Unterschied zu ihr war ich jedoch nie unmenschlichem Handeln ausgesetzt. Ihr hat dieser Selbstschutz das ganze Leben lang gute Dienste erwiesen, sie hat sich nie erlaubt, vor Schmerzen zu stöhnen, nicht einmal bei der Entbindung. Das war in Belgrad, und alle serbischen Frauen um sie herum klagten ajajaj, Majka Božíja (Mutter Gottes). Sie jedoch – gab keinen Ton von sich. Und so bemerkte niemand, dass ich auf dem Krankenhausflur beinahe aus ihr herausgefallen wäre.
Unser Londoner Haus wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Als mein Mann und ich es kauften, war es offiziell für unbewohnbar erklärt worden, und wir bekamen ein dickes Verzeichnis von Arbeiten, die zu erledigen waren. Alles war heruntergekommen. Im verwahrlosten Garten standen ungefähr acht Holzschuppen, die mit Krempel vollgestopft waren, von dem sich die vorherigen Bewohner nicht hatten trennen können. In einem entdeckten wir sogar eine Ansammlung von Plastiktüten mit Haaren. Einige grau meliert, andere mit einem Rotschimmer. Dieses Stadtviertel düsterer viktorianischer Häuser mit bröckelnden Säulen und schadhaftem Stuck, mit hohen gewölbten Decken und einer Unzahl rauchgeschwärzter Marmorkamine, all die verblasste Pracht des letzten Jahrhunderts berührte mich nicht. Ähnlich wie Mutter bin ich in einer Mietshauswohnung groß geworden, mir war es fremd, mich in meinem Zuhause von einer Etage zur anderen zu bewegen. Aber mein Mann brauchte ein Atelier, wo er malen konnte, und die Größe der Zimmer in diesem Haus war ideal.
Mutter erlebte den Umzug damals zusammen mit uns, ihre aufheiternde Anwesenheit war mir eine starke Stütze. Wir wiesen ihr ein Zimmer in der oberen Etage zu, um das Bett stellten wir eine Reihe Eimer, die das Regenwasser, welches durch das löchrige Dach eindrang, auffangen sollten. Wir kochten in einer improvisierten Küche, und Mutter bemühte sich nach Kräften, uns bei Laune zu halten, ganz wie es ihre Art war. Aber ich fühlte mich trotzdem wie aus der Spur geraten, so dass ich mir Hilfe suchen ging. Außer Tabletten gegen Depressionen hatte die Ärztin leider kein Mittel, meinem Gefühl der Entwurzelung entgegenzuwirken. Das alles ist längst Vergangenheit. Die Summe, die wir damals für diese grandiose Ruine entrichteten, reicht heute noch nicht einmal für ein Zimmer am Stadtrand Londons.
Wir räumen den Tisch am Fenster für sie frei, holen den Koffer mit der Olivetti-Reiseschreibmaschine aus dem Schrank, legen eine Decke darunter, den Stuhl polstern wir mit einem Kissen, und sie macht sich an die Arbeit. Jedes Mal kommt sie mit einer Aufgabe angereist: ein Manuskript beenden, etwas aus dem Notizblock abtippen, etwas Neues beginnen. Während sie schreibt, verfolgt sie mit journalistischer Neugier, was draußen vor sich geht, und abends informiert sie uns darüber: »Der Mann, der so komisch geht und diese Handbewegungen macht, ist heute zweimal vorbeigekommen. Morgens hat wieder ein Auto bei diesem grünen Kasten an der Säule gehalten und jemand hat etwas hineingesteckt. Was die da wohl lagern? Die Frau, die immer nur in einem einzigen Farbton gekleidet ist, ihre Handtasche eingeschlossen, hat sich schon ein paar Tage nicht mehr sehen lassen, ich hoffe, dass es ihr gut geht. Heute hat mitten auf der Straße ein Hund gelegen, die Autos mussten einen Bogen um ihn machen.« Wir nannten sie deshalb Miss Marple.
Ihre Besuche waren aber nicht immer idyllisch. Sie war kaum angekommen, schon gingen endlose, hitzige Debatten los, sie drehten sich ausnahmslos um Politik. Mein Mann konnte sehr starrköpfig sein, und meine Mutter – sie reichte ihm kaum bis zur Brust – hatte etwas aus Stahl in sich. Unsere Rollen waren genau festgelegt: Mutter mit ihren Schwierigkeiten, sich vom Glauben an den Sozialismus zu verabschieden – und das war ein Glaube mit allem, was dazugehört, hatte sie doch ihr ganzes Leben dieser Überzeugung verschrieben –, in der Rolle der Kämpferin für eine bessere Zukunft, mein Mann in der Rolle des zweiflerischen Provokateurs, des Klassenfeindes geradezu, und ich als Vermittlerin zwischen beiden. Ein klassisches Dreieck also. Meine Tochter trat dabei nicht in Erscheinung. Sie war glücklich, ihre Oma hierzuhaben, bei der sie sich unauffällig über die Eltern beschweren und der sie ihre kindlichen Geheimnisse anvertrauen konnte. Mein Mann löste die Situation meist dadurch auf, dass er gegen Ende von Mutters Aufenthalt krank wurde und sich im Bett verkroch.
Dieses Mal jedoch werden keine Schlachten geschlagen, dieses Mal wird für Mutter rücksichtsvolle Stille zelebriert, ihre Schreibmaschine bleibt unangetastet. Nicht einmal ein Spaziergang in den Park am Ende der Straße kommt infrage. Vorbei ist die Zeit der Besuche im nahen Laden, in dem die indischen Eigentümer sie immer begrüßt hatten: »Sie sind wieder da? Und woher kommen Sie noch mal?« Sie kam schon so lange dorthin, dass sie sich selbst an die Eltern erinnerte, an die Frau im Sari hinter dem Ladentisch, mit einem roten Punkt auf der Stirn, und an den Mann mit dem orange gefärbten Bart hinter dem Schalter, wo er Pakete gewogen und Briefe gestempelt hatte – damals war das noch Laden und Post in einem gewesen.
Jeder noch so unbedeutende Ausflug bot ihr die Möglichkeit, ein kleines Abenteuer in dieser fremden Stadt zu erleben. Unsere vorherige Wohnung hatte sich in einem Viertel namens Brixton befunden, in dem traditionell Bewohner aus den ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik und in Afrika zu Hause waren. Dort gab es einen riesigen Markt, auf dem man einen ganzen Tag verweilen konnte und es immer etwas Neues zu entdecken gab. An diesem Ort brachen auch die ersten großen Unruhen der Schwarzen aus. Unsere Tochter war damals zwei Jahre alt, Mutter und ich setzten sie in den Kinderwagen und gingen nach draußen, Mutter wollte sich so etwas natürlich nicht entgehen lassen. Menschenmassen wälzten sich hin und her, die Luft war voller Qualm, wir kamen an brennenden Autos und martialisch gepanzerten Polizeikordons vorbei. Erst als sich ein Regen aus dem Glas der zersplitterten Fenster eines vorbeifahrenden Polizeibusses über den Kinderwagen ergoss, begriffen wir, dass es an der Zeit war, nach Hause zu gehen.
Es gab aber auch weniger dramatische Erlebnisse. Jahrelang hatte Mutter einen Vorgarten in der Nachbarstraße bewundert. Auf dem Stückchen Erde dort hatte jemand liebevoll jeden Zentimeter mit Pflanzen bedeckt; alles glühte und sprühte vor Farben, und wo es keinen Platz mehr gab, steckten Stangen mit Körbchen, die vor Blüten schier überquollen. Einmal jedoch kehrte Mutter mit einer traurigen Nachricht zurück: Der kleine Garten war vollkommen verödet. Was war passiert mit der leidenschaftlichen Gärtnerin, die sie ein paarmal kurz zu Gesicht bekommen hatte? Als Mutter sie eines Tages endlich wieder erspähte, knüpfte sie ein Gespräch mit ihr an. Die ältere Italienerin erzählte, dass sie gerade eine Brustkrebs-OP überstanden habe. Mutter revanchierte sich und berichtete ihr sofort von ihrer eigenen Krankheit, die vor fünfzig Jahren zum ersten Mal ausgebrochen war. Und, wie man sehen könne, sie lebe immer noch, sie sei noch immer hier! Der Frau habe das Mut gemacht, und der Garten sei wieder aufgeblüht, so jedenfalls hat Mutter uns das berichtet.
In diesem Jahr jedoch findet keine Inspektion des Gartens statt, in diesem Jahr unternimmt Mutter keine Ausflüge, allerhöchstens fährt sie mit mir im Auto irgendwohin. Meine Tochter, die nicht mehr zu Hause wohnt, kommt oft zu Besuch, um die Anwesenheit ihrer Oma zu genießen. All die tschechischen Leckerbissen, die sie mitgebracht hatte, sind längst verzehrt, und ich bereite ständig neue Speisen zu, Suppen aus Markknochen, feinen Hackbraten, Palatschinken mit Schokolade. Mein Mann und meine Tochter lassen es sich schmecken, sogar das Fell des Katers glänzt wieder, während Mutter nur den Teller wegschiebt – für sie schmecke alles nach Stroh. Das Armband ihrer Uhr sitzt immer lockerer, genau wie ihre Ringe. Wie soll sie so zu Kräften kommen? Wie soll das weitergehen? Sie sieht mich mit Augen an, die eine Antwort fordern, oder zumindest einen konkreten Plan, wie sich dieses wundertätige Hungergefühl einstellen soll. Und mir graust schon jetzt bei dem Gedanken, sie in diesem Zustand nach Prag zurückzuschicken.
Und dann kam jener schicksalhafte Dienstag, an dem sich von einer Sekunde zur anderen alles geändert hat. Das Wetter an diesem Tag war sonnig, ich hatte es sogar geschafft, mit Mutter ein paar Schritte die Straße entlangzugehen, und zum Abendbrot hatte sie etwas Risotto gegessen. Eine kleine Portion, aber immerhin. Mein Mann und ich spülten gerade das Geschirr, als ich ein leises Rufen hörte. Ich hatte keinen Sturz, keinen Aufprall gehört, nur dieses Rufen, so schwach wie das Säuseln des Windes. Hatte ich mich verhört? Als ich ins Zimmer kam, dauerte es einen Moment, bis ich sie bemerkte. Sie lag auf dem Boden. In diesem Augenblick eilte mein Mann herbei, hob sie auf und trug sie zum Sofa. Mutter zitterte und kniff vor Schmerz die Augen zusammen, behauptete aber zugleich, dass es nicht weiter schlimm sei. Sie sei über den Teppich gestolpert, nichts von Bedeutung. Diesen Teppich hatte sie selbst für uns gekauft, wir wollten ihn eigentlich gar nicht haben, aber sie hatte darauf bestanden. Auf dem glatten Holzfußboden konnte man leicht mit ihm wegrutschen, und ich hatte schon vorher überlegt, ob wir ihn nicht lieber zusammenrollen und wegtun sollten.
»Nur keine Aufregung«, beschwichtigt sie, als sie unsere erschrockenen Gesichter sieht. »Ich ruhe mich nur ein wenig hier auf der Couch aus. Macht mir die Nachrichten an.«
Nachrichten zu schauen ist eines ihrer Lieblingsrituale. Bei ihr zu Hause wurde es immer mit einer geregelten Abfolge kleiner Handlungen eingeleitet: Sie bereitete sich ein leichtes Abendbrot zu, einen Salat mit zwei dünnen Scheiben Brot, ein Stück Schinken oder Käse und ein Gläschen Rotwein. All das stellte sie auf ein Tablett und trug es ins Wohnzimmer. Dann musste sie nur noch den Fernseher einschalten, sich in den Sessel setzen, einen warmen Schal über die Füße werfen und sich um nichts anderes kümmern als um den Lauf der Welt.
In Zeiten allgemeiner Verunsicherung und nicht erwartbarer Umbrüche boten diese Rituale ihr Halt. Mit zunehmendem Alter feilte Mutter sie ständig weiter aus. Kaum schlug sie morgens die Augen auf, reckte und streckte sie sich, gab einen bestimmten Laut von sich, der nur für diesen morgendlichen Moment reserviert war, und schielte dann mehrmals vor sich hin (chinesisches Yoga, gut für die Augen). Dem ersten Schluck Tee schickte sie einen zufriedenen Seufzer voraus: »Ach, Tee ist eine gute Sache!« (wichtig für die Seele). Den täglichen Spaziergang durch den Park (wichtig, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, und für die Inspiration) leitete sie damit ein, dass sie sich eine Lutschtablette Vitamin C in den Mund steckte (wichtig für die Widerstandskraft). Ein morgendliches Regelwerk von Übungen half ihr beim Wachwerden, ein abendliches beim Einschlafen, das tägliche Bürsten der Haare – genau hundertmal – war wohltuend für das Gehirn. Und was konnte nach all den turbulenten Jahren, in denen sie häufig ohne Geld und ohne ein Dach über dem Kopf gewesen war, angenehmer sein als sich jeden Sonntag ein Mittagessen in dem immer gleichen luftigen Restaurant zu gönnen, in dem sie auf der Speisekarte keine Überraschung erwartete und wo sie das ganze Personal kannte? Und wo im Übrigen vor dem Krieg auch schon ihre Mama hingegangen war, um bei einem Kaffee mit ihren Freundinnen zu plaudern.
Diesmal aber helfen die Fernsehnachrichten nicht. Ich biete ihr an, mit mir in unserem Bett zu schlafen, damit sie es in der Nacht näher ins Bad hätte, und zu meiner Verwunderung, denn eine solche Intimität pflegten wir miteinander nicht, nimmt sie meinen Vorschlag spontan an. In dem Augenblick jedoch, in dem sie ihre Beine auf den Boden herablassen soll, wird klar, dass es Zeit ist, einen Krankenwagen zu rufen.
Es kommen zwei Sanitäterinnen in grünen Uniformen. Beide unglaublich jung, die eine dünn wie eine Bohnenstange. Ihr genügt es, nur schnell die Decke zurückzuschlagen und einen Blick auf Mutters Haltung zu werfen, um ohne Umschweife zu verkünden, dass es nach einem Oberschenkelhalsbruch aussehe. »Das kann doch nicht sein!«, wundert sich meine Mutter.
»Ist eines Ihrer Beine kürzer als das andere?«, fragt die Sanitäterin. Mutter schüttelt den Kopf. »Dann ist es klar.«
Während sie eine Morphiumspritze gegen die Schmerzen bekommt, plaudert und scherzt meine Mutter, wie es ihrem Naturell entspricht, mit den beiden Mädchen, eines erinnert sie sogar an ihre Enkelin. Die beiden wissen das zu schätzen, das dünne erklärt, dass es diese Dame gern für immer mit nach Hause nähme. Auch wenn das Mädchen mit den rosa gefärbten Haaren dies während seines Dienstes wahrscheinlich unzählige Male wiederholt, freut Mutter sich. Und ich auch, ich entgegne sogar: »Ich bedaure, aber das geht nicht. Sie ist nämlich meine Mama.« Dass ich sie grenzenlos liebe, behalte ich für mich.
Grenzenlos, das ist das richtige Wort. Schon vor langer Zeit, noch in der Jugend geriet ich sofort in Wut und verteidigte sie, wann immer jemand auch nur den leisesten Hauch einer Kritik an ihr übte, meist ihre politische Haltung betreffend nahm ich sie sofort zornig in Schutz. Und verfiel zugleich in innere Panik, und das umso heftiger, je mehr ich dieser Kritik innerlich zustimmte. In meinen Augen musste Mutter immer recht haben, sie musste fehlerlos sein und perfekt. Zwischen uns bestand die stille Übereinkunft, dass man an ihren Qualitäten nicht zu zweifeln und erst recht keine Witze über sie zu reißen hatte. Heute erkläre ich mir das so: Das Ignorieren ihrer Schattenseiten war eine lang erprobte und bewährte Methode, mit dem bedrückenden Schuldgefühl fertigzuwerden, dass sie überlebt hatte, und die anderen nicht. Dieses Geschenk musste sie sich immer wieder aufs Neue verdienen. Was aber sollte meine starrsinnige Bewunderung? War das vielleicht meine Furcht, dass sie sich von mir abwenden könnte, sobald ich eine wie auch immer geartete Regung gegen sie verspürte, oder sogar äußerte? Oder dass sie – und das war die wesentlich schlimmere Option – wieder verschwinden könnte? Hatte ich sie doch in der Kindheit schon einmal verloren.
Und jetzt jagt ein Krankenwagen mit meiner Mutter, die auf eine Pritsche geschnallt ist und eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht hat, durch die Straßen Londons. »Ich bitte dich, sieh mich nicht so dramatisch an«, ermahnt sie mich, als sie meinen Blick auffängt. »Du nimmst mir dadurch die Kraft.«
Schlechte Nachrichten
Es ist nicht einfach gewesen, mit Eltern aufzuwachsen, die Helden waren. Mein Vater hatte sich als junger Mann auf den Weg nach Spanien gemacht, um gegen die Franco-Diktatur zu kämpfen, Mutter hatte das Leben durch mehrere Gefängnisse geführt, lange Zeiten unter den Bedingungen der Einzelhaft mit eingeschlossen. Sie hatte grausame Behandlung erfahren müssen und sich trotz alledem einen lebenslangen Optimismus bewahrt.