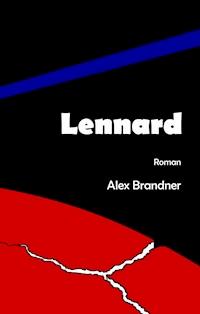
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der unbekümmerten Zeit zwischen Schulabschluss und angehendem Studium beginnt Lennard sein außergewöhnliches künstlerisches Talent zu entfalten. In atemberaubenden Arbeiten bannt er das Leben auf Leinwand und erschafft so sein Bild der Welt. Auf der Suche nach dem Urgrund allen Seins will er aber auch Kraft seines scharfen Verstandes Erkenntnis erlangen. So taucht er tief in die Gedankenwelt der Philosophie ein und verschlingt mit zunehmender Intensität die Werke der philosophischen Geistesgrößen aller Epochen. Lennards hungriges Genie kontrastiert zwangsläufig mit seiner weltlichen Umgebung. Hier steht sein bester Freund, der keinen Spaß auszulassen scheint, unbeschwert fröhlich mit beiden Beinen im Leben. Aufgrund der munteren Gesellschaft seiner Freunde fehlt es nicht an skurrilen Begebenheiten und lustigen Episoden. Zu Lennards Welten erlangen wir Zugang über die von ihm dargestellten Werke, in gelegentlichen philosophischen Diskursen und in eingeflochtenen Allegorien. Seine rastlose Suche nach der Antwort auf die Frage aller Fragen entwickelt sich aus dreierlei Richtungen: der Kunst, des Verstandes und der Liebe. Doch worin zeigt sich letztlich die Offenbarung allen Seins? Eine ungeahnte Wendung lässt ihn Antworten finden ... Ein mit Witz und Tiefgang geschriebenes Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für B., P., M. & nochmal P.
Inhaltsverzeichnis
Favo
Wir packen aus
Der Wettbewerb
Schöner Abschied
Das grosse Malen
Aufklärung im Schwimmbad
Espresso
Musik
Nietzsche und Turner
Beatrix’ Ropati
Im Liver
Vernissage
Das blaue Bild
Weisse Fee über dem See
Gott Marco
Die Sonne geht im Osten auf
Ben’s
Wir im Zelt
Yo kocht
Ein Spiel
Die Philosophie zieht mit
Felix
Nur einmal noch
Jeder verhandelt
Der Piepmatz
Neujahr
Keine kleinen weissen Blumen
Lennards Vater
Der Rest der Sonne
1. FAVO
Fabian Vogt war Kunstlehrer, was für sich genommen schlechthin eine Untertreibung ist. Bereits zur Schulzeit mochten wir ihn auf Anhieb. Er war von stattlicher Figur und hatte eine wehende, hell ergraute Mähne und einen ebenso grauen Bart. Da er fast ausschließlich in weißem Hemd mit meist schwarzer Weste und dazu passendem Jackett in Erscheinung trat, glich er unserer Vorstellung eines Gelehrten des vorvorigen Jahrhunderts bis ins Detail. Einige, die ihn zum ersten Mal sahen, fühlten sich aus der Ferne an das aus jedem Geschichtsbuch bekannte Bild von Karl Marx erinnert.
Diesen Vergleich hörte Fabian Vogt aber gar nicht gerne, zumal er bei näherer Betrachtung auch nicht wirklich zutraf. Wenn überhaupt Ähnlichkeiten mit vergangenen Größen Geltung haben durften, so hatte er die fast schulterlangen Haare eines Franz von Liszt, während seine Barttracht mit der Andeutung eines Schnurrbartes an Verdi erinnern konnte. Im Gegensatz zu diesen beiden verrieten seine kleinen dunklen Augen aber einen, spitzbübischen Charakter, den ich im Laufe der Zeit immer mehr schätzen lernte. Sein Mund, der, hinter dem Bart versteckt, zu lächeln schien, strahlte nicht ausschließlich Liebenswürdigkeit aus, sondern verriet vielmehr eine zufriedene Überlegenheit. Daher wusste er durch einen weltgewandten und weltmännischen Gesichtsausdruck zu bestechen, mit dem er reihenweise Schülerinnen und insbesondere Kolleginnen hinzureißen im Stande war.
Wenngleich ich mit meinen Kunstwerken nicht allzu sehr brillieren konnte, sah er, der Künstler, doch immer und ganz ohne Ironie, mit der er ansonsten nicht sparsam umging, etwas Wertvolles in dem, was man tat. So war das Gemalte doch eben das Werk eines jeden einzelnen, wodurch er es verstand uns beizubringen, die bildenden Künste ernst zu nehmen. Dem Unterricht fehlte es aber keineswegs an Witz, insbesondere wenn er als Kunstschaffender ob beim Ton formen, Aquarellieren oder Kohle zeichnen selbst ans Werk ging. In kürzester Zeit erstanden unter Favos Händen lustigste Tonfiguren, bunt-abstruse Aqurelllandschaften oder obskure, hämisch lachende Kohleskizzen. Fabian Vogt pflegte seine Bilder mit ,Favo’ zu signieren und erklärte, dieses Kürzel in Anlehnung an ‚les fauves’ zu verwenden, was bei einigen seiner Ölbilder, die durch kraftvolle Linienführung und intensive Farben bestachen, unmittelbar einleuchtete. Für uns legte natürlich seine oft ungewöhnlich wilde Frisur den Namen Fauve nahe.
In der Kunstgeschichte war Favo außerordentlich bewandert, so dass er zu fast jedem kleinen und großen Kunstgenie eine Anekdote parat hatte. Wenn dies einmal nicht der Fall sein sollte, erfand er wenigstens eine gewitzte Geschichte, wobei er uns am Ende umwunden offenbarte, dass das eben Erzählte auf seinem Mist gewachsen war: „...und wenn es aus unbekannten Gründen unter Umständen nicht so gewesen sein sollte, was meiner Vorstellung nach nahezu unmöglich scheint, dann ...“ Dann schloss Favo schnellstens die Erzählung ab, bevor er sich restlos in dieser zu verheddern drohte. Nachdem ein tiefer Seufzer ihn in die Unterrichtsrealität zurückgeholt hatte, blitzten alsbald seine Augen auf: „Jetzt aber ran an die Arbeit!“
Selbstverständlich war er erbarmungslos in seiner Kritik an Scharlatanerie in der Kunst und noch erbarmungsloser kritisierte er die meist selbst ernannten Kunstkritiker. Ohne Zweifel zählte er sich aber selbst ebenfalls zu diesen und setzte mit von Ironie getragenem Stolz noch einen oben drauf: „Welcher dieser gewichtigen Männer hätte denn überhaupt den Mumm, mich als über ihnen stehenden Kunstkritiker zu ernennen?“
Respekt durch irgendwelche Sanktionen musste er uns nicht einflößen. Wir fragten uns seinerzeit, vor wem man denn Respekt haben sollte, wenn nicht vor ihm. Für uns war er sehr bald eine nahezu unanfechtbare Instanz des Intellekts geworden, und damals war mir keineswegs klar, ob ich es überhaupt einmal nötig haben würde, ihm zu widersprechen.
Favo war interessiert am Menschen an sich, er selbst war ein Mensch des Geistes. Ein ungeheures Wissen in Literatur, Philosophie und der Menschheitsgeschichte schlechthin schien in ihm versammelt. Man war versucht zu sagen, dass sich in ihm die Geisteskultur des Westens verkörperte, zumal er die Historie der entsprechenden Disziplinen derart verinnerlicht hatte, als ob er sie durchlebt hätte. So konnte kaum verwundern, dass Favo einem wandelnden Zitatenschatz glich, den es erfreute, einen hin und wieder berühmte Aussprüche erraten zu lassen. Seine Freude steigerte sich noch darin, eigene Zitate einzustreuen, bei denen er munter funkelnde Augen bekam, wenn man eben dieses einem seiner Lieblingsautoren oder Denker zuschrieb.
Soweit seine Welt der Geistes- und Kulturwissenschaften die Kreise der Naturwissenschaften oder der Mathematik berührten, zeigte er hierfür ebenfalls reges Interesse. Oft traf man ihn mit Tomas Toffas, unserem einstigen Physiklehrer, an, der ihn gerne in angeregte und sicherlich anregende Diskussionen über irgendwelche philosophischphysikalische Themen verwickelte.
Wie sein Name unschwer erahnen lässt, hatte Tomas Toffas seine familiären Wurzeln in Ungarn, die dadurch verdeckt wurden, dass seine Eltern mit dem damaligen Wegzug und der Ankunft im neuen Land seinen Namen von Tamás zu Tomas ändern ließen. „Keine Bange, ich vermisse den Akzent nicht“, hatte er uns versichert.
Seine äußere Erscheinung entsprach so gar nicht derjenigen Favos: Er war gut einen Kopf kleiner, hatte kurzes, schwarzes Haar und war von drahtig-sehniger Statur. In seinem Gesicht mit dunklem Teint lagen haselnussbraune Äuglein, die meist freudig aufmerksam umhersprangen, manchmal aber auch traurig in die Ferne blicken konnten. Tomas war für uns – wie auch sein Land – bekannt für seine Vorliebe für Tokaja, den wir bei späteren Einladungen seinerseits in größeren Mengen mitgenießen durften. Es kam nie vor, dass der Kofferraum seines Autos nicht mit Flaschen gefüllt war, wenn er seinen ungarischen Verwandten wieder einen Besuch abgestattet hatte. Er lebte mit seinem Sohn schon lange Zeit hier und sprach daher nahezu perfekt unsere Sprache. Nett fanden wir, dass Tomas das ‚ng’, wie in ‚Zeitungen’ nicht nasal, sondern mit diesem leicht anklingenden ‚g’ aussprach, was insbesondere durch seine hohe Sprechgeschwindigkeit für uns schon rein physiologisch ein Phänomen war. Wenn Favo und Tomas eine ihrer hitzigeren Diskussionen pflegten und dabei die Hitze weiter anstieg, hatte Tomas die lustige Angewohnheit mit dem Zeigefinger in den wohlgeformten Bauch Favos zu stupsen. Dieser kuriose Akt leitete schließlich das letzte Argument ein oder war es oft bereits selbst. Hierdurch senkte sich für gewöhnlich die Temperatur erheblich, und der Disput fand unter beiderseitigem Lachen ein Ende.
Neben seinem philosophischen oder metaphysischen Interesse hatte Favo für alle naturwissenschaftlichen Neuigkeiten ein offenes Ohr, da, wie er gerne betonte, die Technik der Menschen Kultur entsprang. Allerdings war er nicht milde im Urteil bei so manch verwegenen technischen Errungenschaften, wie sie sich beispielsweise bei pervers ausgefeiltem Kriegsgerät finden. Auf der anderen Seite zeigte er ohne Scheu eine fast kindliche Freude im Umgang mit technischem Schnickschnack, bei dem zweifelhaft war, ob er dem Menschen in seinem menschlichen Fortkommen tatsächlich hilfreich war. Dies war der Hauptgrund, weshalb wir bei Besuchen nie Mühe hatten, Favo ein Mitbringsel oder zu seinem Geburtstag ein Geschenk zu besorgen, das Favos Augen glückselig aufblitzen lassen würde.
Wie sich zeigte, sollte der Kontakt zu Favo nie abbrechen, selbst lange nach der Schulzeit fanden wir uns immer wieder bei ihm in seiner Wohnung ein.
*
Für Lennard war Favo der Glücksfall schlechthin. Schon in den ersten Kunstunterrichtsstunden erkannte Favo Lennards außergewöhnliches Talent. Er verschlang alles, was ihm Favo über bildende Künste zu erzählen vermochte. Er lernte unmittelbar die ausgefeiltesten Techniken, um Bleistift- und Kohlezeichnungen, Bilder in Öl sowie tönerne Skulpturen zu fertigen. Für jeden neuen Trick, den Favo ihm beibrachte, und für jede sonderbare technische Raffinesse zeigte Lennard sich dankbar. Oft ergab es sich, dass die beiden die gesamte Mittagszeit im Atelier, wie wir das kleine, vollgestopfte Zimmer neben dem Kunstsaal nannten, verbrachten, um dort Leinwände auf Rahmen zu spannen, neue Farben auszuprobieren oder Zeichnungen zu besprechen.
Bald vermochte Lennard in unfassbarer Perfektion im Stile der verschiedensten Kunstrichtungen zu malen, was darin gipfelte, dass er am Ende der Schulzeit Favo neunfach auf ein in ebenso viele Quadrate unterteiltes Poster bannte: Dieses Werk begann oben links im für meine Augen eher steifen pompejanischen Stil, der aber gleich einem Mosaik gemalt und erst bei näherem Hinsehen von einem echten zu unterscheiden war. Unten rechts endete es in einer lustigen, bunten Favo-Knollenfigur von Nicki de Saint-Phalle. Am meisten Anklang fand die üppig-romantische Darstellung nach Rubens in der rechten oberen Ecke, in der man Favo schlechthin mit ,Wollust’ gleichzusetzen geneigt war. Dazwischen blickte man auf eine markige Kohlezeichnung, die der Renaissance zuzuordnen war: „Luca Signorelli, nicht Leonardo“, sagte Favo mit erhobenen Augenbrauen, „und dieser wuchs über Piero della Francesca hinaus.“ Während Lennard wortlos zuhörte, zwinkerte Favo ihm stolz weiter zu: „Du Luca, ich Piero, was? Lennard, molto bene!“ Das folgende Quadrat zeigte ein naturalistisches Caspar-David-Friedrich-Bild von Favo in einem dichten, grünen Wald, fast mystisch von zarten Sonnenstrahlen beschienen, was im Hinblick auf Favos Statur selbstverständlich ein Schmunzeln hervorrufen musste. Der Impressionismus war zentral etwa im Renoir-Stil vertreten, wo Favo durch die Punktierung in bunten Farben bizarr entfremdet wirkte. Tolle Farbflächen umrahmten Favos Blick im folgenden Toulouse-Lautrec-Miniposter. Es verwunderte nicht, dass Favo noch wilder wirkte, wenn man ihn nach Otto Dix darstellte, wie es Lennard unten links meisterhaft expressionistisch gelang. Ich erahnte, dass Favo sich selbst am liebsten mit der Darstellung nach Picasso identifiziert hatte. In der Tat erstaunte mich diese Zeichnung deshalb in großem Maße, da es Lennard geschafft hatte, mit wenigen Strichen einerseits Picassos Zeichenstil zu kopieren und andererseits Favos wesensgebende Züge darin widerspiegeln zu lassen.
Lennard selbst verbat es sich selbstverständlich irgendeinem Segment den Vorzug zu geben. Er nannte es untertrieben Übungswerk und überreichte Favo das Poster als Abschiedsgeschenk nach den letzten Abiturprüfungen, die nun gut ein Jahr hinter uns lagen.
2. WIR PACKEN AUS
Da lag nun das in Luftpolsterfolie eingewickelte Ungetüm eingezwängt zwischen ein paar Kisten und den restlichen Möbeln in Lennards ansonsten geräumigen Zimmer. Es befand sich im Tiefparterre. Aber da das Haus an einem Berghang lag, konnte man von dort direkt über eine kleine Terrasse in den Garten spazieren. Das war besonders für das nächtliche Reinspazieren recht praktisch, weil man dann nicht das ganze Haus aufwecken musste. Allerdings befand sich unmittelbar über der Terrassentür ein Schwalbennest, weshalb für gewöhnlich reichlich Dreck vor diesem Eingang lag. Meinem skeptischen Blick zum Dach hinauf entging nicht, dass das Nest bereits verlassen war, obgleich der Sommer gerade erst Einzug hielt, so dass ich sauberen Fußes das Haus betreten konnte.
Es war mit Lennards restlicher Familie, den Schönethals, und dazu gehörte sein nicht ganz einfacher Onkel, eine ausgemachte Sache, dass Lennard den Flügel von Großmutter Katharina bekommen sollte, weil er schließlich als einziger den nötigen Platz dafür hatte. Das war in Wahrheit das einzige Argument, das besagten Onkel dazu bewogen hatte, dieser Entscheidung zuzustimmen.
Wir rissen die durchsichtige Plastikfolie von Lennards neuem Instrument auf, wobei die Lufteinschlüsse reihenweise knallten, was uns zusätzlich zum Spaß des Auspackens ein Gefühl von nützlicher Arbeit verlieh. Endlich kam das elegante, schwarz glänzende Instrument zum Vorschein. Geistreicherweise waren die drei gedrechselten Holzbeine nicht angeschraubt. Auch die Pedale fehlten und warteten zusammen mit ihrem Hebelmechanismus in einer Kiste darauf, von uns wieder anmontiert zu werden.
Nur unter großen Anstrengungen gelang es uns, dieses dunkle Ungetüm aufzustellen. Wir platzierten den Klavierhocker und zwei weitere Stühle um den Flügel herum. Als erstes stemmte ich das Ende hoch: „Schnell“, stöhnte ich, „schieb’ den Hocker hier drunter.“
Völlig außer Atem von dieser nur Sekunden dauernden Aktion blickte ich noch nicht siegesgewiss auf das jetzt schräg liegende Ding vor uns.
„Irgendwie müssen wir den Hocker sichern, bevor er umkippt“, meinte Lennard.
„Da ist was dran, und zu lange warten sollten wir damit auch nicht“, führte ich seinen Gedanken aus.
Nachdem wir das Problem mit herbeigezogenen, schweren, büchergefüllten Kisten gelöst hatten, hoben wir die andere Seite des Instruments an, um dann gleichzeitig mit den Füssen die Sitzflächen der beiden anderen Stühle unter den Flügel zu bugsieren. Mit Schweißperlen auf der Stirn blickten wir uns stolz an. Der Stolz schwoll ins unermessliche, nachdem es uns endlich gelungen war, das Instrument mit den Beinen und den goldfunkelnden Pedalen zu komplettieren, woraufhin wir uns in das uns weich zugrinsende rote Sofa fallen ließen.
Lennards Blick fiel auf eine weitere Kiste, die unter dem Schreibtisch stand, und er machte sich nun daran, sie hervor zu bugsieren. Zum Vorschein kamen kiloweise Klaviernoten, die zum Teil mit fast antikem Notendruck hergestellt sein mussten.
Danach griff er zu einer länglichen, schmucken Schachtel, die obenauf lag und überließ mir den wunderbaren Schatz an gedruckter Musikkunst mit den Worten: „Das ist wohl eher etwas für dich. Du kannst selbstverständlich mitnehmen, was dir gefällt.“
„Lass mich mal schauen... ich kann doch nicht...“, stotterte ich wissbegierig bei dem Anblick dieses schönen Fundus’, und ich vertiefte mich sofort in die Notenstapel, die ich aus dem Karton hievte.
Schließlich hatte ich das Glück gehabt, seit dem vierten Lebensjahr auf Kosten der Nerven meiner Eltern und meiner Schwester Klavier spielen lernen zu dürfen. Dementsprechend hatte ich im Laufe der Zeit eine reichhaltige, allerdings wenig geordnete Sammlung an Klaviernoten auf, neben und um meinem alten Klavier herum angelegt. Das Klavierspiel war eines der ganz wenigen Dinge, genauer gesagt das einzige, was ich außergewöhnlich gut konnte und wovon ich glaubte, ein echtes Talent zu haben.
Als ich einen französischen Band sämtlicher Chopin-Walzer entdeckte, setzte ich mich an Lennards neuen alten Flügel und spielte voller Entzücken den Minutenwalzer, um gleich den Tastenanschlag des Instruments zu testen, der, wie sich herausstellte, wunderbar leicht war und sehr rasche Repetitionen zuließ. Dies gipfelte darin, dass ich die Taktgeschwindigkeit ununterbrochen steigerte, was Lennard erst zu einem Lächeln und schließlich zu einem herzlichen, offenen Lachen veranlasste, wie ich es bis dahin von ihm noch nicht gekannt hatte.
Erstaunt wandte ich mich nach der gespielten Minute Lennard zu: „Kanntest du den berühmten Minutenwalzer etwa noch nicht?“
„Natürlich“, wiegelte Lennard ab, „den kenne ich schon lange, sehr lange.“
Er lehnte sich mit verschränkten Armen an den Flügel, nachdem ich mich noch einmal vergewissert hatte, dass dieser sicher stand, und holte aus: „Wie du weißt; war ich früher als kleiner Junge und auch zur Schulzeit sehr häufig bei meiner Großmutter. Meine Eltern haben sich im Studium kennen gelernt und in derselben Kanzlei ihre Arbeit begonnen. So ergab es sich, dass ich oft bei meiner Großmutter Katharina übernachten durfte und manchmal auch wochenweise bei ihr war. Da stand dieser schöne, schwarze Flügel im prächtigen Salon ihrer Gründerzeitvilla mit dem Klavierbänkchen davor. Du warst doch auch mal da?“
„Klar...“, warf ich ein.
Er fuhr unerschrocken fort: „Und ich patschte als kleiner Pimpf auf den Tasten herum, woraus aber bis heute bekanntermaßen nie etwas Großartiges geworden ist. Eines Tages, ich erinnere mich genau, nahm sie mich an ihrem Flügel auf den Schoß und raste immer schneller den Minutenwalzer runter, bis ich sie am Ende Lachtränen überströmt mit lautem ‚Nochmalnochmal’-Gerufe aufforderte, das Stück ein zweites und ein drittes Mal zu spielen.“
Dich, Deine Gegenwart vermisse ich.
Lennard blickte ins Leere und durchbrach das Schweigen nach einer Pause: „Das ist überhaupt meine erste Musikbegegnung, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Und Franziskus schaute uns dabei zu.“
Lennard nahm vorsichtig seine bei seiner Großmutter lieb gewonnene Statue, die ihn sein junges Leben lang begleitet hatte, aus der Schatulle und stellte sie vorsichtig auf den Flügel.
Mir wurde immer klarer, wie eng Lennards Beziehung zu seiner Großmutter gewesen sein musste. Zwar lag die Beerdigung bereits einige Wochen zurück, war mir in diesem Moment aber präsenter denn je. Glücklicherweise hatte ich kurzfristig entschieden, dort zu erscheinen. Obgleich mir Lennard schon am gleichen Tag vom Tode seiner Großmutter berichtet hatte, sprachen wir nicht über die bald stattfindende Trauerfeier oder gar darüber, ob es ihm recht gewesen wäre, wenn ich dort anwesend sein würde.
Ich lief zu Fuß die leichte Anhöhe zum Friedhof hinauf und fragte mich an diesem grauen, regnerischen Tag, ob es bei Beerdigungen denn immer regnen und ein grauer, kalter Wind wehen müsse. Da ich zum ersten Mal eine Trauerfeier miterlebte, konnte ich diese Frage nicht mit Klarheit beantworten.
An einer Hecke schnitten Gärtner herausstehende, frische grün-freche Triebe heraus, was von zwei krächzenden Krähen mürrisch beäugt wurde. Ein paar Meter weiter fand ich sonderbar große Mülltonnen, die übervoll mit ausgedienten roten Totenlichtern gefüllt waren. Eine mächtige dunkle Wolke betonte, dass heute die Sonne nicht mehr zu sehen sein werde, und es begann kräftiger zu regnen. So eilte ich durch das Friedhofstor, an traurigen Gräbern vorbei hin zur Kapelle.
Auf den letzten Metern schwirrten mir Abschätzungen durch den Kopf, wie viele Beerdigungen ich denn mitmachen müsste, um bei einer über das Jahr zufällig angenommenen Verteilung von Regentagen mit signifikanter Aussagekraft behaupten zu können, dass es bei Beerdigungen nahezu immer regnet. Diese pietätlos anmutenden Gedanken verloren sich aber rasch, als ich in die Friedhofskapelle trat. Darin waren viele dunkel gekleidete Herrschaften, Verwandte und noch mehr Bekannte der Verstorbenen versammelt, die sich bereits auf die Bänke zu verteilen begannen. Ich setzte mich ebenfalls und erkannte Lennard von hinten neben seinen Eltern in der ersten Reihe sitzen.
Das Verhältnis zu seiner Mutter war nicht besonders ausgeprägt, von außen betrachtet fast nüchtern. Sie war zwar eine liebenswerte aber doch eine überaus ehrgeizige Frau mit klarem Blick für Karriere und berufliche Ziele. Daher fand sie kaum Zeit für häusliches Familienleben, dem sie ohnehin nicht viel abzugewinnen schien.
Lennards Vater hingegen hegte reges Interesse am schulischen Tun seines Sohnes, insbesondere je älter sein Sprössling wurde. In vielen nächtlichen Unterhaltungen, die ursprünglich von den behandelten Sachthemen der verschiedenen Fächer ausgingen, diskutierten sie reichlich und sicher gewinnbringend über alle möglichen Aspekte. Dementsprechend gewannen diese Gespräche höchstens dadurch eine persönliche Note, wenn der Vater begann, aus seinem Erfahrungsschatz zu schöpfen und hie und da eigene Erlebnisse schilderte.
Daher suchte Lennard, wenn ihn etwas tief bewegte, das Gespräch zunächst mit seinem Vater, ehe er sich mit seiner Mutter besprach. Man konnte sich sicher sein, dass es dem Vater als Jurist in einer angesehenen Anwaltskanzlei wahrlich Leid tat, wenn er aufgrund seines Berufes nicht die Zeit fand, mit Lennard zu sprechen.
Andere Verwandte glaubte ich nicht zu erkennen. Außer einem mürrisch dreinblickenden, stämmigen Mann, der so gar nichts von Lennards Statur hatte, von dem ich meinte, dass er Lennards wenig beliebter Onkel sein müsse. Im gleichen Moment dachte ich: ,Der Mann ist aufrichtig.’ Denn er bemühte sich wenigstens nicht freundlich zu tun, wenn er es das sonstige Jahr über ja auch nicht war.
Die Trauerfeier wurde von einem freundlich dreinblickenden, etwas gebückt gehenden Geistlichen durchgeführt. Er war ein enger Bekannter der Verstorbenen gewesen, und so ergab es sich, dass er einen beeindruckenden und bewegenden Nachruf in freier Rede vortrug. Alle lauschten gebannt. Alle waren in den wunderbar stillen Pausen in Gedanken vertieft.
Merkwürdig, dass Menschen das Leben erst zu vergegenwärtigen scheinen, wenn der Tod sie dabei streichelt.
Beim Verlassen der Kapelle erhaschte ich einen Blick von Lennard, dessen aufblitzende Augen verrieten, dass ihn meine überraschende Anwesenheit sehr freute. Während ich in dem Trott der Leute mitging, zerbrach ich mir den Kopf, in welcher Form ich denn kondolieren könnte. Diese Gedanken führten zwar weit aber zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Vor dem offenen Grab mit dem herabgelassenen Sarg sprach ich zunächst Lennards Eltern schlicht mein Beileid aus. Nun stand ich vor Lennard und blickte in seine getrübten Augen. Ich gab ihm meine Hand und legte die andere um seine Schulter. Sogleich zog er mich an sich und umarmte mich. Es ist in der Tat schwer nachzufühlen, wie einem ein Stück aus dem Herzen herausgeschnitten wird. Meine wortlose Anteilnahme ließ mir die Tränen in die Augen schießen, und mir wurde bewusst, welch großer Verlust dieser Tod für Lennard bedeuten musste.
Bevor er mich entließ, schauten wir uns durch diese eindrucksvolle Erfahrung in unserer Freundschaft tief gestärkt dankend an. Nachdem ich eine Weile beiseite gewartet hatte, kam Lennard zu mir, um mir nochmals für mein Kommen zu danken. Ich meinte, er solle lediglich wissen, dass ich für ihn da sei und es mir schwerfiele, nachzuvollziehen, wie es ihm denn tatsächlich ginge.
*
Ich selbst hatte Lennards Großmutter, wenn er bei ihr anzutreffen war, zwar einige Male gesehen. Es wäre aber vermessen zu behaupten, dass ich sie dadurch sehr gut kennen gelernt hätte. Sie hatte früh ihren Mann verloren und war mit ihren beiden Söhnen zurück zu ihrem Vater, der schon einige Jahre später starb, in das prächtige Haus gezogen, das nur zwei Straßen weiter im alten Viertel lag. Obwohl sie vom Lebensglück nicht sehr beschenkt wurde, war sie eine lebensfreudige Frau gewesen und hatte zugleich etwas von einer wohlerzogenen Dame des Bildungsbürgertums alter Schule. Jeder, der zu Besuch gekommen war, verließ ihr Haus mit einem Lächeln, und der restliche Tag schien einem nichts mehr anhaben zu können.
Die grundpositive Haltung zog sie unzweifelhaft zu großen Teilen aus ihrer Religiosität, die nicht so sehr dem frommen sonntäglichen Kirchgang als vielmehr den ihrer Meinung nach wahrlich christlich lebenden Menschen verpflichtet war. Bis ins hohe Alter und bis kurz vor ihren Tod behielt sie eine beneidenswerte Würde, sie ließ sich nicht gehen, sie litt nie vor anderen, sich zu beschweren war ihr fremd. Es war nicht Stolz, der bei so manchen von einem Hauch Arroganz umweht war, es war ihre Würde, mit der sie ihr Leben meisterte, die einen beeindruckte. Lennard spendete die Gewissheit Trost, dass seine Großmutter immer in ehrlichem Umgang mit dem Tod, der die Seelen heimholte, gelebt hatte und sie darin ihrem Glauben entsprechend Friede gefunden haben musste.
Wir hatten früher am Ende unserer Schulzeit miteinander reichhaltige Diskussionen bis lange in die Nacht hinein geführt über die Wurzeln unserer Kultur und der damit verbundenen Bedeutung des Christentums. Selbstverständlich hatten wir schnell die allzu naheliegenden Kritiken an der Amtskirche, an verbissener Radikalität, an päpstlichen Dogmen und befremdlichen Weisungen hinter uns gelassen, um uns lieber mit dem zu befassen, wovon wir glaubten, dass es Kern der Religionen sei. Anfangs setzten wir uns mit der politischen Dimension wie beispielsweise dem Missbrauch von Religion oder von Menschen gemachter Ideologien auseinander und lasen reichlich Bücher, um der geschichtlichen Entwicklung ein wenig gerecht zu werden. Doch um dem eigentlich christlichen Glauben und seinem Prinzip Liebe näher zu kommen, begannen wir Stellen aus der Bibel herauszusuchen, die wir in naiver Exegese sezierten. Nicht selten kamen wir zu dem Schluss, dass Lennard doch aus dem in reichlich gesunden Erfahrungsschatz eingebetteten Bibelwissen seiner Großmutter Katharina schöpfen sollte.
Nur ein oder zweimal kam ich daraufhin mit zu Lennards Großmutter, wo wir uns in der Nähe des Flügels, auf dem Franziskus thronte, mit einer Tasse Tee wissensdurstig auf Thonetstühlen niederließen. Dort trug sie mit mildem, fast buddhistischem Lächeln nie verlegen Ansichten vor, erzählte etwas aus Biographien oder rezitierte weit weisende Sätze. Bereichert um neue Ansichten und Verknüpfungen mit anderen Textstellen setzten Lennard und ich einige Tage später unsere Reise in die Religionen fort.
Mit dieser Franziskusstatue verband Lennard außer der Erinnerung an seine Großmutter all diese zu bejahenden Eigenschaften des Christentums, die er durch sie erfahren und die sie seiner Ansicht nachgelebt hatte. Mit einem Blick auf diese wunderschön gearbeitete Porzellanstatue fragte ich:
„Hast du deiner Oma denn auch deinen Zweitnamen zu verdanken?“
„Ja, und da bin ich ihr sicher nicht böse. Franziskus von Asissi. Wir waren mit der Familie – ja tatsächlich, meine Mutter und ihre Schwiegermutter waren dabei – in seiner Heimat, in Asissi gewesen.“
Lennard hielt inne und ließ noch einmal diesen Italienaufenthalt Revue passieren.
„Dort hatte ich eine Menge Spaß und Großmutter Katharina hat mir alles Mögliche erzählt und geduldig meine Fragen beantwortet. Es kommt mir schon wie eine halbe Ewigkeit vor.“
Unwillkürlich blätterte ich wieder in dem Notenstapel herum, woraufhin Lennard mich fragte:
„Was meinst du denn zu dem Flügel?“
„Klingt gar nicht mal so verstimmt, wie ich es wegen des Transports in dieser Sommerhitze befürchtet hatte. Sehr schöner Tastenanschlag ... und die tiefen Töne ... Hör mal!“, und ich setzte an, eine Abfolge von Akkorden bis zum tiefen ,A’ durch den Raum dröhnen zu lassen.
„Einfach klasse!“
Lennard sah amüsiert zu, wie ich mich in das Klavierspiel hineinsteigern konnte, und er meinte mit Blick auf die Notenkiste:
„Nimm doch alle Noten mit.“
„Aber ich kann doch nicht…“, entgegnete ich reflexartig. Aber offensichtlich muss meine Mimik ehrlicherweise das genaue Gegenteil verraten haben. Er ergriff die Kiste, drückte sie mir in die Hände und stapelte die paar anderen umherliegenden Notenhefte obendrauf.
Voll bepackt verabschiedete ich mich kurz und machte mich bestens gelaunt auf den Weg nach draußen. An meinem alten Fahrrad angelangt, mühte ich mich ab, die Kiste auf dem Gepäckträger zu befestigen.
In diesem Moment kam Beatrix über die Straße gelaufen, Beatrix von Mayendorff. Sie sah toll aus, wie sie schlank und elegant mir ihrem offenen, wehendem Haar herüberschritt. Mir schoss durch den Kopf, dass sie ihrem edlen Namen, aus dem sie glücklicherweise, bescheiden wie sie war, nie einen Hehl machte, allein durch ihre angenehme, ansehnliche äußere Erscheinung einmal mehr alle Ehren erwies.
„Hallo Beatrix, das ist ja eine schöne Überraschung. Wann bist du denn wieder zurückgekommen?“
Sie war offenbar vor kurzem von ihrem Au-pair-Aufenthalt in London zurückgekehrt.
„Hallo, du, ich bin gestern Abend wieder gelandet, und ich dachte, dass ich euch sicher hier bei Lennard antreffen werde.“
Wir begrüßten uns umständlich, da ich es nicht wagte, meinen Notenschatz aus den Händen zu geben.
„Ist Lennard denn da?“
„Ja klar, du kannst unten reingehen, er freut sich bestimmt.“
Da ich wusste, dass Beatrix ganz gut und vor allem gerne Klavier spielte und mir schon oft zugehört hatte, fügte ich ihre Neugierde weckend hinzu:
„Und schau dir seine neue Errungenschaft an!“
3. DER WETTBEWERB
Am ersten verregneten Julisonntag rief mich Favo an, um sich mit uns in der Stadt zu verabreden. Bevor ich Lennard zu diesem Treffen abholte, musste ich unbedingt bei Elinas Wohnung vorbeifahren, um dort endlich meiner Pflicht nachkommen zu können, ihren Briefkasten zu leeren und die hoffentlich noch nicht verdorrten Blumen zu gießen. Mein Gewissen trübte sich passend zum Wetter ein, weil ich zu allem Unglück zunächst Elinas Wohnungsschlüssel nicht fand. Sie hatte sich genau vor einer Woche damit vertrauensvoll an mich gewandt, da ihre Nachbarin ebenso wie sie selbst für vierzehn Tage verreist war. Und heute erst erinnerte mich der Regen, der sich hoffentlich schon um die Balkonblumen gekümmert hatte, an mein Versprechen.
Als ich an ihrem Haus angekommen war, stieg ich wegen des heftigen Regens besonders rasch vom Rad ab und stiefelte tropfnass drei Stockwerke hinauf. Um innen nicht alles nass zu machen, legte ich zunächst meine wassergetränkte Jacke im Treppenhaus über das Geländer und begann mit dem Versuch, die Tür zu öffnen.
Der Schlüssel passte nicht!
‚Typisch, erst finde ich den Schlüssel nicht und dann Das!’, dachte ich, ,das kann wieder nur mir passieren.’
Ich versuchte es erneut, doch es war nichts zu machen, die Wohnungstür ließ sich nicht öffnen. Entnervt blickte ich umher. Dabei fiel mein Blick auf das Türschild. Darauf stand allerdings nicht Elina Dirsten, sondern Dr. phil. C. Schmidt, was endlich dazu führte, dass bei mir der Groschen fiel.
Glücklich darüber, dass niemand mein tumbes Unterfangen mitbekommen hatte, ging ich weiter in den vierten Stock. Dort vergewisserte ich mich sofort, ob der ersehnte Name auf der Klingel vor der Tür prangte: Elina Dirsten. Ich atmete auf.
In der Wohnung fragte ich mich als erstes, ob mir diese Unmenge an Grünzeug bei einem früheren Besuch nie aufgefallen war, obwohl es jetzt gar nicht mehr so grün aussah. Schließlich kannten wir uns schon eine Weile und hatten die letzten beiden Schuljahre nahezu den gleichen Schulweg gehabt. Da sie in ihrem Leben ständig umgezogen war, beschloss sie, als ihr Vater als Diplomat erneut eine Auslandsstelle bekommen hatte, nicht mit ihren Eltern wegzuziehen, sondern sich diese gemütliche Wohnung zu nehmen.
Die meisten Pflanzen sahen sehr müde aus, und ich machte mich daran die allzu traurigen Blätter abzurupfen und einige verdorrte aufzulesen. Nachdem ich alle Blumentöpfe reichlich unter Wasser gesetzt hatte, fuhr ich endlich los zu Lennard.
*
Obwohl wir spät dran waren, warteten Lennard und ich noch eine Zeit lang mit wärmenden Getränken im Café, bis sich Favo, von oben bis unten durchnässt, strahlend zu uns setzte. Er warf seinen triefenden Regenmantel über die Stuhllehne und verkündete uns stolz, dass er es nun geschafft hatte, den Stadtrat nach längerem hin und her zu überzeugen, einen Wettbewerb auszuschreiben. Da, vom Stadtrat, komme er nämlich gerade her.
„Die grässliche Betonwand vom Rathaus, die zum Vorplatz schaut, soll verschwinden und zwar hinter einem von Künstlerhand gemalten Gemälde! Für die Materialien ist Geld da, und einen Preis soll es auch geben. Um ein nicht zu peinliches Künstlerhonorar muss ich noch kämpfen. Natürlich werden alle, die was halbwegs Annehmbares abgeliefert haben, erst einmal zu einem Empfang eingeladen. Dumm ist nur, dass bald Schulferien sind und in der Uni auch nur noch wenig los ist.“
Favo fuhr unerschüttert fort, nicht ohne bei einer vorbeihuschenden Kellnerin einen doppelten Espresso bestellt zu haben:
„Ich mache trotzdem heute massenweise Aushänge in den Schulen, in der Uni und sonst wo. Und morgen steht das Ganze in der Zeitung.“
Favo erklärte allerlei Einzelheiten und fügte theatralisch mit erhobenen Händen hinzu:
„Bis in zwei Wochen möge das Rathaus überquellen vor Entwürfen.“
Während er seinen doppelten Espresso schlürfte, lobten wir Favo selbstverständlich für seinen unermüdlichen Einsatz, wo wir doch wussten, wie sehr ihm ein Gang in die Stadtratssitzung missfallen haben musste.
„Missfallen?“, höhnte er, „Infernalisches Zeittotschlagen ist das! Naja, sei’s drum. Ich zähle auf euch. Ich muss jetzt weiter.“
Er leerte die Tasse in einem Zug, nahm seinen nur unwesentlich trockeneren Mantel und war wieder verschwunden.
Erstaunt blickten wir erst Favo nach und schließlich uns gegenseitig an. Ich musste Lennard nicht erst überreden bei dem Wettbewerb mitzumachen. So sah ich meine Aufgabe vielmehr darin, ihn, falls überhaupt nötig, bei der Stange zu halten und zu unterstützen, wo es nur ging.
„Lennard, das wird dein erster ganz große Wurf!“, strahlte ich Lennard an.
„Ja, ich denke auch, dass ich da Chancen haben könnte.“
„Machst du Witze? Wer soll denn da noch mithalten können? Schau mal, während Favos Monolog habe ich mir noch die Abmessung der Wand notiert: achtmeterzehn mal zweimetersiebzig.“
„Die ist ja riesig. Dann muss ich schauen, dass ich nichts zu detailliertes mache, sonst sitze ich da ja ewig dran“, meinte Lennard stirnrunzelnd.
Ohne darauf einzugehen fuhr ich fort: „Heute Nachmittag kaufen wir erst mal vernünftiges Papier, damit du deine Idee in den richtigen Proportionen entwerfen kannst. Farben hast du?“
Überrascht sah Lennard mich lächelnd an. Er hatte nicht erwartet, dass ich mich so mit Feuer und Flamme für diesen, für seinen Wettbewerb begeistern konnte, worüber ich in diesem Moment selbst auch staunte.
„Klar, Farben habe ich jede Menge und auf deine unentbehrlichen Mathematikkenntnisse verlasse ich mich beim Papierkauf.“
*
Im Laden für Bastel- und Künstlerbedarf fühlte sich Lennard wie zu Hause, während ich mich da höchstens um Weihnachten herum rein verirrte, um mein mattes Gehirn für die letzten Weihnachtsgeschenke inspirieren zu lassen.
„Ha, schau dir mal diese Rolle an!“, rief ich aufgeregt und lief zu einem übergroßen Metallregal, in dem haufenweise Papierrollen lagen.
„Die ist achtzig Zentimeter breit, hmm, das gibt was Krummes. Oder die sechzig Zentimeter breite Rolle hier.“
„Das ist mir lieber. Ich habe nicht vor, am Entwurf schon zwanzig Pinsel zu verschleißen.“
„Also gut, dann muss das Ding hier bei einsachtzig abgeschnitten werden, und die Rolle reicht allemal für fünfzehn Entwürfe. Ist dein Tisch so breit?“
„Äh, was für ein Tisch? Nein, nie...“
„Das kriegen wir schon hin. Auf geht’s.“
Und schon waren wir mit der Papierrolle und ein paar neuen Pinseln auf dem Weg nach Hause zu Lennard.
Der Schreibtisch war natürlich viel zu kurz und der Flügel war, um mögliche Ideen in diese Richtung sofort abzuwürgen, für jegliche Malerarbeiten tabu. So machten wir uns im Haus erst mal auf die Suche nach einem einigermaßen geeigneten Arbeitsplatz. Da kein anderer Tisch in Frage zu kommen schien und wir zum zweiten Mal auf dem Dachboden angelangt waren, fragte ich Lennard:
„Macht ihr diese Tür hier eigentlich jemals zu?“
„Nicht dass ich wüsste“, und Lennard ahnte, was ich vorhatte.
Die ausgehängte Tür schleppten wir runter bis in Lennards Zimmer. Dort angelangt, wischte ich erst mal den ganzen Krempel von seinem Schreibtisch runter, was ein Geräusch verursachte, das einem von arbeitenden Müllwagen her bekannt ist.
„Ich lasse es geschehen...“, sagte Lennard erschöpft.
Mit der Zusicherung, dass es überhaupt kein Problem sei, die Klebereste wieder zu entfernen, fixierte ich die Tür mit doppelseitigem Klebeband auf seinem Schreibtisch. Wie sich herausstellen sollte, saß ich später mehrere Stunden mit einem übelriechenden acetongetränkten Lappen und allerlei Hilfswerkzeug fluchend an diesem Schreibtisch, um dieses widerspenstige Klebeband wieder rückstandsfrei wegzubekommen.
„Perfekt!“, sagte ich und drückte rechts und links auf die über den Tisch herausragende Tür. „Hier kannst du darauf rummalen, so viel du willst. Da kann nichts schiefgehen, im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt schneiden wir noch ein richtig schönes Stück Papier ab, und dann kann es losgehen!“
Ich rechnete nicht damit, dass Lennard überhaupt noch einen Finger krumm machen würde an diesem Tag. Aber nachdem der erste Papierbogen darauf wartete, bemalt zu werden, nahm er einen Bleistift zur Hand und skizzierte seinen ersten Entwurf. Ich sah ihm noch dabei zu, wie er große Linien zog, um offensichtlich wohl durchdacht das Blatt zu strukturieren. Doch mit einem Mal wurde mir klar, dass sich das Bild bereits in seinem Kopf befand.
Am darauf folgenden Tag kam ich nicht allzu früh zu Lennard, da ich schon eine Ahnung hatte, dass er die Nacht nicht ungenutzt hatte verstreichen lassen. Die Terrassentür stand offen, so dass ich mit einem moderaten ‚Hallo?’ sein Zimmer betreten konnte.
Ich schritt sofort auf unseren neu erbauten Zeichentisch zu und beugte mich über die Skizze, um gleich darauf über alle Maßen zu staunen. Mich schaute eine vollkommene Zeichnung an, die mich sofort in ihren Bann zog.
Wie konnte das möglich sein? Dieser Entwurf war jetzt schon fertig gestellt! Musste Lennard ihn nur aus seinem Kopf abrufen und seine Hände zeichnen lassen?
„Ich muss sie an manchen Stellen noch komplettieren, aber sie gefällt mir so schon ganz gut. Über die Farben muss ich mir allerdings noch ein paar Gedanken machen“, sagte eine müde Stimme neben mir und sie fügte, ein Gähnen unterdrückend, hinzu: „An Papier mangelt es mir jedenfalls nicht.“
Völlig übermüdet stand Lennard mit einer Hand in der Hosentasche vergraben und in der anderen eine dampfende Kaffeetasse haltend da und schaute mit kleinen, sich nach Schlaf sehnenden Augen zu mir herüber:
„Willst Du auch einen?“
Er schlenderte zur Kaffeekanne und schenkte mir eine Tasse voll ein.
„Das gibt’s ja gar nicht!“, rief ich, „hast du die ganze Nacht daran gesessen? Und jetzt liegt hier eine fantastische Zeichnung, die nur noch auf ihre Farben wartet?“
Lennard hatte, bis die ersten Sonnenstrahlen ins Zimmer blinzelten, skizziert, radiert und gezeichnet. Ich stand vor ihm, packte ihn mit den Händen an den Schultern und sah ihn mit freundlichem Ernst an:
„Heute wird nichts gemalt. Du kannst dich nicht so schnell verbrauchen.“
Seine Augen blickten nickend durch mich hindurch.
Meine Ermahnung an die begrenzten Kräfte fruchteten, wenn überhaupt, nur kurz. Denn nach drei Tagen, als ich mir erneut ein Bild vom Stand des Bildes machen wollte, war es bereits vollbracht.
Ungläubig und fasziniert zugleich drang das Werk über meine suchenden Blicke in mich ein. Rechts oben schien ein Weg im dunklen Blau zu beginnen, der durch das seltsam anmutende Gelände führte und sich schließlich im Nirgendwo dieser wechselreichen Landschaft verlor. Aber worin bestand dieser Wandel?
Im Himmel, der sich weinrot absetzte, zogen wenige schwarze Schwalben ihre kurvenreichen Bahnen. Gleiche sich aber doch unterscheidende Menschen wanderten umher. Was war der Zweck dieser Menschen, die da und dort auf diesem Weg letztlich richtungslos liefen?
Es sind nicht Menschen, es ist der Mensch.
Der Mensch in seiner Zeit! Nur andeutungsweise waren die Figuren durch ihre jeweilige Mode gekennzeichnet, vielmehr hoben sie sich durch ihren zeiteigenen Malstil voneinander ab. Mit einem Mal erkannte ich, dass nicht eine Landschaft, sondern dass die Welt ebenso einem Wandel unterliegt und hier in diesem Bild allen möglichen Stilrichtungen unterworfen ist. Und es regte sich bei mir zwar die Erkenntnis, dass hier das Zeitlose mit der Zeit auf wunderbare Weise zusammengeführt war. Aber in gleichem Maße beunruhigte mich das Suchen des Menschen, seine zu allen Zeiten immerwährende Rastlosigkeit unter der Leichtigkeit des Schwalbenfluges.
Ich brauchte keine Worte zu suchen, die meine Anerkennung nur spärlich hätten ausdrücken können. Lennard und ich blickten uns an. Er sah gar nicht gut aus, was ohne Zweifel seinem Schlafmangel zuzuschreiben war. Andererseits entging mir nicht, dass er nach vollbrachter Arbeit erleichtert mit den Mundwinkeln lächelte. Da ich darauf vertrauen konnte, dass wir uns Worte sparen konnten, nickte ich kurz, um mich wieder dem neu erstandenen Werk zuzuwenden.
Lennard brach schließlich als erster das Schweigen: „Wie du siehst habe ich noch keinen Stil. Oder ich könnte sagen, noch habe ich meinen Stil: den Stil der Stile.“
„Der Stil der Stile“, murmelte ich, um mich der Zweideutigkeit zu vergewissern.
Nachdem ich mich von dem Bild losgerissen hatte, dachte ich wieder an den Wettbewerb und daran, wie schade es ist, solche Perlen vor die Menschen zu werfen. Aber mir machte sogleich Mut, dass dennoch immer wenigstens irgendjemand eben diese Perlen anerkennen würden.
„Warte noch bis nächsten Freitag. Es macht sich nicht gut, den Entwurf zu früh abzugeben“, meinte ich, und es drehte sich mir bei dem im höchsten Maße unzulänglichen Wort ‚Entwurf’ der Magen um.
Da bis zum Abgabetermin noch einige Zeit blieb, verwunderte es nicht, dass der Wettbewerb während dieser Zeit unser tägliches Gesprächsthema wurde. Wir überlegten, wie man das Bild am besten transportieren könnte. Dabei kamen wir zu dem Schluss, dass Lennard einfach einen zweiten etwa gleich großen Bogen Papier mit ähnlicher Menge an Farbe bemalen sollte, um daran das Zusammenrollen austesten zu können. Wir besprachen auch schon siegessicher, wie viele Farbeimer und welche Hilfsmaterialien man für das Original benötigen würde. Vier Wochen sollte der Gewinner Zeit haben, das Bild zu realisieren, was selbst in meinen Augen unter normalen Umständen bequem zu schaffen war. Ebenso wurde dem Künstler ein Honorar zugesichert, was angesichts des anstehenden dritten Semesters gerade für Lennard angenehm war, da er ansonsten wieder den nicht sonderlich mitreißenden Job in einem chaotischen Musikladen hätte übernehmen müssen.
Lennard zeichnete und malte in der verbleibenden Zeit bis zum Empfang im Rathaus nichts. Zurecht hatte er sich gewünscht, sich endlich wieder seinen Büchern widmen zu können. Für sein weiteres Studium hatte er sich viel vorgenommen, so dass man bei ihm in jeder Zimmerecke neu gekaufte und haufenweise entliehene Bücher finden konnte, die er nächtelang verschlang.
*
Am Sonntag nach dem Abgabetermin war es soweit. Im Foyer des Rathauses fand der Empfang zu Ehren der Wettbewerbsteilnehmer statt. Und da jeder gebeten worden war, höchstens zwei weitere Personen mitzubringen, ging außer mir noch Elina mit.
Sie war gerade aus Italien wieder zurückgekehrt und hatte am Freitag auf meinen anfeuernden Anruf hin Lennard besucht, um sich das neue Gemälde anzusehen. Zwar waren Lennards Eltern an der Arbeit ihres Sohnes interessiert, meinten aber, dass wir jungen Leute gehen sollten. Außerdem habe ich ja behauptet, dass Lennard gewänne, woraufhin sie mich beim Wort nahmen und auf jeden Fall zur Einweihung des fertigen Gemäldes erscheinen würden.
Im Foyer hingen Bilder über Bilder. Demzufolge staunten wir mit all den anderen Gästen über die bunt gewordene Innenansicht des Rathauses. Ich schätzte diese neue leider einmalige Ausstellung auf über dreißig Exponate. Das veranlasste Elina dazu, neugierig in einem ersten Überblick zu zählen, bis sie bei siebenunddreißig aufhörte. Sie kam zu dem Schluss, dass man daraus, an welchem Ort die einzelnen Entwürfe aufgehängt waren, nicht auf den Gewinner schließen könne.
„Darauf habe ich anfangs auch spekuliert“, meinte ich und machte mit dem Begutachtungsrundgang den Anfang, indem ich auf einen der Entwürfe zuging.
Lennard entschuldigte sich, da er Beatrix gesichtet hatte, von der er wissen wollte, was sie alles über die Kunstakademie in London bei ihrem langen Englandaufenthalt in Erfahrung bringen konnte und ob sie sich denn dort bewerben mochte.
„Abstrakt“, meinte ich zu Elina beim ersten Bild, das keinen bleibenden Eindruck hinterlassen sollte.
„Dass hier so viele mitgemacht haben, hätte ich nie gedacht“, sagte Elina und fuhr fort: „Naja, bei manchen Bildern meint man, deren Besitzer hätten nur die Kohle nötig, die es beim Gewinn abzusahnen gibt. Schau dir das hier mal an, da kommt einem ja das Grauen.“
Derweil zog sie mich mit ihrer Hand zum nächsten Bild. Schon das Material war wenig ansprechend: „Bisschen wellig geworden das Papier, Packpapier wohlgemerkt“, analysierte ich, „das soll ganz offenkundig den künstlerischen Basis-Aspekt untermauern.“
Auf dieses Wort ‚Basis-Aspekt’ hatte uns vor kurzem Favo aufmerksam gemacht und uns mit schallendem Gelächter den dazugehörigen Zeitungsartikel unter die Nase gehalten. Auf diesem Papier war ein in Wasserfarben gemalter, schlafender Hirte mit seinen Schafen zu sehen, die wir jetzt aber alleine ließen, um zu interessanteren Werken vorzustoßen.
Daneben gab es eine Bleistiftzeichnung von einer Dampfeisenbahn, die prinzipiell gar nicht so übel war, bei der man sich allerdings fragte, ob es ein Fortschritt bedeutete, sie an Stelle der bestehenden Betonwand zu sehen.
Ganz ansprechend, aber alles in allem sehr einfarbig, war ein Wald bei dem versucht worden war, ihn möglichst naturbelassen abzubilden. Ich deutete auf die paar Blümchen, die davor offenbar als Auflockerung des dichten Grüns gedacht viel zu brav angeordnet waren und meinte:





























