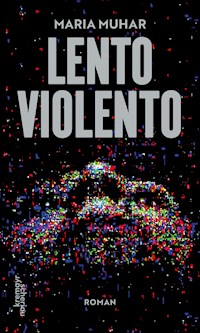
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lento Violento ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern ein Lebensstil. Langsam, aber hart bahnt sich die Bassdrum ihren Weg durch verträumte Sounds und treibt Ruth, Daniel und Alex von einer exzessiven Erfahrung zur nächsten. Alex ist Schriftstellerin und verliert sich zunehmend in ihrer Roman-Recherche zur Jugendkultur der 90er. Hat Eurodance, der Musikstil ihrer Kindheit, sie und ihre Freund*innen unwiederbringlich geprägt, in einen tranceartigen Zustand versetzt, dem niemand mehr entkommen kann? Als für Alex die Grenze zwischen Fiktion und Realität immer weiter zu verschwimmen droht, wird die Beziehung der drei auf eine harte Probe gestellt. Kann sie sich aus der Krise herausschreiben? Maria Muhar lässt die Figuren ihres vielschichtigen Debütromans "Lento Violento" tief in existenzielle Abgründe blicken, ohne dabei auf eine kräftige Portion Humor zu verzichten. Scharfsichtig fängt sie die Atmosphäre einer Generation ein, die auf der Suche nach Selbstbestimmung in die Orientierungslosigkeit abgedriftet ist. "Ich frage mich, welche Stimmung damals von dieser Musik ausging. Vielleicht das Kennenlernen von Sehnsucht. Das hardcore Versprechen von einem geheimnisvollen Ort, die Ahnung einer Öffnung, eines Schlupflochs, durch das man in eine andere Welt fallen konnte."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Muhar
Lento Violento
Roman
This one is dedicated to all the ravers in the nation Dune, Hardcore Vibes, 1995
Inhalt
Kapitel 0
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Quellen
0
Ich bin allein am Set. Der Cast und die Crew sind schon vor Stunden abgehauen. Vermutlich zum Dorfwirt saufen, während ich auf diesem mich hassenden Stoppelfeld stehe. Die Schauspieler, auf die ich hier warte, tauchen nicht wieder auf, um sich in meine Anwesenheitsliste einzutragen, und langsam habe ich das Gefühl, niemand von denen hat Lust auf dieses Projekt. Was schlimm ist. Wirklich, wirklich schlimm. Weil ich mich ja selbst kaum davon überzeugen kann. Aber ich verstehe es auch – das muss für die schon eigenartig gewesen sein. Erst fuhren sie stundenlang ohne Verpflegung in einem nicht-klimatisierten Bus durch die Provinz, um dann eine Regisseurin anzutreffen, die sich vor Nervosität fast übergab, ehe sie in der Lage war, mit dieser Rede vor die versammelte Gruppe zu treten:
»Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir stehen am Beginn einer spannenden Reise. Ich schätze euer Engagement und eure Offenheit gegenüber meiner unorthodoxen Arbeitsweise. Mir ist klar, dass so ein Projekt ohne festgelegte Rollen, ohne Plot und letztlich ohne … Grundidee eine besondere Herausforderung für uns alle darstellt, keine Frage, das ist schon …« Ich halte konsequent Blickkontakt mit dem Boden, eine Kette kopulierender Feuerkäfer zittert orientierungslos durch den Staub.
»Aber ich traue uns das zu! Wem, wenn nicht uns, oder? Weil ich spüre, dass sich hier Men-… Künstler versammelt haben, die bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen. Die es wagen, sich aus dem Korsett einer konventionellen Erzählweise, die ja den Blick auf die wahrhaften Geschichten schon viel zu oft verstellt hat …«, ein Handy beginnt zu läuten, jemand würgt es ab, »also sich aus diesem Korsett, das es uns ja verunmöglicht, den Weg für die Essenz einer befreiten und befreienden Poetik endlich freizuschlagen … herauszuschälen! Es wird eine aufregende, und ja, manchmal auch unberechenbare Zeit. Nichts ist festgelegt. Nichts. Was wird zum Beispiel in fünf Minuten passieren? Was wird passieren? Weiß das jemand?!« Leicht blutig schmeckender Speichel rinnt auf meiner pelzigen Zunge zusammen, löst sie vom ausgedörrten Gaumen.
»Kann mir irgendjemand sagen, was hier in fünf Minuten passieren wird?! Wie das hier alles weitergehen kann?«, rufe ich auf meine Sandalen. Die Schauspieler schweigen. Das Handy beginnt wieder zu läuten. Mit groteskem Kraftaufwand schaffe ich es, den Kopf ein Stück weit anzuheben. Ich trage einen riesigen Sombrero in Tarnfarben. Er ist so groß, dass die Krempe mein gesamtes Sichtfeld einnimmt. Ich lehne mich so weit wie möglich zurück, um das Geschehen irgendwie verfolgen zu können. Knapp unter der Krempe erkenne ich, wie sich eine von mir als Hauptrolle in spe gehandelte Schauspielerin telefonierend Richtung Catering entfernt. Ich habe zuvor ein Buffet aus Mineralwasser und alter Kochschokolade aufgebaut.
»Wer kann mir sagen, wie das hier weitergehen kann?«, wiederhole ich.
Zügig geht die Schauspielerin am Buffet vorbei und lässt das Skateboard, das sie unter ihren Arm geklemmt hat, zu Boden gleiten.
»Niemand?« Meine Stimme bricht, mein Kopf kippt zurück zu den Feuerkäfern, deren Orgie langsam in einen Akt des Kannibalismus übergeht.
»Niemand! Und genau diese Unsicherheit bildet das Herzstück dieses Projekts. Wir balancieren hier praktisch ohne Netz, da gibt es nichts – keine Sicherheit, kein … Freiheit stirbt nämlich mit Sicherheit! Freiheit stirbt mit Sicherheit. Freiheit würde uns – Sicherheit würde uns hier alles ausbremsen, ein Netz käme einem Konzept gleich und jedes Konzept wäre der Tod dieses Projekts, weil ein Netz ja immer nur vermeintlich … Also weil es immer auch eine Fessel ist, eine Falle, in der man sich nur allzu gern verheddert, und noch bevor man überhaupt merkt, dass man im Netz sitzt, wird die Falle zugezogen. Eigentlich ist es ein Schleppnetz! Ein gigantisches Schleppnetz, in das man nur hineingeraten konnte, weil man mit den anderen Fischen im gleichgeschalteten Fischstrom, also dem Mainstream, geschwommen ist! Geschleppt und gefangen von einem … Tanker.« Ein letztes Mal versuche ich mein Gesicht zu zeigen. Mein Herz trommelt jetzt so hart im Kopf, dass ich mich selbst kaum mehr sprechen höre, das ganze Set flirrt, verschwimmt. Ein Statist in Schwarz schlägt geduckten Schrittes den Weg der verschwundenen Hauptrolle ein.
»Wer also Sicherheit will, dem steht es frei, sich an jedem x-beliebigen kommerziellen Tanker-Projekt zu beteiligen. Wer das aber nicht will, den lade ich jetzt ein, sich mit mir auf dieses … Floß zu begeben. Kein Motor – nur das Vertrauen in die eigene künstlerische Energie als Antrieb. Kein Netz – nur ein zusammengeflicktes Segel. Zusammengeflickt aus den Ideen, die diese Geschichte zu … Wasser lassen.«
1
Put on my raving shoes and I boarded a plane
Touched down in the land where the skies were blue
In the middle of the pouring rain
Everybody was happy, energy shining down on me
Yeah, I’ve got a first-class ticket
Been as good as a boy can be
I’m raving, I’m raving
I’m raving til’ the sweat drops fall down off me
I’m raving, I’m raving
But do I really feel the way I feel?
Yeah
Come on
Wicked
Wicked
Wicked
Give it up now
Give it up now
Give it up now
Yeah1
Unter tropfenden Ästen tritt Daniel hervor auf die Lichtung und betrachtet die bunte Wiese. Die Partyzelte zittern im Wind, über ein schlaff gespanntes Netz bewerfen sich ein paar Jugendliche mit Schlamm, auf einer Tafel steht, dass das Beachvolleyball-Turnier abgesagt ist. Daniel zieht sich die Kapuze tiefer ins Gesicht.
Den Lacken ausweichend, geht er langsam an den Ständen entlang, durch die Planen dringen Salsa, Arbeiterlieder und Grillrauch an die feuchte Luft. Vor der Essensausgabe der Nicaragua-Brigaden bleibt Daniel stehen, in der Hosentasche dreht er drei Münzen zwischen den Fingern. Sein Blick fällt auf eine Heurigenbank, angebissene Empanadas schwimmen in einer aufgequollenen Pappschüssel. Sachte löst er sich aus der Schlange. Im Weitergehen zieht er sein Handy aus der Tasche, verzerrende Tropfen erscheinen am leeren Display. Er lässt es zurückgleiten. Er holt es wieder heraus, wischt mit dem nassen Ärmel darüber und scrollt durchs Programm. Der Gewerkschaftliche Linksblock lädt zur Podiumsdiskussion über den Zwölfstundentag, Rudi Burda tritt mit den 68er Rockern auf, in fünfzehn Minuten beginnen irgendwelche Lesungen. Daniel spürt, wie die Feuchtigkeit von den Rändern der Sohlen Richtung Zehen wandert, wie der dunkel gewordene Jeansstoff immer fester an seinen Oberschenkeln saugt und sich erst am Ende jeden Schrittes kurz von der kalten Haut löst. Eigentlich könnte er jetzt nach Hause gehen.
Am Weg zur Bühne legt er die sechs Euro auf den Tisch der Kubanischen Botschaft und bestellt einen Mojito. Ein stürmischer Windstoß greift ins Zelt, bunte Strohhalme und leere Plastikbecher überschlagen sich. Der Mann hinter der Bar befreit sich von einer heruntergerissenen Papiergirlande aus kubanischen Flaggen und versucht, die aus der Kassa wirbelnden Geldscheine einzufangen. Der Regen wird stärker. Immer mehr Leute strömen Richtung Autodrom, der einzig wetterfesten Überdachung auf dem Gelände. Den randvollen Becher an die Brust gepresst, versucht sich Daniel bei der Gesellschaft für dialektische Philosophie unterzustellen. Ein paar andere Leute, die die Lesung offenbar auch von hier aus mitverfolgen möchten, haben sich schon unter der Zeltplane versammelt, mit eingezogenem Kopf stellt er sich zu ihnen. Aus den nassen Lautsprechern singt Bob Dylan von der Windstille vor dem Hurrikan. Alle paar Sekunden fällt ein dicker Tropfen durch die undichte Plane auf Daniel herab. Mal auf den Scheitel, mal auf die Wimpern.
Ein Mann, gehüllt in einen blassroten Plastikfetzen, steigt auf die Bühne. When The Ship Comes In wird langsam leiser. Er tritt ans Mikrofon, macht bittere Witze übers Wetter und kündigt die erste Autorin an. Vereinzelter Applaus aus den umliegenden Zelten, die spiegelnden Heurigenbänke vor der Bühne bleiben leer. Klatschend zieht sich der Moderator zurück und nickt dabei einer Gestalt im Hintergrund zu. Eine Frau mit tief ins Gesicht gezogener Camouflagekappe erscheint im roten Scheinwerferlicht. Den Blick auf den Boden geheftet, nähert sie sich dem Lesetisch, in ihren Händen hält sie einen zerfledderten Stapel aus Mappen und Notizbüchern. Ohne auch nur einen Moment aufzusehen, setzt sie sich an den Tisch und beginnt in ihren Unterlagen zu kramen. Aus der Entfernung kann Daniel ihr Gesicht nicht genau sehen, meint aber erkennen zu können, wie ihrem Auftreten etwas Schreckhaftes, seltsam Argwöhnisches anhaftet. Nachdem sie übertrieben lange in einem Notizbuch geblättert hat, beginnt sie daraus zu lesen. Eigenwillige Liebesgedichte in einer Art Briefform. Viel Selbstzerstörung, viel Sehnsucht, viel Wahnsinn; und Daniel fragt sich, ob es diese Art von Text war, die der Veranstalter unter dem Motto Das linke Wort im Auge hatte. Während die Autorin von zersägten Körperteilen und lauen Sommernächten spricht, nippt Daniel an seinem warmen, viel zu starken Cocktail und beobachtet, wie ein junger Mann zwischen Antifaschistischer Aktion und Linkswende Schnüre in Seifenlauge taucht. Sobald er die getränkte Schlaufe mit weiten Bewegungen durch die Luft zieht, lassen die Regentropfen die entstehende Riesenseifenblase platzen. Die Wiese unter seinen nackten Füßen schillert in Regenbogenfarben, ein als Löwe geschminktes Kind beginnt zu weinen.
11. 9. 2018
I’m raving
I’m raving
Ich frage mich, welche Stimmung damals von dieser Musik ausging, welche Gefühle es waren, die da bei Volksschulkindern ausgelöst wurden. Vielleicht das Kennenlernen von Sehnsucht. Das hardcore Versprechen von einem geheimnisvollen Ort, die Ahnung einer Öffnung, eines Schlupflochs, durch das man in eine andere Welt fallen konnte. Treibende Beats und melancholische Computerstimmen, die von wonderlands und outer spaces erzählen, von Liebe und Freiheit, von magischen Nächten. Und vom Tanzen. Zum ersten Mal in klangliche Sphären kippen, zum ersten Mal eine Idee vom Wegspacen kriegen. Jausenbrote verschimmeln lassen und elektronische Musik entdecken.
Sie sitzen im Gastgarten des Clubs, obwohl es schon viel zu kalt dafür ist. Mit eingezogenen Köpfen werden quer über den Tisch Gespräche geführt. Irgendwer schuldet irgendjemandem etwas. Irgendwer war gestern dann eh auch nicht mehr irgendwo. Irgendwer redet über Muttertag und Downtempo. Daniels Aussetzer werden immer größer, beginnen langsam ineinander überzugehen. Manchmal ist er erstaunt darüber, wie lange sie von den anderen unbemerkt bleiben. Er trinkt den letzten Schluck Red Bull und verschwindet aufs Klo. Die Müdigkeit lässt sich schwerer verbergen – sein Spiegelbild erinnert ihn an Bud Spencer auf traurig: Die verschwollenen Augen haben sich seit dem Aufstehen nicht merklich geöffnet, auch das Neonlicht und die Hände voll kaltem Wasser können die Schlitze nicht aufbrechen. Er greift nach einem Papierhandtuch, seine Finger tappen in die leere Öffnung des Metallkastens. Er sieht sich um, zieht das schwarze Joy-Division-Shirt über den weißen Bauch und trocknet sich damit das Gesicht ab. Von außen betrachtet, ist das hier vielleicht OK. Leider bin ich nicht von außen, steht mit verblasstem Edding auf dem Handtuchspender.
Daniel betritt das Zimmer, das einmal seines war und nun zu einem öffentlichen Bücherschrank umgewidmet worden ist. Seine Mutter hat alle Wände mit Regalen zugeschraubt, sie sind so tief, dass in der Mitte des Raumes nur etwa ein halber Quadratmeter zum Stehen übrig ist. Wenn Daniel in sein ehemaliges Zimmer gehen möchte, kommt er nicht mehr weit – sobald er es betritt, wird er von allen Seiten von Büchern umzingelt. Auch quer über die Fenster wurden tiefe Regalbretter montiert, kein Tageslicht dringt mehr herein. Er steht vor den künstlich beleuchteten Buchrücken und liest Titel wie: Wunderwaffe Kefir – Mit dem Pilz gegen das Borderline Syndrom. Oder: Der Efeu – Schmarotzer oder Freund fürs Leben? Oder: Mein schwarzer Hund – Wie ich meine Depression an die Leine legte. Niemand weiß von dem öffentlichen Bücherschrank, noch nie waren andere Menschen in der Wohnung.
Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich die Verhältnisse, die sie wollen, und wenn sie sie nicht finden können, schaffen sie sie selbst.
Als Daniel die Website des Team 4 öffnet, fragt er sich, ob es sein zukünftiger Betreuer war, der das Zitat von George Bernard Shaw für die Startseite ausgewählt hat. Die Website des Arbeitsmarktservice, auf der er sich regelmäßig einloggen muss, gibt sich da minimalistischer: #weiter, steht fett und rot auf der Startseite.
»Herr Bieleski. Sie sind Künstler. Ich werde Ihnen sicher keine Arbeit finden«, sagte sein Betreuer beim letzten Termin. »Schauma mal, ob ich Sie bei den Kollegen vom Team 4 zubuchen kann. Wenn die Sie nehmen, werns dort sicher glücklicher.« Daniel hatte sich mit seiner Unvermittelbarkeit innerhalb des normalen Arbeitsmarkts eigentlich schon recht glücklich geschätzt. Sein Arbeitslosengeld war zwar lächerlich gering, gleichzeitig hatte es etwas Beruhigendes, dass der minimale Leistungsanspruch scheinbar auf stiller Gegenseitigkeit beruhte. Und zusammen mit den kleinen Jobs, die er ab und an bei diversen Filmdrehs ergattert hatte, ging es sich meist doch irgendwie aus: Absperrer, Angler, Assi, Statist. Von den Erzählungen ehemaliger Kollegen kannte er die Kurse, die das Team 4 anbot: Die Marke Ich, Der Webauftritt für KünstlerInnen, Selbstmanagement und Networking. Der Gedanke, dass noch eine Zukunft auf ihn wartete, in der er gecoacht und weitergebildet als freischaffender Maler durchstarten würde, kam ihm absurd vor. Aber der Betreuer bestand darauf, ihn beim Künstlerservice unterzubringen und leitete die nötigen Schritte für die Zubuchung ein.
Ornamental verzierte Säulen, polierte Klingelknöpfe, eine schonend restaurierte Eingangstür aus massiver Eiche. Das repräsentative Jahrhundertwendehaus im ersten Bezirk erinnert Daniel eher an eine Anwaltskanzlei als an eine Serviceeinrichtung für arbeitslose Künstler:innen. Im ersten Stock betritt er die Räumlichkeiten des Team 4, ein eigenwillig geschnittenes Altbau-Büro, das trotz seiner hohen Wände wie ein Kaninchenbau wirkt: Ausgehend vom hellen Eingangsbereich entfaltet sich ein Labyrinth aus schmalen, verschachtelten Gängen, die nach hinten hin ins Dunkle verschwinden. Am Empfangsschalter meldet sich Daniel an und wird gebeten zu warten, bis er von seiner Betreuerin abgeholt wird. Er setzt sich auf die äußerste Kante eines Ledersessels, auf dem Beistelltisch neben der Lehne häufen sich die Flyer: eine Bildhauerei-Ausstellung, ein Fotokurs, ein Improvisationstheater-Workshop. Er sieht auf die Uhr, steht wieder auf, geht zu einer Wand mit Infomaterial und beginnt in einer Broschüre zum Thema Berufliche Neuorientierung zu blättern.
Wenn Sie weiter das tun, was Sie schon immer getan haben, werden Sie auch weiter das bekommen, was Sie schon immer bekommen haben.
Während Daniel einen Hinweis auf den Verfasser des Zitats sucht, nimmt er wahr, wie sich ihm eine durch und durch türkis gekleidete Frau um die fünfzig nähert.
»Handgriff«, sagt sie und streckt ihm die Hand entgegen. Daniel nimmt sie, schüttelt sie, knapp über den Schultern der Frau wippen lange Ohrringe aus türkisem Halbedelstein.
Weil er sich nicht sicher ist, ob das gerade eine Aufforderung, Ankündigung oder ihr Nachname war, nuschelt er nur halblaut »Bieleski« in sich hinein. Die Betreuerin bittet ihn, ihr zu folgen, und schlägt einen der engen Gänge ein. Hastig steckt er die Broschüre zurück ins Fach. Er geht hinter einem wallenden Seidenschal her, wie eine sanfte Welle umspielt der Stoff den Weg zu Frau Handgriffs Büro, der von Schritt zu Schritt düsterer wird.
Im Vorbeigehen fällt Daniels Blick in ein offenes Zimmer, in dem ein Pianino steht. Er hält inne und hört sich »schönes Klavier« sagen.
Die Angst vor Sanktionen hat ihn zu einem unerträglich höflichen Arbeitslosen gemacht, anders als sonst nutzt er in solchen Situationen fast jede Gelegenheit für Smalltalk. Er stellt sich Frau Handgriff als gescheiterte Künstlerin vor, die jetzt ihre ehemaligen Kolleg:innen betreuen muss. Er will, dass sie sich wahrgenommen fühlt. Er will, dass es ihr gut geht. Er will, dass sie ihn in Ruhe lässt.
»Spielen Sie selber auch?«, erkundigt er sich. Die Betreuerin dreht sich um, geht ein paar Schritte zurück und wirft einen kurzen Blick in den Raum, in dem das Klavier steht.
»Ach so, nein …« Lächelnd zieht sie die Tür vor ihm zu. »Es ist zwar heute, wo die Grenzen der Kunst oft … fließend sind, schon schwieriger geworden, aber na ja, weil einer halt schnell einmal behaupten kann, Musiker zu sein – zur Überprüfung, ob es sich da wirklich um einen handelt.«
Am Heimweg fragt sich Daniel, ob er beim nächsten Mal Ölkreiden mitnehmen muss.
Eurodance music emerged in the immediate aftermath of the Berlin Wall and is characterised by a lyrical preoccupation with the word »freedom«, an emotively charged minor key, references to severe weather and beats that suggest states of both euphoria and emergency. It is a fantasy genre of irrational optimism and desperate, unanswerable questioning.2
Um vier Uhr morgens regnet es im Prater verwelkte Kastanienblätter. Schon den ganzen Sommer über sind sie, vom Schädling zerfressen, an den Ästen gehangen. Unwürdig, dachte Daniel, als er die Blätter Anfang Juni so sah. Endlich löst der Wind sie aus den Kronen. Vor ihm liegt die leere Allee, an deren Ende der Praterstern leuchtet.
Er beginnt zu gehen. Der Abend war länger, als er hätte sein müssen. Die Gespräche leer und anstrengend, die freundschaftliche Verpflichtung gegenüber der Band eine pure Lüge. Er fragt sich, ob es jemals besser war. Spannender, lustiger, berauschender. In seinen Kopfhörern wird davon gesungen, wie ein schwerer Vogel vom Himmel fällt. Er stellt es sich in Schwarz-Weiß und in Zeitlupe vor, weil die Nummer sonst nicht melancholisch, sondern einfach nur Slapstick wäre. Aber so ist das eben mit Dark Wave, denkt er, immer mit einem Fuß in der traurigen Karikatur seiner selbst. Der Wind wird stärker, wird Rückenwind, der ihn stadteinwärts treibt. Daniel sieht sich in einem Musikvideo: der Vollmond, das Laub, das sich zu rauschenden Säulen hochwirbelt, die Böen, die ihm immer bei falling, breaking again über die Kopfhaut schneiden. Er fühlt sich eins mit der Musik, findet sich peinlich. Dreht sich lauter.
Aus der Ferne mischt sich eine fremde Figur ins Bild. Im Näherkommen erkennt Daniel eine etwa gleichaltrige Frau, die am Fuß einer Kastanie kauert. Sie schreit etwas in ihr Handy und wirft es Richtung Praterstern, ein paar reflektierende Teile überschlagen sich am Asphalt. Zitternd umschließt sie ihre Beine und legt den Kopf auf die Knie. Langsam geht Daniel auf sie zu, ihre Schultern zucken im Tempo seines Beats. Er nimmt die Kopfhörer ab und bleibt stehen.
»Ist alles … Kann ich irgendwas machen?«
Schluchzend hebt die Frau den Kopf und reibt sich die Augen. Ihre zittrigen Finger verschmieren die Wimperntusche in weite Kreise, die Rotzglocke, die aus der Nase hängt, wird ignoriert. Ein neuerlicher Weinkrampf erfasst sie, kopfschüttelnd vergräbt sie das Gesicht wieder in den Händen.
»Tut mir leid. Ich wollte nicht …« Daniel wendet sich von ihr ab und greift nach seinen Kopfhörern.
»Nein!«, ruft die Frau.
Er dreht sich um.
»Warte kurz.« Mit dem Handrücken wischt sie Rotz und Tränen über die Wange und sieht sich suchend um. Als ob sie gerade in einer fremden Umgebung aufgewacht wäre. »Kannst du mir vielleicht … Willst du einen Schluck?« Sie hebt eine leere Sektflasche in die Höhe, ihr Unterarm ist blutverschmiert. Sie hat aufgehört zu schluchzen und strahlt jetzt so innig, dass Daniel sich fragt, ob sie vielleicht die ganze Zeit vor Lachen geweint hat.
»Was ist passiert?«, fragt er und deutet auf ihren Arm.
»Ich habe mich«, kichernd kippt die Frau nach vorne, die Sektflasche rollt vor ihre Füße, »ausgesperrt«, bringt sie noch heraus, ehe sie wieder in Gelächter ausbricht. Erst jetzt bemerkt Daniel, dass sie auf einem Skateboard sitzt.
»Ich hab mich ausgesperrt«, wiederholt sie und streicht dabei über den Riss an ihrem Hosenbein, ein Knie blutet ebenfalls.
»Vielleicht solltest du deine Verletzungen versorgen, sowas gehört eigentlich gereinigt und verbunden. Kannst du überhaupt gehen?«
»Ja, komm, setz dich!« Mit ihrem ganzen Gewicht hängt sie sich an Daniels Jackenärmel, versucht ihn zu sich herunterzuziehen. Rasch entreißt er ihr den Arm und weicht ein paar Schritte zurück.
»Willst du nicht vielleicht jemanden anrufen? Du kannst mein Handy verwenden«, sagt er mit Blick auf die Allee.
»Sie hat die Mailbox, Depperte.«
Daniel kneift die Augen zusammen. »Wer?«
»Meine Mitbewohnerin. Ich hab mich ausgesperrt …« Die Frau beißt sich auf die Lippen und zieht eine Dose Bier aus ihrem Rucksack.
»Ok … und was hast du jetzt vor?« Daniel hat Angst vor der Antwort. Er sehnt sich zurück nach seinem Heimweg, nach der Musik, dem Alleinsein.
Die Frau öffnet die Dose, schäumendes Bier rinnt in ihren Schoß. Für einen Moment verliert sich ihr Blick im Mond. Dann sieht sie Daniel mit großen Augen an, sagt »Komm mit!« und steht taumelnd auf.
»Wohin?«
»Zu mir.« Eifrig beginnt sie, ihre Dinge zusammenzupacken, immer wieder knicken ihr dabei die Knie ein.
»Zu dir? Warum? Ich dachte, du hast dich ausgesperrt …«
»Mach dir keine Sorgen, du kannst mir helfen.« Sie klemmt das Skateboard unter den Arm und schultert den offenen Rucksack. Eine Tafel Kochschokolade, zerbrochene Zigaretten und ein für die Gastronomie üblicher Seifenspender fallen heraus.
»Bei was helfen? Willst du nicht jemanden anrufen, der dich abholt? Du bist doch komplett …« Die Frau starrt wieder in den Nachthimmel, Wolken haben sich vor den Mond geschoben. Wie magnetisch neigt sich ihr Körper hin zur Kastanie. Sobald sie den Stamm nur leicht berührt, richtet sie sich gerade, um kurz darauf wieder ins Wanken zu geraten. Daniel beginnt, die herausgefallenen Gegenstände um sie herum einzusammeln.
»Soll ich jemanden für dich anrufen?« Die Frau reagiert nicht. Der Rucksack ist von ihrer Schulter in die Ellenbeuge geglitten, Stück für Stück rutscht das Skateboard aus der sich langsam öffnenden Hand. Vorsichtig nimmt Daniel ihr den Rucksack ab, verstaut ihre Dinge darin und zieht ihn fest zu. Er legt ihn neben ihre Füße und sieht auf sein Handy. Vier Uhr dreißig. Es ist unmöglich, ein Taxi an diese Stelle der Allee zu bestellen, gleichzeitig wächst sein Wunsch, endlich zu gehen, ohne die Frau deswegen allein zurücklassen zu müssen. Sie lächelt ihn an, das Skateboard fällt aus ihrer Hand, landet fast geräuschlos auf dem weichen Rindenmulch, der rund um die Kastanien gestreut ist. Wie durch einen einzigen zündenden Gedanken weicht die Abwesenheit aus ihren glasigen Augen, die Begeisterung ist zurück und erhellt ihr Gesicht. Mit einer gezielten Bewegung packt sie Daniel an der Hand und beginnt zu laufen.
Erschrocken stolpert er über eine Wurzel, die ungeahnte Kraft, mit der sie ihn jetzt hinter sich herzieht, hat ihn überrumpelt. Umständlich kann er sich aus ihrem nassen Griff befreien, bleibt stehen und wischt sich die Hand an der Hose ab.





























