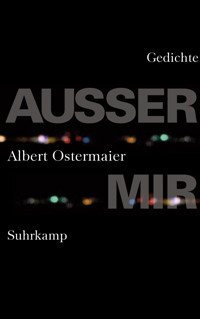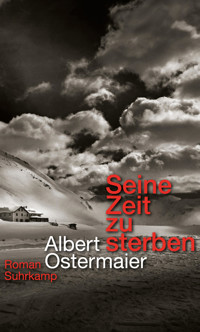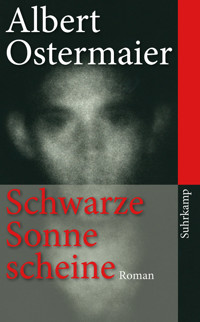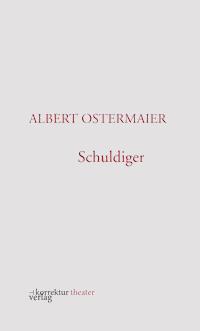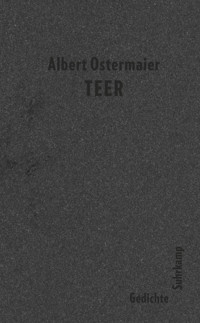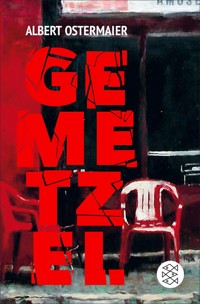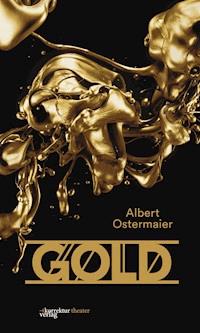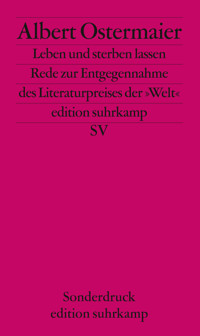9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Büchners Novelle zieht sich der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz zurück, da er die Welt nur auf dem Kopf gehend erträgt. Der Schriftsteller Lenz in Albert Ostermaiers Roman flüchtet sich vor dem Betrieb. Er entdeckt für sich Beirut, das ihm eine Lösung verspricht und damit ein Ende der Schreib- und Selbstkrise. Und so irrt Lenz durch die libanesische Stadt und gerät zwischen den Fronten unter Beschuss. Er flüchtet in Ruinen und in das Halbdunkel, er erinnert sich an den Bürgerkrieg, an Szenen, die er nicht erlebt haben kann, Albträume, denen er entkommen wollte.
In Lenz im Libanon erkundet Albert Ostermaier bis ins erschreckendste Detail das gegenwärtige Kaleidoskop der Gewaltexplosionen: im einzelnen Menschen und zwischen den Mächtigen. Der Roman erzählt in seinem blutige Realität und metaphorische Erforschung verbindenden voranstürmenden Rhythmus von Alltag und Sehnsucht eines Schriftstellers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
In Büchners Novelle zieht sich der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz zurück, da er die Welt nur auf dem Kopf gehend erträgt. Der Schriftsteller Lenz in Albert Ostermaiers neuem Roman flüchtet sich vor dem Betrieb, dabei gleichzeitig süchtig nach dem dauernden Online-Sein, dem Erwähnt-Sein. Er entdeckt für sich Beirut, das ihm eine Lösung verspricht und damit ein Ende der Schreib- und Selbstkrise: Doch Beirut ist die Stadt der Gegensätze, der Vieldeutigkeiten, und damit ein Beispiel für eine Zukunft.
All das sieht, spürt Lenz, als er 2014 durch die Stadt irrt: Er gerät zwischen den Fronten unter Beschuss und flüchtet in Ruinen, er gerät zwischen die Fronten von Liebenden und Hassenden und flüchtet in das Halbdunkel, er erinnert sich an den Bürgerkrieg, an Szenen, die er nicht erlebt haben kann, Albträume, denen er entkommen wollte.
In seinem neuen Roman erkundet Albert Ostermaier bis ins erschreckendste Detail das gegenwärtige Kaleidoskop der Gewaltexplosionen: im einzelnen Menschen und zwischen den Mächtigen. Dies zu erleben und schreibend zu bewältigen ist Aufgabe des Schriftstellers. Albert Ostermaiers Lenz im Libanon erzählt in seinem blutige Realität und metaphorische Erforschung verbindenden voranstürmenden Rhythmus von Alltag und Sehnsucht eines Schriftstellers.
Albert Ostermaier, geboren 1967, Lyriker, Dramatiker und Romanautor, lebt in München. Er ist u.a. Träger des Kleist-Preises, des Bertolt-Brecht-Preises und des Welt-Literaturpreises für sein literarisches Gesamtwerk.
Albert Ostermaier
Lenz im Libanon
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Giulio Rimondi
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74090-3
www.suhrkamp.de
»Und mein Traum – mein Traum der mich nie verläßt. Du warst’s und Dein Mann mit dem ich am Tisch saß – kurz drauf stand ich auf dem Münster und wollte mich herabstürzen. Mit welcher Herzensbeklemmung stand ich da. O ich habe den Traum ganz anders ausgelegt. Alle Umstände stimmen zusammen. Gnade Gott! Erbarmer! Vater! Meine Eltern alle an einem langen Tisch meine hiesigen Freunde, Ott – alle wie mir’s so jetzt eben zusammentrifft.«
J.M.R. Lenz: Moralische Bekehrung eines Poeten. 1775
»Aber die Gefühlsader ist in fast allen Menschen gleich, nur ist die Hülle mehr oder weniger dicht, durch die sie brechen muß. Man muß nur Aug und Ohren dafür haben.«
Georg Büchner, Lenz
»Es gibt immer Biographien, die divergieren wie die von Goethe und von Lenz. Es gibt besudelte Siege, und es gibt die reine Niederlage. Zusammen sind sie ein Gutteil der deutschen Literatur.«
Volker Braun, 1991
»So reiste ich vom äußerlichen Wissen hin zu innerer Erkenntnis, bis ich die Wahrheit fand, denn Wirklichkeit ist das Ziel der Reise.«
Ibn al-Farid
»Dabei könnte es hier ein Paradies sein.«
Nicolas Born, Hotel Commodore, Beirut, 6. Mai 1977
»Du kannst in meinem Hotel wohnen«, sagte der Mann und setzte sich neben Lenz. »Ich bin Samir«, ergänzte er, »wir kennen uns aus der Bar. Ich bin Fotograf. Hab deine Gedichte gelesen. Mochte ich.« Lenz fühlte sich vor den Kopf gestoßen. Er wollte endlich allein sein, unerkannt, auf sich gestellt, weit weg sein. »Ich will mich nicht aufdrängen. Nicht, dass du was Falsches denkst. Sah nur, du wirkst etwas nervös, suchst Hotels. Und Beirut ist keine Stadt für unsichere Menschen. Beirut riecht deine Angst, verstehst du. Beirut ist wie ein Tier, es wittert deine Unsicherheit, deine Zweifel, dein Zögern. Es lockt dich in eine Falle und dann schnappt es zu.« Mit diesen Worten fasste er Lenz an die Gurgel und drückte kurz zu. »Ich will nicht schon wieder einen Freund dort verlieren.« Lenz wollte einwenden, sie seien gar keine Freunde, dass sie sich noch nicht einmal kannten. Aber er hatte keine Chance, Samir hatte sein Leben in die Hand genommen oder besser in seine Faust. »Es geht los«, er schlug ihm auf die Schulter, »Boarding. Ich habe etwas vergessen«, zwinkerte er ihm zu und schlug mit der Faust gegen Lenz’ Brust. Lenz hasste Körperkontakt. Kontakt mit jedem Körper, er hatte keinen Kontakt zu seinem Körper, wie hätte er andere Körper ertragen können, die Kontakt zu ihm suchten. Diese Menschen, die einen andauernd berühren mussten, beklemmten ihn, lösten bei ihm Platzangst aus. Ihm war, als wollten sie unter seine Haut kriechen, es sich bequem machen in ihm, als wäre er ihr Kuscheltier, in das sie sabberten, an das sie sich beim Träumen schmiegten, während er mit offenen Stecknadelaugen dalag und zur Decke starrte. Diese Berührer machten Lenz aggressiv.
Lenz brauchte Abstand und er hielt Abstand in der Schlange, im Schlauch, der zur Maschine führte und dann auf seinen Platz, aber er spürte einen Atem im Nacken. Vor ihm verlangsamte die Frau ihre Schritte und ihr Parfum umschlang Lenz, schleckte ihn ab. Der blonde Stewart lächelte ihn an, Lenz zwängte sich an ihm vorbei. Er saß gleich in der ersten Reihe, Business. Er hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn er auf Fernreisen Business geflogen war, er war nicht Business und in seinem Business flog man hinten, flog in der letzten Reihe, neben den Toiletten und saß neben Fetten, deren Fett über die Lehnen quoll, neben Asthmatikern, neben Schlürfern und Schnarchern, neben Fingernägelkauern und Nasenbohrern, neben Frischetuchbenutzern und Menschen mit kopfgroßen Kopfhörern, aus denen die Musik mit dem Ohrenschmalz quoll, saß neben Deathmetaltätowierten und Leuten, die beim Landen klatschten und einem dabei die Arme in die Rippen schlugen. Er hatte keinen anderen Platz bekommen, hatte alle Meilen verbrannt für diese erste Reihe, in der er jetzt neben dem Fenster saß und hoffte, Samir würde an ihm vorbeigehen, wenn er die Zeitung vor sein Gesicht hob. »Es gibt keine Zufälle«, stützte er sich eine Sekunde später auf ihm ab und ließ sich in den Sitz neben ihm fallen, auf dem stand, dass er frei bleiben sollte. »Ist doch okay, oder?« Lenz wollte protestieren, Distanz schaffen, aber da schlief Samir auf der Stelle ein und er schlief wie ein Toter. Lenz hätte auf Samirs Platz wechseln können, aber jetzt war es zu spät. Er würde es nach dem Start versuchen. Lenz hoffte, Samir würde nicht aufwachen. Mit Turbulenzen sei zu rechnen, sagte der Stewart und befahl, sich anzuschnallen, in einem Ton, als ginge es um ein abgedrehtes Sexspiel. Das Licht ging aus. Lenz drückte das Leselicht an. Die Maschine musste enteist werden. Bald würden sie abheben. Beirut. Endlich.
Lenz hatte Beirut nicht aus dem Kopf bekommen, den Libanon. Hätte er ein Wort für Utopie finden sollen, seine Utopie, ein Wort für die Stadt, die aus seinem Inneren kam, die in ihm tobte, die er beschreiben wollte, die er mit seiner Sprache durchziehen, durchstreifen wollte, er hätte Beirut gesagt. Beirut war für Lenz die Stadt der Sehnsüchte, die Stadt der Sinne und Sinnlichkeit, die Stadt der Zeichen, die Stadt der Sprachen, sich überlagernder Sprachen, widerstreitender Worte, die Stadt des Rausches, Bacchus’ Stadt, sprachtrunken, verwirrt, Beirut, die Stadt der Narben, der Einschusslöcher, Stadt der Brandwunden, der verzweifelten Lieben und der Lieben und des Liebens gegen den Krieg, Krieg der Liebenden gegen den Krieg der Hassenden, des Hasses, der Sprache des Hasses, des Hassens, gespuckte Worte, ins Gesicht gespuckte Worte, Worte geflüstert, gehaucht, heilende Worte, Worte nur für dich, Zeilen wie ein Verband, um dich gewickelt, den Kopf, die Brüche, Beirut, die Stadt, in der ein Leben möglich wäre, das die Gegensätze in einem Satz verbindet.
Lenz war wie besessen von dieser Idee: Diese Stadt ist gefährdet wie ich.
Und dann erinnerte er sich wieder an das Hotel in Beirut, das er in den Nachrichten hatte brennen sehen, sein Hotel, in dem er hatte wohnen wollen, zerfetzt von einer Autobombe, geschwärzt, der Rauch schoss aus den Fenstern, seinem Zimmer, Feuerwehren, Lärm, Militärsperren, Tote, in den Betten begraben, Asche, erschlagen, in Luft aufgelöst, Blut an den Wänden, auf dem Flur, im Fahrstuhl, Löschschaum, und morgen der Staub, sein Schreibtisch, an dem er hatte sitzen wollen, den er sich ans Fenster geschoben hätte, das Meer zu sehen, Levante, verbrannt, nichts als eine Ruine, ein Bild in den Nachrichten, dann sprach der Moderator weiter.
Die Stadt ist viel gefährlicher als ich, sagte sich Lenz und dachte, dass er sie deshalb verstehen müsse. Und sie ihn. Gefährdet von all den Mächten und Mächtigen, die dieses Zusammenleben der Unterschiede und Religionen für eine Bedrohung ihrer Ausschließlichkeitsneurose halten, die Angst vor dem Miteinander haben, weil sie vom Gegeneinander profitieren. Was machen wir gegen diese Fanatiker? Weil das Gelingen Beiruts ein Beispiel für eine Zukunft sein könnte, hörst du, die mehr vom Teilen als vom Töten erzählt, vom Aushaltenkönnen der Widersprüche, von einer Gegenwart der Gleichzeitigkeiten, eine Stadt der Geschichte und der Geschichten, der gleichen Geschichten, deiner und meiner, Geschichten, die von all den Gesichtern anders erzählt werden und dadurch nicht verlieren, sondern gewinnen, was ihre Gegner gerne verloren geglaubt hätten und wegbomben wollen. Überall lauern ihre Scharfschützen auf den Dächern, ihre Drohnen sind über uns, mit Händen und Fäusten auf den Play Sticks steuern sie den Hass, den Tod. Ferngesteuert der Krieg, der Konflikt. Ihre falschen verlogenen weißen Kaftane sollen schwarz werden, Beirut bläute sich Lenz ein.
Lenz sah es vor sich: Das ist die Stadt, in der er in Gefahr gerät, in Gewalt gerät, träumt, liebt, streitet, verzweifelt, betet, im Schnee durch den Tempel des Bacchus in den Bergen der Baalbekebene laufen will. In der er sein Leben riskiert, um es zurückzugewinnen. Ich muss nach Beirut, hatte er sich immer wieder eingeredet. Und jetzt war es so weit. Die Maschine war enteist, rollte auf die Startbahn, hob ab.
Die Stadt unter ihm wurde immer kleiner, verschwand, Vergangenheit hinter den Wolken, die Wolken wie Äther in seinem Gesicht, Schlaf, er suchte Schlaf, wollte schlafen, schlafen. Er hatte diese Müdigkeit nicht mehr ertragen, hatte gedacht, sein Körper würde von Tag zu Tag müder. Eine schleichende Müdigkeit, nicht viel, Bruchteile von Sekunden müder von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Und je müder er geworden war, desto mehr hatte er gegen diese Müdigkeit angekämpft und sich ermüdet dabei. Er hasste es, dass ein Jahr nicht mehr ein Jahr war, eine Stunde nicht mehr eine Stunde und jeder Tag fast wie der andere. Ein Verlust an einer Zeit, die verschwand, die sich aus dem Staub machte, um nichts als Staub zurückzulassen. Die Uhr zeigte das Gleiche, aber es gab eine Zeit hinter der Zeit, die schneller ablief, die ihm fehlte, die ihn narrte. Die Zeit des Todes, die Sekunden des Todes, die er schon vorab einforderte, ein Vorablass. Irgendetwas wurde ihm permanent entzogen, Zeit, Sauerstoff, Energie, Zuversicht, Liebe, Lust. Nur die Verzweiflung wuchs, setzte Fett an wie der Hass, verhärtete sich, ein Muskelberg Vergeblichkeit, ein Sixpack Angst, graue Haare, Wut. Zynisch zu sein, bedeutete die Füße auf den Schreibtisch zu legen und sich Hunderte von Songs herunterzuladen, die jene Emotionen für ihn rausschrien, für die er keine Kraft mehr hatte, nicht mal aufzustehen, das Fenster zu öffnen und den Mond anzubrüllen.
Lenz konnte nicht länger sitzen bleiben. Das Anschnallzeichen war erloschen. Sofort löste er den Gurt, wollte gern das Fenster aufreißen, mit seinem iPhone das Glas einschlagen, bis die kalte Luft hereinschoss. Druckverlust, Höhenverlust, Chaos, Absturz, zerschellt, Black Box im Schwarzen Meer. Wo steckt meine Black Box, fragte er sich, ist mein Herz schwarz, ist meine Lunge schwarz. Meine Seele, ist sie hart, eine harte schwarze Seele, meine schwarze Box, in der alles geschrieben steht, was vor meinem Absturz geschah. Alle Hilferufe, alle Versuche, zu retten, was zu retten ist. Alles Durcheinanderschreien, das Stimmengewirr, das Kolabieren der Systeme, der Funkverkehr mit meinem Herzen, die Chronik der Störungen, ein, zwei schöne Sätze, die Stille, Leere, die leeren Seiten der Stille, die unerfüllten Wünsche. Was, wenn wir jetzt abgeschossen würden, über der Ukraine, von einer irren Separatistentruppe getroffen? Eine Rakete, die uns zerfetzt, deutsche Technologie, Präzisionswaffe, launch and forget. Die Rakete findet dich, sie folgt dem Triebwerkstrahl, deiner Hitze, sie ist wärmeempfindlich, sie ist schon auf dem Weg, sie kommt näher und näher. Du musst kalt werden, ganz kalt, noch kälter, du musst alles einfrieren. Die Heißblütigen sterben, da, sie ist schon in Sichtweite und dann hat sie endlich ihr Ziel gefunden. Und du stürzt zerfetzt in die Tiefe, und deine Black Box fällt durch den leuchtenden Himmel immer schneller nach unten. Und sie werden nach ihr suchen und nichts als ein Rauschen finden. Wie konnte er das denken?
Er ekelte sich vor sich selbst, dass er sein widerwärtiges Selbstmitleid, seine wohlfeile Todessehnsucht in einem Atemzug nannte mit dem Schicksal der Abgeschossenen, die aus einem heiteren Himmel in den Tod gestürzt wurden, von feigen Mördern. Zu feige, das Gesicht zu zeigen, zu feige, die Augen der Wahrheit zu zeigen, zu feige für alles außer Töten, Schlachten. Blutbesoffene, schlimmer als Tiere, denn die wissen, wann der Kampf zu Ende ist. Die stellen sich dem Kampf, und der Stärkere gibt nach, wenn alles geklärt ist, tritt nicht nach. Aber wer ist hier schwach, wer stark, was heißt das überhaupt? Separatisten, Islamisten, Befreier, Gotteskrieger, GIs, Drohnendreadlocks, Todesschwadronen, Besatzer, reguläre Truppen, es gibt keinen Namen, der es rechtfertigt zu töten. In seinem Namen zu töten, in des Namens Namen zu töten, in Gottes Namen, in Allahs, im Namen der Freiheit, des Islams, im Namen des Friedens, in Teufelsnamen. Es bleiben nur die Gräber der Namenlosen und das namenlose Elend der Toten und der Überlebenden. Separatisten, die Kuscheltiere wie Ratten in die Kamera halten, Leichenteile, wie die Teile eines Puzzles über Weizenfelder verteilt, die niemand mehr zusammensetzen kann. Nichts wird sein, wie es war, nichts wird mehr sein können, wie es werden sollte. Selbst zehntausend Meter über dem Boden das bodenlose Töten von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden.
Lenz blickte nach hinten in die Menschen, schaute in die Gesichter der Passagiere. Waren wir alle dem Tod geweiht? Hatten sie den Raketenwerfer vorher geweiht, irgendwelche orthodoxe Pfaffen, die vom Russischen Reich träumten und wieder den großen Rasputinrächer herbeisehnten und mit ihrem Weihrauch alles mit Lügen ausräucherten? Wie konnte je ein Geistlicher eine Waffe segnen? Nein, keiner schämte sich zu Tode, alle anderen sollten zu Tode kommen, und Scham kannte niemand. Ich werde verrückt, sagte sich Lenz schon wieder. Ich werde darüber verrückt, ich bin es schon. Ich komme nicht mehr klar, es entfacht sich ein Lauffeuer, wenn nur ein Gedanke sich entzündet. Mir ist schlecht. Ich muss hier raus!
Lenz stieg über Samir hinweg. Mit einer akrobatischen Übung streckte er sich in den Gang und lief nach hinten. Er musste sich bewegen, gehen, vergessen, dass er gefangen war, auch hier gefangen, ging auf und ab, besann sich wieder, wie er hergekommen war, wo er war, wo er hinwollte, was er zurücklassen wollte. Er empfand sich als sein eigener Schatten. Er ging, betrachtete die Menschen, schaute in ihre Augen, auf die Stirn der Schlafenden, auf die Schlafmasken, auf die Kopfhörer, die ihre Geschichte einspielten, blickte in Furcht, in Müdigkeit, Hunger, Gleichgültigkeit, auf die Finger der spielenden Kinder, die Gläser, kleine Flaschen mit Gin, Whiskey, auf die Coladosen, die Snacks, den Müll, die gewundenen Körper. Er sah sie lachen, sprechen, streiten, lautlos die Lippen bewegen, sah die erloschenen Lichter, die zugeschobenen Luken, konnte mit allem, was er sah, die Leere nicht füllen. Sein Licht war erloschen, sagte er sich, die Finsternis verschlang alles.
Er war fast am anderen Ende der Maschine angelangt, als er einen Mann sah, der ihn anlächelte, als verstehe er alles, als habe er auf ihn gewartet. Lenz erschrak ob dieses Blicks. Die Frau daneben war völlig verschleiert, man sah nur einen Schlitz, durch den ihr Augenpaar stach, tiefblaue Augen. Lenz war wie gebannt. Was sollte das bedeuten? Angst erfasste ihn, er drehte sich um, es kostete ihn so viel Kraft, als müsste er springen. Er wollte Richtung Cockpit rennen, aber zwang sich zu einer Langsamkeit, die ihm unerträglich war. Als würde ihn so alles einholen, vor dem er floh, die Welle, die Hände, Schatten, der Arm. Er verlangsamte noch mehr. Dann soll es eben vorbei sein, sagte er sich.
Manchmal glaube ich, ich würde an einem Brunnen stehen und auf mein Spiegelbild hinabblicken, das sagt, komm, Lenz, komm, ich habe so lange auf dich gewartet. Dann will ich immer Vater unser sagen. In der größten Angst steigt der Glaube auf, Vater unser. Und wenn ich Vater sage, steigt eine noch viel größere Angst in mir auf. Ich vergebe dir nicht, mein Sohn, Mutter vergibt dir nicht, du darfst dir nicht vergeben, niemand vergibt dir, niemand darf dir vergeben. Erlöse mich, erlöse mich von dem Bösen, Vater, erlöse mich von dir. Mein Predigervater. Mein Protestantenvater. Mein Fastpastorvater. Mein Tinnitusvater. Lenz, du hast versagt, schuld bist du.
Lenz konnte sich nicht mehr finden, wieder einer dieser Anfälle ohne Ankündigung. Ohne zu rennen, ging er zur Toilette, zwängte sich in die Ecke, schob den Riegel vor. Atmete tief gegen die Platzangst, zog einen Papierring und legte ihn auf die Schüssel, ließ die Hosen runter, setzte sich, als sei alles ein ganz normaler Vorgang. Als wäre er nicht in Panik, als möchte er nicht aufschreien, gegen die Tür hämmern, heulen, nichts sagen, schweigen, implodieren, sich wegspülen. Die Toilette verlassen, als sei er nie hier gewesen und würde alles für den, der nach ihm kommt, zu größter Zufriedenheit zurücklassen. Und er würde nichts vorfinden von ihm außer einen trüben Spiegel. Er stieß überall an, konnte seine Beine nicht kontrollieren, er trieb sich seine Nägel in den Arm, und der Schmerz fing an ihm das Bewusstsein wiederzugeben. Er ließ Wasser in die Schüssel, aber das Wasser war nicht tief genug, seinen entzündeten Kopf hineinzutauchen, unterzutauchen. Er musste das Wasser in den Händen sammeln und sich so ins Gesicht schütten. Werde wach, Lenz, beruhige dich, falle nicht schon wieder auf, Lenz. Sie schicken dich sonst zurück. Sie verständigen die Behörden. Sie empfangen dich am Gate. Sie geben dir eine Spritze. Du wirst stillgestellt, festgeschnallt und zurückgeschickt, nachhause geschickt. In dein Vaterland, zu deiner Muttersprache, zurück zu deiner Familie, in die Arme deiner Familie. Er wischte sich mit den Tüchern das Gesicht trocken, rieb das aufgerissene Erfrischungstuch über seine Pulsadern. An der Tür klopfte es, er musste laut gewesen sein. »Alles in Ordnung bei Ihnen?« »Alles in Ordnung, alles in Ordnung«, er öffnete den Riegel, die Tür, lächelte. Sein bestes Lächeln, das sagen sollte, es ist nichts geschehen, mir geht es wunderbar, das sehen Sie doch, es ist alles in bester Ordnung, kein Problem. Er ging zurück zu seinem Platz, vom fragenden Blick des Stewards verfolgt, der etwas auf den Lippen hatte. Samir schlief immer noch. Er schaffte es, sich zu setzen, ohne ihn zu wecken. Der Steward brachte Lenz ein Glas Wasser, das er nicht bestellt hatte, ungefragt. »Könnte ich bitte auch einen Kaffee haben, ich habe Kreislaufprobleme, aber es geht schon wieder, übermüdet.« Der Steward mochte ihm immer noch nicht so recht glauben, ich behalte Sie im Auge, wollte seine Braue sagen. Er kam mit Kaffee zurück. Der Kaffee tat gut. »Könnten Sie mir vielleicht Briefpapier geben, und einen Stift?«, fragte er den Steward. »Mein Testament«, wollte Lenz scherzen, aber er war zu schlecht und verkrampft beim Scherzen, ein Versager und Pointentöter. Aber sein Charme half immer weiter, wenn sonst nichts zu helfen schien. Der Kaffee hatte ihn zurückgebracht ins Leben. Lenz war wieder zu sich gekommen, sich seiner Lage ganz bewusst. Jetzt war es ihm fast leicht. Aber er schämte sich, dass er den Leuten wahrscheinlich Angst gemacht hatte. Im Flugzeug reagierten alle alarmiert auf jede Auffälligkeit. Es waren ja alle permanent in höchster Alarmbereitschaft, nach dem, was schon geschehen war, was unvorstellbar war zuvor und trotzdem geschehen war. Fliegen war weniger gefährlich, als über die Straße zu laufen. Aber wie selten sprengte sich auf der Straße einer in die Luft, wie selten traf eine Boden-Luft-Rakete, fuchtelte einer mit einer Waffe herum und versuchte, einen zu entführen. Es war alles Statistik, sagte sich Lenz, aber die Augen und Ängste der Passagiere sprachen eine andere Sprache, und Lenz verstand sie und deshalb schämte er sich. Die Scham war ein gutes Gefühl, ein reales Gefühl, ein vertrautes Gefühl, ein allzu menschliches Gefühl. Sie tat keinem anderen weh und sich selbst nicht mehr als nötig, um noch charmanter zu lächeln. Er war einfach zu erschöpft gewesen, erklärte er es sich. Die Erschöpfung und Schlaflosigkeit hatten seine Seele als Geisel genommen, und wie beim Stockholmsyndrom fing er fast an sie zu lieben, als würden sie seine Hand beim Schreiben führen. Vor ihm lag das weiße Blatt und darauf flog der blaue Kranich. Wie sollte er anfangen. Er fuhr mit dem Stift und dann dem Finger über die Lippen und fing an, plötzlich ganz gefasst, Greta zu schreiben, ohne Anrede, als beginne eine neue Seite.
Sind meine Lippen so kalt? Bin ich an deinen festgefroren? Tausend Gedanken. Ich rauche wieder. Ich habe es vor dir verborgen. Ich rauche in meinen Träumen. Ich rauche in Gedanken. Ich zünde mir eine nach der anderen an. Ich schwitze, wenn ich aufwache. Wie ungeduldig du das lesen wirst, denkst, ich weiche aus, weiche ab, lenke ab, täusche. Wenn dich dieser Brief erreicht, bin ich in Beirut. Ich schreibe ihn aus dem Flugzeug. Unter mir verschwindet unsere Stadt. Ich verschwinde. Hatten wir ein gemeinsames Leben? Bist du nicht die Frau eines Anderen? Bin der Andere ich? Nein, ich bin nicht der erfolgreiche, berühmte Dichterfürst, mit dem du seit einer Ewigkeit zusammenlebst. Der meine besten Jahre gestohlen hat. Ich bin nur dein neun Jahre jüngerer Liebhaber. Den niemand liest. Während die Verehrerinnen deines Mannes in Ohnmacht fallen, wenn sie ihn hören. Oder sich gleich umbringen. Hysterische Frauen sind für mich, was für einen Klaustrophoben ein Aufzug voller schwitzender Leiber ist, ein Klebeband um den Mund, während man an einen Stuhl gefesselt wird und keine Luft mehr bekommt. Wahrscheinlich hast du mich längst aus deinem Telefonverzeichnis gelöscht. Lenz löschen? Lenz gelöscht.
Ich bin es, der hysterisch reagiert. Ich will dir jetzt schreiben, in diesem Flugzeug, während die Berge unter mir sind, ich kann mich nicht an dieses Land gewöhnen, und die Stadt ist abscheulich. Eine Stadt, in der immer Winter ist. In der der Frühling wie der Winter ist und der Sommer wie Schnee.
Ich habe dich warten lassen! Schon seit einigen Tagen nahm ich den Stift in die Hand, aber es war mir unmöglich, nur ein Wort zu schreiben. Ich wollte mir die Bleistiftspitze in den Unterarm bohren. Ich starre durch das Splitterglas hinaus auf die Zeilen der Flugzeuge, die im Minutentakt abheben. Das leere weiße Blatt. Als hätte mir jemand die Hand abgehackt, ein Dieb, was habe ich gestohlen, die Ruhe, die Liebe, den letzten Nerv, den ich auch noch abtöten werde.
Aber ich schweife ab, vielleicht. Ich schreibe, weil ich plötzlich hier in der Höhe schreiben kann, weil ich Luft zum Schreiben habe, weil alles auf Flugmodus ist und ich auf Schreibmodus, weil ich gerade bei mir bin, wo auch immer das ist. Ich bekomme die Bilder nicht aus dem Kopf, die Leichen, Flüchtlinge, die Hinrichtungen, Selbstmordbomber. Ich hab alles, was ich bekommen konnte über den Bürgerkrieg in Syrien, gelesen, studiert, nicht verstanden, mehr verstanden, noch weniger verstanden, bin verrückt geworden, werde noch verrückter. Sie werden alle sterben. Und wir sehen zu. Wir werden zusehen. Wir werden es kommen sehen. Wir sahen es kommen. Jede Minute eine Schweigeminute. Tödliches Schweigen, tödliche Stille.
Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Wir tun uns Gewalt an. Ich dir, du mir. Ich rufe nicht an, du meldest dich nicht. Du schreist, ich schweige.
Ich sitze hier in diesem Flugzeug mit der größten Euphorie, als zöge ich in den ersten Weltkrieg, meinen ersten Krieg. Ich schaue durch diese Fenster aus dem Flugzeug und die Sonne brüllt, spuckt mir ihre Strahlen ins Gesicht. Sie hört nicht mehr auf zu lachen. Aber dort draußen ist es kalt, kälter als im Schnee. Es ist alles eine Täuschung. Wirst du diese Zeilen je lesen? Was schreibe ich dir überhaupt gerade? Diese Maschine bewegt sich ich weiß nicht wie schnell, ein Pfeil auf dem Bildschirm. Es geht immer weiter. Wo ist Afrika? Aber ich? Ich komme nicht weiter. Meine Handschrift ist zu langsam, mein Denken, was für ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz. Es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Welches Gesetz? Dass wir uns totschlagen. Unser Herz schlägt uns tot. Schlägt und schlägt, und irgendwann gehst du zu Boden, weil du die Schläge nicht mehr einstecken kannst. Was ich mir nicht alles aus dem Kopf schlagen sollte. Niemand lässt mich in Frieden, ich selbst am wenigsten. Wir machen es uns im Schweigen bequem. Ich möchte jedes Mal in die Nachrichten springen, wenn ich diese Terroristen sehe. Warum will man, wenn man Mörder hasst, selbst zum Mörder werden?
Wir kämpfen, wenn wir uns lieben. Kämpfen um die Zeit miteinander, die Demarkationslinien zwischen Körper und Seele, was wir füreinander fühlen und was fühllos bleibt. Wenn wir miteinander schlafen, beobachten wir einander, als würden wir uns verdoppeln, säßen vor dem Bett mit übereinandergeschlagenen Beinen und schauten uns zu, wie wir uns biegen, beugen, ineinanderlieben, auseinanderküssen, uns drehen, winden, halten, reißen, umarmen, wegstoßen. Wie wir schlecken, beißen, hauchen, vibrieren, verzögern. Immer schneller atmen, springen. Und wir beide sitzen da und fragen uns, ob der andere sich fallenlässt, wann er spürt, ob er genügend spürt, ob er die Mauern sprengt, alle Verteidigung aufgibt, explodiert, alle Dämme brechen, fragen uns, war ich, bin ich gut genug? Oder denken wir an jemand anderen? Überlagern den Körper mit anderen Körpern, einem unsichtbaren Tattoo. Betrügen wir uns beim Betrügen? Genügen wir uns nicht? Weil wir uns nicht genügen? Weil wir einander ungenügend finden? Ich bekomme nicht genug von dir, hauch ich in dein Ohr, hast du denn genug gespürt? Warum spüre ich es wie eine Genugtuung, wenn du dich aufgibst, allen Widerstand aufgegeben hast? Wenn dein Körper überläuft zu mir und ich überlaufe in dich, aber wie wir beide so sitzen, sehe ich, du hast die Augen nicht geschlossen, und ich frage mich, ob du mich getäuscht hast. Als hätten wir unsere Klone miteinander schlafen lassen. Manchmal, wenn wir miteinander so schliefen, war es mir, als schliefen wir mit den Fingern auf den Tasten, als liebten wir uns über unsere Telefone und könnten den anderen nicht wegdrücken, abschalten, löschen, in die Ecke werfen, sondern müssten es miteinander aushalten, Worte wechseln, bevor wir die Betten wechseln, die nächste Identität, blütenrein, weißgewaschen, eine kalte Dusche nach der Lust, heiß gebadet du.
Auf dem Sitz neben mir liegen die zerknüllten Zeitungen, dieses zerfaltete, zerfurchte Gesicht der Zeit. Ich sehe all die Kämpfer, diese jungen Fanatiker, und sie sind alle mit Lust gezeugt worden, vielleicht in Begierde, vielleicht sogar in Liebe, aber dann wurden sie, wie wir, in Schmerzen geboren. Aber sie können diesen Schmerz nur vergessen, indem sie ihn anderen zufügen. Ich kann mich nicht dagegen wehren, aber fühle Hass in mir wachsen. Hass auf die Hassenden. Mich selbst. Wir müssen uns wehren. Gegen alle.
Es fällt mir nicht mehr ein, mich zu bücken, es fällt mir nichts mehr ein. Ich gewöhnte mein Auge ans Blut. Müssen wir uns nicht lieben?
Muss ist eins der Verdammungsworte, womit der Mensch getauft worden ist. Der Ausspruch: es muss ja Ärgernis kommen, aber wehe dem, durch den es kommt – ist schauderhaft. Was ist nicht schauderhaft? Was wird uns nicht zum Ärgernis? Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Was ist das in uns, das twittert, liked, Selfies schießt, das chattet, surft, followt? Was ist das in uns, das hurt, betrügt, verfügt? Was ist das, das wegschaut, das übersieht, das offenen Auges die Augen verschließt? Was ist das in uns, das Schlimmste von allem: gleichgültig. Deshalb bin ich fortgegangen. Dein Mann wird dich über mein Befinden beruhigt haben, ich schrieb ihm. Ich habe ihn angelogen, meinen Freund. Ich verwünsche meine Gesundheit. Seit ich durch das Gate ging, bin ich wie in mir vernichtet, ein einzelnes Gefühl taucht nicht in mir auf. Ich bin ein Automat; die Seele ist mir genommen. Beirut ist noch mein einziger Trost; ich kenne zwei Schriftsteller dort, die schrieben mir oft, ich solle sie besuchen. Ich habe diese Reise im Kopf schon tausendmal gemacht. Ich werde versuchen zu schlafen. Was ist das mit uns?
L