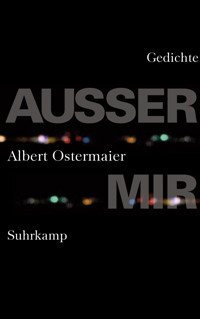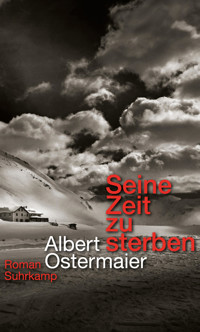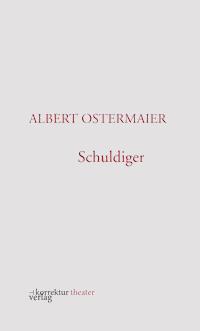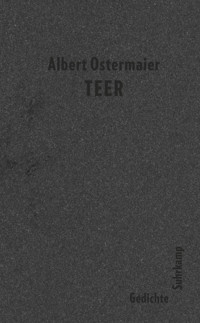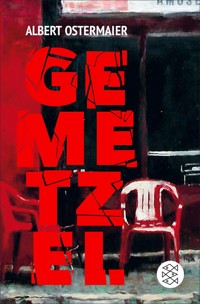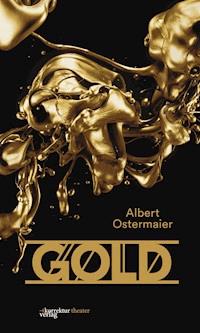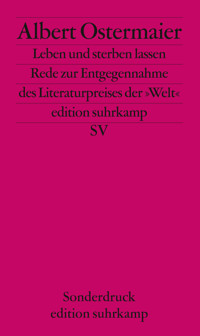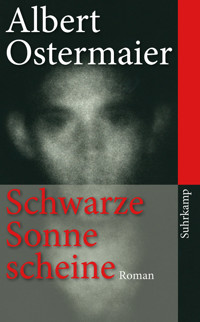
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unauflöslich und ungeheuerlich erscheint das Dilemma, das dem zweiten Roman von Albert Ostermaier seine aufs äußerste gehende existentielle, moralische und gesellschaftliche Dimension verleiht. Ein junger Mann, aufgewachsen in einem katholischen Internat in Bayern, der sein Leben darauf ausgerichtet hat, Schriftsteller, Dichter zu werden, muß sich entscheiden zwischen sicherem Tod und ungewissen Überleben, für das er sich allerdings zwei völlig unbekannten Menschen überlassen muß. Eine ausgewiesene prominente Ärztin stellt ihm die Diagnose, er leide an einer nur von ihr diagnostizierbaren tödlichen Krankheit, die eine sofortige Therapie im amerikanischen Texas erfordere. Der väterliche Mentor, ein katholischer Priester, rät, der Ärztin zu vertrauen und in die USA zu reisen. Wie soll sich der angehende Schriftsteller entscheiden? Andere Diagnosen einholen, obwohl sie laut Ärztin die Krankheit nicht aufspüren können? Dem Rat der Eltern folgen und sich sofort dem Krankenhaus ausliefern? Statt dessen rekapituliert er sein Leben und die Ereignisse, die zu dieser dramatischen Situation geführt haben. Diese Recherche der vergangenen und verlorenen Jahre eines jungen Mannes weitet sich durch die detailgetreue, nüchterne Schilderung der Internatsjahre zu einem umfassenden, erschütternden Panorama moralisch-politischer Strukturen im Süden Deutschlands, in dem der einzelne wenig, die Kirche alles zählt. Und nur wer sich gegen die miteinander verzahnten Hierarchien stellt, ist, wie Albert Ostermaier, in der Lage, souverän vom Leiden, dem eigenen wie dem anderer, einfühlsam und zugleich distanziert, spannend und mitreißend, anklagend und erklärend zu erzählen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Schwarze Sonne scheine erzählt von der scheinbar aussichtslosen Situation angesichts eines angekündigten Todes. Ein junger Mann, aufgewachsen in einem katholischen Internat, der sein Leben darauf ausgerichtet hat, Schriftsteller zu werden, muß sich entscheiden zwischen sicherem Tod und ungewissem Überleben. Ein rasanter Thriller über die Verstrickungen von priesterlichem Mentor und Schüler, Ärztin und Patient, Schreibberufung und Brotberuf. Ein erschütterndes Panorama moralisch-politischer Strukturen in Deutschland, in dem der einzelne wenig, die Institution alles zählt.
Albert Ostermaier, geboren 1967, Lyriker, Dramatiker und Romanautor, lebt in München. Er ist u.a. Träger des Kleist-Preises, des Bertolt Brecht Preises und des »Welt«-Literaturpreises. Zuletzt sind von ihm im Suhrkamp und Insel Verlag erschienen: Zephyr (2008), Wer sehen will (IB 1310), Fratzen. Blaue Spiegel (es 2587) und Leben und sterben lassen (2012).
Albert Ostermaier
Schwarze Sonne scheine
Roman
Suhrkamp
Umschlagfoto: Stefan Hunstein
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74580-9
www.suhrkamp.de
»Als ich zu schreiben anfing, wollte ich nichts als die Wahrheit über mich erzählen. Welch vergebliches Unterfangen! Was kann es Fiktiveres geben als das eigene Leben?«
Henry Miller
»Zu gewissen Stunden ist das Land schwarz vor lauter Sonne. Vergebens suchen die Augen mehr festzuhalten als die leuchtenden Farbtropfen, die an den Wimpern zittern.«
Albert Camus
›In my eyes, in disposed, / In disguise: as no one knows / Hides the face lies / The snake, the sun / In my disgrace / Boiling heat, summer stench / ’Neath the black / The sky looks dead / Call my name / Through the cream / And I’ll hear you /Scream again // Black hole sun / Won’t you come / And wash away the rain / Black hole sun / Won’t you come / Won’t you come«
Soundgarden
NARKOSEPROTOKOLL
»Zählen Sie abwärts«, forderte sie mich auf und drückte mir die Narkosemaske auf das Gesicht.
»10, 9 ...« Ich verlor das Bewusstsein, der reine Sauerstoff floss in meinen Mund, die Augenlider fielen über die fiebernden Pupillen, ich spürte meinen Kehlkopf nicht mehr, nichts mehr, der Beatmungsschlauch glitt in die Luftröhre, die Muskeln entspannten sich, das Lachgas strömte durch den Körper, betäubte den Schmerz, die Lippen, der Äther erstickte mich in den Schlaf, ich schlief.
»Sie werden fest schlafen, entspannen Sie sich. Wenn Sie ganz entspannt sind, werden Sie tief träumen«, hatte sie mich zu beruhigen versucht. »Denken Sie an den schönsten Augenblick Ihres Lebens beim Einschlafen, dann werden Sie mit ihm erwachen, als ob keine Zeit vergangen wäre.«
Der Messfühler auf meiner Fingerkuppe maß die Helligkeit des durchströmenden Blutes mit einem Lichtstrahl. Ich hatte überhaupt kein Licht mehr gesehen. »Ein halbes Jahr, länger leben Sie nicht mehr«, hatte sie gesagt. »Wenn, dann kann nur einer Sie retten, und das bin ich.« Alle Muskeln waren erschlafft, keine Abwehr mehr, keine Schutzreflexe. »Atlanta, dort haben sie eine Versuchsreihe mit noch nicht zugelassenen Medikamenten. Eine Spenderleber liegt bereit. Wir dürfen keine Zeit verlieren.« In zwanzig Sekunden hatte sie mich in tiefste Bewusstlosigkeit versetzt, die Lungenautomaten pumpten Luft in die Atemwege.
»Gibt es keinen anderen Weg?«
»Es können Sie nur Minuten vom Tod trennen, wir müssen sofort handeln.« Komplikationen wahrscheinlich. Plötzlicher Kreislaufabfall, Herzstillstand, Sauerstoffmangel, allergischer Schock. »Es ist ein tödlicher Herpesvirus«, hatte sie am Telefon gesagt, »äußerst selten, aber absolut tödlich. Ein halbes Jahr. Maximal.«
Ich war auf der Couch erstarrt, klammerte mich an den Hörer. »Aber das ist unmöglich«, als wäre die Zunge gelähmt, stammelte ich.
»Ein halbes Jahr«, rekapitulierte sie und ließ die Muschel über den Kehlkopf auf die Brust gleiten. »Es kann sein, dass Sie bei der Narkose schlecht träumen, also denken Sie an was Schönes, Erotisches, Urlaub. Denken Sie an den schönsten Augenblick Ihres Lebens.«
Es ist ein schlechter Traum, hatte ich gedacht. Ich muss nur erwachen und hier rauskommen. Die Lippen hinter ihrem Mundschutz, die Lampe, das Licht. Es blendete. »Curare ist ein Mondsamengewächs. Es ist verwandt mit dem Pfeilgift«, hatte mich der Anästhesist am Abend zuvor aufgeklärt, der heute nicht erschienen war, und seine Hand auf meinen Schenkel gelegt. »Curare ist ein kompetitiver Blocker des nikotinergen Acetylcholin-Rezeptors. Es fungiert als Antagonist des Acetylcholins. Das zentrale Nervensystem bleibt weitgehend intakt, auch der Herzmuskel ist nicht betroffen.« Er hatte gelacht. Das Lachgas lähmte die Schmerzen, die Schnitte. »Der Ablauf einer Narkose ist mit einem guten Flug zu vergleichen, nach dem Abheben warten wir, bis wir die sichere Flughöhe erreichen. Die Narkoseausleitung ist dann der Sinkflug vor der Landung.«
Wie war ich hier gelandet? Wo würde ich erwachen, würde ich erwachen? »Ich habe eine geniale Ärztin entdeckt«, hatte Silvester am Telefon gesagt, »sie ist Virologin am Max-Planck-Institut. Sie findet, was sonst keiner findet, sie hat ganz neue Methoden. Sie hat mir das Leben gerettet. Du warst doch so krank, als du aus dem Jemen zurückkamst ...«
»Aber jetzt fühle ich mich so gesund und lebendig wie nie«, hatte ich eingewendet und das Tuch mit den Eiswürfeln über den verstauchten Knöchel gelegt.
»Willst du nicht wissen, was es war?« Er hatte nicht lockergelassen. Ich wollte es wissen. »Weißt du, ich muss oft an unsere gemeinsame Lesung denken, als du das erste Mal deine Gedichte gelesen hast und ich dazu gespielt habe. Wir sehen uns so selten, seit du ... Aber wenn ich aus China zurück bin, gehen wir Essen. Ich geb dir die Nummer der Ärztin, ruf sie an.« Der schönste Augenblick. Warum dachte ich jetzt an ihn. Am Ende der Narkose verlieren die Mittel nach und nach ihre Wirkung. Wenn nur noch eine geringe Dosis im Körper ist, wacht der Patient langsam auf, und es kann passieren, dass seine Wahrnehmung noch nicht einsetzt, und alles verzerrt sich. »Zählen Sie abwärts«, hatte sie gesagt. »Ein halbes Jahr. Maximal.« »Du kannst auf mich zählen«, hatte er mir versprochen und mich gesegnet mit seinen singenden Händen. »Vor jeder Narkose ist ein Aufklärungsgespräch vorgeschrieben«, hatte ich in dem gelben Faltblatt gelesen. »Sprechen Sie vorhandene Ängste an. Nutzen Sie diese Gelegenheit, all Ihre Frage zu stellen.« Ich hatte am Ende unterschrieben. Das Gasgemisch wurde kontinuierlich zugeführt. Alle Notfallapparaturen waren griffbereit. Sie hatte es mir angekündigt. »Sie wachen erst wieder auf, wenn alles vorbei ist.«
1
Es war kaum eine Handbreit weit zu sehen, der Nebel schob sich über die Windschutzscheibe – oder zog er mich in sein Land? Ich war nüchtern. »Kommen Sie nüchtern zur Blutabnahme. Ein befreundeter Arzt wird Ihnen das Blut abnehmen, er hat seine Praxis gleich neben meinem Bungalow. Kommen Sie zuerst zu mir«, hatte die Professorin mich angewiesen und mir ihre Adresse in der Nähe Landshuts durchgegeben. Sie habe keine eigene Ordonanz, hatte sie erklärt, sie sei nur in der Forschung tätig. Die defekte Lüftung sog die feuchte Kühle herein, kaum ein Scheinwerfer durchdrang den Nebel. Ich fuhr fast Schritttempo und hatte Angst, die Ausfahrt zu verpassen.
»Am frühen Morgen des 17. Januar um 1 Uhr MEZ lösten die Koalitionsstreitkräfte einen massiven Luftkrieg aus. Dies ist der Beginn der Operation Wüstensturm«, ich drehte das Radio ab und verlor fast die Spur, rutschte auf Bankett und war kurz davor, die Leitplanken zu streifen. Ich hatte die ganze Nacht dieses grüne Leuchten gesehen, hatte den Ton abgedreht und versteinert auf die Bomber gestarrt. Als handle es sich um eine Folge von Emergency Room, so leuchteten sie die Landschaft aus mit ihrer präzisionsgelenkten Munition, und die stummen Lippen der synchronisierten Erreger verrieten das Unausgesprochene, das Unsichtbare hinter dem Offensichtlichen: Die Wüste brannte, die Menschen in den Leitzentren, die Soldaten in den Panzerglühöfen, denen die Haut in Streifen von den Knochen fiel, aber keiner zeigte sie, nur den Krieg der Selbstgerechten um die Ölfelder Kuwaits in den Brandwolken.
Nach dem Aufstehen hatte ich das Aspirin schon aus der Packung gedrückt, ließ es aber neben der Spüle liegen; ich durfte ja nur Wasser trinken, nicht mein Blut verdünnen, bevor sie es mir abnahmen. Ich schwitzte, das Fenster war auch von innen beschlagen. Endlich tauchte im Nebelscheinwerferkegel die gesuchte Ausfahrt auf, ich verließ die Geisterautobahn und war mit einem Mal verschluckt von dieser zäh wabernden Suppe. Als hätte man den Himmel zur Ader gelassen und nichts als Nebel und letzter Hauch wäre aus ihm geströmt. Ich hielt am Ortseingang, kurz hinter dem gelben Schild, tastete nach dem zerknüllten Zettel auf dem Beifahrersitz und versuchte meine Handschrift und die verwischte Tinte zu entziffern, um herauszubekommen, welchen Weg aus dem Grau ich einzuschlagen hatte. Was wollte ich hier? Gewissheit? Gänseblümchenmäher. Was, wenn sie etwas fand, die Spezialistin? Wollte ich das wissen? Ich war wieder gesund, es war doch zwei Jahre her, dass ich krank aus dem Jemen zurückkam mit einer aufgeblähten Leber, an der die Adleraugen der Ärzte nichts fanden, alle Untersuchungen ergaben nichts, die Schnäbel bleiben leer, wie oft sie auch mein Blut zogen und die Proben durch die Labors schickten. Drei Monate Dämmern, dann war alles vorbei, Brennnesseltee, Hafertabletten, Antibiotikahämmer. Es war dein Kopf, meinte David, der Freund, du hast dich selbst krank gemacht. Weil es dich krank macht, dass du deinen Eltern nicht sagen kannst, dass du die Firma nicht übernehmen wirst und dann alles zu Ende ist, die schöne Firmengeschichte und hundertjährige Tradition, der einzige Sohn, und deine glückliche Kindheit geht über Nacht aus wie ein böses Märchen.
»Dein Studium ist nichts als eine Farce, du musst ihnen sagen, dass du Dichter werden willst. Haben sie es denn nicht gemerkt, als du mit dem Abt gelesen hast? Warum stellt er sich mit dir auf eine Bühne, wenn er nicht an dich glaubt? Das hat doch jeder gespürt, dass du kein Jurist wirst, genauso wenig wie du Architekt geworden bist und nur Toblerone gestapelt hast.« Er hatte auf mich eingetrommelt wie auf seine Drumsets, als wir noch in unserer Band Herzschläge austeilten. Er hatte recht, ich musste Farbe bekennen. Ich hatte mich immer noch nicht zurückgemeldet, sie würden mich exmatrikulieren. In den Klausuren hatte ich mir alle dichterischen Freiheiten genommen, und was mir recht war, wollten die Korrektoren nicht als Recht gelten lassen und sprachen es mir ab, es weiter so zu verdrehen, wie ich damit durchzukommen hoffte. Nur Schlingen hingen genau so wie ich in der Luft, und in alle legte ich meinen Kopf und wartete, dass jemand zuzog. Aber ich rettete mich immer, scheinbar, tauschte eine Lüge gegen die andere, ein Versprechen für das nächste uneinlösbare, ich gewann Zeit, aber in Wahrheit verlor ich sie. Nie genügte ich, nicht mir, nicht den Eltern, niemandem. Es fehlte nicht mehr viel, und alle hatten endlich genug von mir, aber sie konnten auch nicht genug kriegen. Ich gab ihnen zu wenig, während ich dachte, ich gäbe alles, mein Leben, meine Liebe, zu wenig und zu viel, um es länger ertragen zu können, dachte ich mir. Ich suchte nach der großen Entschuldigung, der alles umfassenden Rechtfertigung. Wofür? Ich bin schuldig, hatte ich bei Kafka gelernt, aber es müsste doch etwas geben, das mich entschuldigt, vielleicht, eine Krankheit, gefangen in meinen Nervenfallstricken, wenn die Malaria mir meine Moral weggefressen hätte, wenn die Gelbsucht all die Fehlfarben mit Fieberschüben übermalt hätte. Warum sehnte ich mich nach einer Absolution dafür, mein Leben so zu leben, wie ich es noch gar nicht lebte, verstohlen lebte, in Träumen auslebte und ihm beim Erwachen nachtrauerte wie einem Film nach dem Abspann?
Endlich hatte ich die Adresse auf dem Zettel gefunden, und selbst der eifersüchtige Nebel gab der Sonne ein Loch frei, durch das ihre Strahlen fallen konnten und fielen. Ich parkte vor einem Bungalow. Immer verfolgten mich Bungalows in meinem Leben, Flachdachbiografien, domestizierte Moderne, Sichtbeton. Wie ein Zeichen. Aber ich sah das Zeichen nicht, sondern drückte auf die Klingel, und sie öffnete mir, Frau Professor.
Ich kannte sie nur von Gerüchten und aus Silvesters begeisterten Erzählungen, wonach sie jene verzweifelt-gefassten Klosterbrüder und Patres aus der Mission, aus dem tiefsten Afrika oder dem verborgensten China, denen nichts mehr als das Beten blieb, dass sie jene wider alle Erwartung geheilt habe. Nicht mit Magie, sondern mit Medizin, mit ihrem Vorsprung durch Forschung. »Ich vertraue ihr«, hatte Silvester am Telefon gesagt, »sie hat mich gerettet, diese Frau ist ein Geschenk des Himmels.« Und ich vertraute Silvester. Wem, wenn nicht ihm, der Narziss und Goldmund in einer Person verschmolz, ein Augenpaar, dessen Lebenshunger meinen Seelendurst traf, der als Erster den Künstler in mir sah und aussprechen konnte, was meine Eltern nicht hören wollten, und dem sie nicht widersprechen konnten, denn er war die unumstößliche Autorität, von Gott eingesetzt. Wir beteten ihn an, ich, weil er mir die Kunst zeigte und öffnete wie ein Buch voller Wunder, dessen Worte und Miniaturen, dessen Sinnlichkeit und Spiritualität mich berauschten, weil das Geistige seine Hände hatte, die die Seiten umblätterten, weil er so widersprüchlich war wie das Leben, weil er in zwei Welten lebte wie ich, weil er mir wie ein Bruder war, der ich keinen Bruder hatte. Und meine Eltern sahen seine Fehler und übersahen sie gerne, weil er das Göttliche repräsentierte, an dem sie teilhaben durften, an der Macht, an der großen Erzählung des bevorstehenden Heils, an dem Weihrauch, der die Wirklichkeit mit einem Unwirklichkeitsschleier versah, weil sie ihm die Hand geben konnten und nicht küssen mussten, weil sie seine Leidenschaft für die angenehmen Dinge des Lebens sahen und sie ermöglichen und teilen konnten, weil er die Sünden vergab und wir mit ihm sündhaft speisten von den Früchten der Schöpfung, weil er das Tafelsilber segnete, mit dem er den Rehrücken teilte, weil er das Brot brach und nicht den Stab, weil er die Messe las, aber die Leviten nur den gläubig Knienden. Weil er den Sohn, mich, unter seine Fittiche nahm, seinen Mantel, weil ich mit meinem Latein am Ende war, aber er ein neuer Anfang, weil er mit mir den Vergil las und der junge Mann den Jüngling die Welt entdecken ließ wie die Schönheit eines Psalms, geformt in hundert Mönchskehlköpfen, weil er die Stimme in meinem Kopf wurde für das, was ich meinen Eltern nicht zu sagen wagte. Er war die Kirche, die unfehlbare, aber er war fehlbar, und so fehlte nicht die Schwäche, die Vertrauen schafft, die das Unerreichbare auf Augenhöhe bringt. Man konnte ihm in die Augen schauen. Er war ein Engel, mit dem man fallen wollte, er war der Teufel, um Gott zu beweisen, er war die zwei Seelen in meiner Brust und die Pfeilspitze in der Mitte. Er war ein Freund der Familie und mein Freund, Lehrer, die Existenz der Welt von den Lippen lesend, die Zeichen am Himmel, den Vogelflug, die Vögel, die man töten muss, will man in ihren Eingeweiden lesen.
»Ich kenne dich in- und auswendig«, hatte er mir einmal erklärt, »es steht alles in deinen Gedichten.« Die Gedichte, die für meine Freunde ein Schock an Fremdheit waren, denn sie hatten gedacht, sie kennen mich, den Lachenden, den Freundschaftsvorantreiber, Gesprächserhitzer, Gemeinsamträumer, Abenteuerausdenker, Zuhörer und Diskursdispatcher, wenn wir Weltversteher und -verbesserer die Nächte durchphilosophiert und uns in der Dunkelheit so alt fühlten und erwachsen wie das Angelesene, das unter die Haut Gelesene, das in die Köpfe Hineingelesene, das Sperrig-Unverstandene, Einverleibte und beiläufig oder hitzig oder triumphierend wie ein Joker Ausgespielte, der lachende Joker, das war ich, aber das Lachen war er.
Am elften Januar waren die sowjetischen Fallschirmjäger über dem litauischen Verteidigungsministerium aus dem Himmel gefallen, die Panzer durch die Menschenketten gebrochen. Warum dachte ich daran plötzlich, hier vor der Tür, den Finger auf der Klingel, drück doch, drück doch endlich, warum drückst du nicht, die Omon-Truppe hatte das Innenministerium gestürmt.
»Ich glaube nicht, dass es noch einen diplomatischen Spielraum gibt«, resignierte Pérez de Cuéllar mit versteinertem Gesicht auf dem Rückweg von Paris. Die Raketen finden ihre Wege in die Lüftungsschächte. Der Wüstensturm. Waren es nicht Sandkörner, die gegen mein Gesicht prallten, der Scirocco, der böse Wind, was brachte er. Ich drückte den Klingelknopf. Sie öffnete.
»Da sind Sie ja, kommen Sie rein. Einen Kaffee? Ach nein, Sie müssen ja nüchtern sein. Dort hinten, das ist übrigens Pater Stefan, er ist gerade bei mir quasi in Quarantäne, nicht wahr, Pater Stefan. Er kommt aus Afrika. Aber eigentlich können wir auch gleich los in die Praxis. Nervös? Wird Ihnen schlecht beim Blutabnehmen?« Sybille Scher. Sie war groß, burschikos, Bürstenhaarschnitt, androgyn, wie eine Modigliani-Figur, unter der Haut Muskelpakete versteckt, jede Faser ein harter Strang, alle Lockerheit ehrgeizig. Sie entwickelte sofort einen Sog, kam näher, als es angemessen gewesen wäre, überschritt vom ersten Augenblick an eine Grenze. Ihr »Sie« klang wie ein »Du«, ihre Augen schufen eine Aura des Verschworenseins. Ihre Blicke ließen keinen Zweifel, keinen Widerspruch zu: »Lege dein Schicksal in meine Hand«, sagten sie. Sie war jungenhaft und männlich zugleich, hatte diesen verschüchterten Mädchenblick und dann im nächsten Moment etwas fast Verruchtes, Obszönes, Aufforderndes. So kam es mir zumindest vor. Ihre Ausstrahlung verlangte geradezu nach Projektionen. Sie war wie ein Kaleidoskop, in dem permanent die Bilder wechselten, sie setzte sich immer wieder neu zusammen, aber man schaute immer durch den gleichen Tunnel auf dieses Faszinosum aus bunten Steinchen, die sich in unendlichen Geometrien veränderten.
Der Bungalow war ein langer Schlauch, Klinkersteine, im Hintergrund, der sich für mich ins Unendliche zog, verlängerte, ein Holztisch, an dessen Ende sich ein Pater in seiner Kutte kauerte und mich aus leeren Augen anblickte, so schwach, als könnte sein Blick mich nicht erreichen, nicht die kurze Distanz überwinden, als wäre er wirklich in einer unsichtbaren Quarantänezelle und es gewohnt, hinter diesen Scheiben Schemen zu sehen, Stimmen zu hören.
Sybille Scher war gut gelaunt, bestimmt. »Gehen wir, nur zwei Häuser weiter, der Doktor wartet schon.« Ich folgte ihr, fragte mich, warum sie nichts fragte. »Silvester hat mir alles erzählt. Ich finde es, wenn es etwas zu finden gibt, keine Sorge.« Sie war nun immer einen Schritt voraus, als wäre ich gehemmt, als wäre ein Zögern in all meinen Bewegungen. Aber sie war die Expertin, sie war ja die Klarheit nach dem Nebel. Es war kalt. Ein kalter Januarmorgen in Niederbayern, Jagdszenen, dachte ich immer, wenn ich nach Niederbayern fuhr. Menschen, die auf Bänken vor den Höfen sitzen und auf die leere Straße starren, bis der nächste Halbstarke auf seinem Motorrad liegend vorbeirast, wo die Ortsschilder einem ein Wiedersehen in der Neuen Welt versprechen und die Männer mit Herzen aus zerbrochenem Glas am Tisch sitzen und die Worte wie Splitter ausspucken, nachdem sie eine Unendlichkeit ihre Innereien aufgeschlitzt haben, bis sie es auf die Zungen und über die Lippen schaffen, gerade noch so, denn die Hälfte der Worte wird sofort wieder verschluckt, zurückgepfiffen. Dieser dunkelste Teil Bayerns, dieser Wald in den Köpfen, dieses Rauschen, die Landschaft der bösen Märchen, Zwerge, dieser mythische Grund mit unterirdischen Flüssen und Goldströmen, die Glasbläserei, dieses Stollentreiben in die Finsternis, diese Schwärze, die sie nach oben fördern, die leeren Hände ohne Arbeit, das Bier und BMW, Öds und Ödnisse, der tiefe Himmel. Und diese Schönheit, die Raunächte, der Grimm, die Blaubeeren und Füchse, die Anhöhen und Hügel im Wind, im Schatten unter der weiten Krone des Baumes, unter denen wir lagen, Handke lesend über die Langsamkeit, die Versuche und so unsere ersten Annäherungsversuche unternahmen an das Glück auf dieser Insel fernab der anderen.
Wir waren in der Arztpraxis angekommen. Ich durfte mir den Arm für die Blutprobe aussuchen. Wie immer wählte ich den linken, zog das Hemd hoch, ballte die Faust und erwartete die Nadel, den kurzen Schmerz, wenn sie die Haut durchbrach und in die Vene glitt, bis das Blut in die Röhrchen schoss, dunkelrot. Dr. Andreas machte das selbst, keine Assistentin, wie ich es gewohnt war. Sybille schaute zu, als läge ich unter einem ihrer Mikroskope, als entdecke sie gerade das bislang unentdeckt Gebliebene. Ich fühlte mich wie ein Schmetterling, der aufgespießt ist, aber noch flattert. Warum waren sie zu zweit, warum war sie dabei und wartete nicht in ihrem Bungalow? Gab es schon etwas Auffälliges an mir? Vielleicht begleitete sie immer ihre Patienten, die Patres und Brüder, die der deutschen Wirklichkeit entwöhnt waren oder das erste Mal mit ihr in Berührung kamen, krank dieses Land betraten, das sie nur aus den Erzählungen kannten, aus dem Bilderbuch der Sehnsucht. Das Paradies, ein paar Flugstunden und Welten entfernt, in das sie Gezeichnete vom Tod wie Schatten fielen, die sich an die sonnigen Rücken der Glücklichen hängten und diese freundlichen Ärzte, die sie fürsorglich behandelten und beglückwünschten zu Sybille, die sie an der Hand nahm, eine größere Chance auf Gesundung und Ende der Ungewissheiten und Ängste gäbe es nicht.
Sie lachte. »War es schlimm?« Ich drückte das Pflaster in die Armbeuge und verneinte. »Einen Kaffee, Lust auf Frühstück, mein Mann hat bestimmt Brezen geholt?« Eigentlich wollte ich ablehnen, zurück auf die Autobahn, an irgendeiner Tankstelle halten, schlechten Kaffee trinken, ein lauwarmes Croissant dazu, rauchen und allein sein, zurück auf die Straßen, an die Zapfsäulen, den sich lichtenden Nebel schauen, irgendwo im Nirgendwo Luft holen, den Tag neu beginnen. Ich war manchmal so unerwartet klaustrophobisch, konnte Menschen um mich von einem Augenblick zum anderen nicht ertragen, so distanziert die Nähe auch war, ich überlegte oft schon beim Ankommen, wann ich wieder gehen könnte, als hätte ich den Raum nur betreten, um meine Anwesenheit zu bestätigen und die Gewissensschuld zu begleichen und dann sofort umzudrehen und zu vergessen und das nächste Defizit auszugleichen. Ich hätte ja den Besuch irgendeiner Vorlesung vortäuschen können, aber ich war neugierig. Wer war diese mysteriöse Frau, die Silvester so wichtig, so lebenswichtig geworden war, die in jedem zweiten Satz auftaucht?
»Er vertraut mir blind«, blinzelte sie mir zu und reichte mir den Brotkorb. Wir waren allein, niemand war mehr im Esszimmer des Bungalows, keine Spur des Paters in Quarantäne. Die Kinder waren sicher in der Schule. Der Mann hatte das Frühstück gemacht, es war nur für eine Person gedeckt. »Ich war sogar in seinem Zimmer. Hinter der Klausur, ich habe einen Schlüssel«, erzählte sie nahezu triumphierend ihre Präsenz in dem für Frauen verbotenen Bereich, ihre Ausflüge in die Tabuzonen. Sie sprach von seiner Zelle, dem Arnulf Rainer über seinem Bett, den er mir auch gezeigt hatte. Er hatte mir einen Likör angeboten, weil ich so gut meine Lateinlektion gelernt hatte, denn er gab mir Nachhilfe in seinem Gästezimmer vor der Klausur. Und dann waren wir durch die hintere Tür in seine Zelle gegangen, aus deren breiten Fenstern er über das Moor blickte bis zu den Bergen im Föhn. »Ich bin ja seine Ärztin, ich habe immer Zutritt«, sie zeigte mir einen Schlüssel. »Ohne mich wäre er nicht mehr am Leben, noch Marmelade?«
Seit dem Abitur, seit ich dann mit Klara zusammen war, hatte ich den Kontakt zu ihm nie verloren, wir hatten uns seltener gesehen, meistens telefoniert, er hatte mir Briefe von seinen Reisen geschickt, Karten. Irgendwann sprach er dann in Andeutungen, Rätseln, er trank nichts. Und dann war sie Thema, er sprach ihren Namen aus, als bete er zu Gott, als müsste er ihn singen, als sei sie das Heil. Und sie war es für ihn, vertraute er mir an, sie hatte ihn behandelt. Warum hatte er mir nicht gesagt, dass er krank sei, sterbenskrank, dass sein Leben an einem Faden hänge, dass sie diesen Faden in der Hand halte? Klara hatte ihn nicht gemocht, er war ihr fast körperlich unangenehm, ihrer protestantischen Seele war er fremd, sie mied ihn wie der Teufel das Weihwasser, nein, er war ein Teufel für sie, den ich mit Weihwasser besprengte, sie wollte mich entfernen von ihm, dieses Katholische war ihr suspekt, er nützt euch aus, wiederholte sie. Sie war so vehement, fast eifersüchtig, wie sonst nur, wenn ich eine andere Frau ansah, aber ich sah keine anderen Frauen an. Und jetzt war ich fast eifersüchtig auf diese Ärztin, als hätte sie meinen Platz eingenommen, als hätte sie nicht nur die verschlossenen Türen geöffnet, sondern auch die Räume dahinter besetzt, die Herzwände neu ausgemalt mit der Schwarzmalerei ihrer Diagnose und danach mit der Goldfarbe der Heilung. Ich war so eng verbunden mit seinem Geist, aber sie hatte seinen Körper missioniert, ihn dem Tod entrissen. Sie war sein Engel. Sie ist ohne Geschlecht, hatte ich gedacht, aber zugleich so, als wäre sie nichts als Geschlecht, als schliefe sie mit dem Tod, um ihm jene zu entreißen, die er sich ausgesucht hatte, als könnte sie ihn immer wieder aufs Neue besiegen, betrügen, hinters Licht führen.
»Wie geht es eigentlich Ihrer Mutter«, wollte sie von mir wissen, und ich verschluckte mich fast. »Sie hätte auf meinen Rat hören sollen, das Risiko ist hoch, sehr hoch.« Sie war mit ihr auf Anraten von Silvester bei einem Facharzt gewesen. Sie hatte nichts erzählt, nur angedeutet, sie schlössen nicht aus, es könnte Krebs sein, man solle sofort operieren, es sei höchste Zeit. Aber sie wollte nicht, wollte nicht ihren Arzt hintergehen, wollte nichts wissen. Sybille war ihr zu hart, zu fordernd. Mutter wollte mit Recht umsorgt werden, geachtet, nicht ermahnt oder aufgefordert. Es war ihr alles zu schnell gegangen. Sie hatte sich schon auf dem OP-Tisch unter den Skalpellen gesehen, Sybille hinter der Maske mit Sezierblick in ihr Innerstes blickend und die Metastasen entdeckend. Nein, sie glaubte lieber ihrem alten Arzt, der nichts gefunden hatte. Was sie nicht wusste, machte sie nicht krank. Was sie wusste, machte sie krank. Sybille ließ nicht locker, aber meine Mutter schaltete auf stur, trotz Silvester, trotz seiner Abt-Autorität, trotz der Unfehlbarkeit der katholischen Kirche hatte sie keine Lust, sich länger untersuchen zu lassen. Sybille fragte weiter nach. Als wollte sie mir Angst machen, meine Sorge um meine Mutter anfachen, sie appellierte an meine Verantwortung, indirekt. Sie wollte wissen, wie es der Firma gehe, ob ich sie übernehmen werde, ich sei doch ein Künstler, hätte Silvester erzählt, wie das denn zusammenginge? Ob mich das belaste? Ob ich darüber sprechen möchte? Ich wollte nicht über die Firma reden, nicht über meine Zukunft. Was war an dieser Frau so anders, fragte ich mich, was war ihr Geheimnis, was war so anziehend an ihr, dass sie alles an sich ziehen konnte, dass sie alles vereinnahmen konnte? Sie gab sich mir gegenüber, als kennten wir uns seit langem, sprach so vertraut über Silvester mit mir, als würden wir ein Wissen teilen. Aber ich war nicht mehr in Silvesters Welt, ich hatte eine neue Welt entdeckt, und jetzt tat sie so, als hätte ich die alte nie verlassen, als hinge auch ich an unsichtbaren Fäden oder im Netz.
»Wir könnten doch einmal zu dritt Essen gehen, hätten Sie Lust? Ich würde auch einmal gerne etwas von Ihnen lesen, habe ja schon bei Silvester einen Blick darauf geworfen. Aber jetzt muss ich los, Sie können gerne noch in Ruhe weiterfrühstücken, fühlen Sie sich wie zu Hause. Ja, und wegen des Ergebnisses rufe ich dann an, sobald ich es analysiert habe. Ihre Nummer hat ja Silvester. Wir sehen uns!« Noch ehe ich reagieren konnte, war sie aus der Tür und ich allein in diesem Raum und in der unvermittelten Stille. Ich bekam Angst, wusste nicht warum, der Nebel war verschwunden, die Sonne stach durch das Flügelfenster, sie war so hell, als wäre es nicht Januar. Und dennoch fror ich. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang waren die ersten Cruise Missiles in Bagdad eingeschlagen. Auch jetzt würden sie durch die Luft jagen, den Himmel durchkreuzen, unzählige. Sie suchten die verborgenen Arsenale. Was war in mir verborgen? Was konnte sie finden? Konnte sie etwas finden? Ich überlegte, ob ich den Tisch aufräumen sollte. Ich ließ alles stehen und zog die Tür hinter mir ins Schloss, lief zum Auto, startete, schaltete das Radio an. Kohl wurde zum Kanzler gewählt. Blühende Landschaften. Israel befürchtete, Scud-Raketen könnten Tel Aviv erreichen. Giftgas. Ich öffnete das Schiebedach. Ein Stück Himmel. Atmen. Luftholen. So ein Unsinn, wozu die Panik. Ich bin völlig gesund. Ich muss mein Leben ändern, das ist alles. Sie wird nichts finden. Ich wechselte den Sender. ICE-T, OG Original Gangster.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!