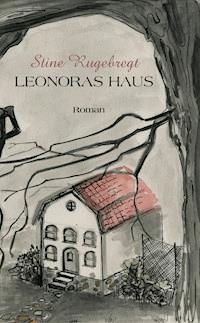
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Iudicium
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Psychotherapeutin Dorothea erbt unerwartet ein Haus von ihrer Tante, Leonora. Einige Jahre später, nach dem Tod ihres Mannes, bezieht Dorothea das Haus in dem Eifeldorf Awel. Schon bald wird sie mit einem geheimnisvollen Fall konfrontiert: Vor einigen Jahren hat Max, der Sohn des Supermarktinhabers, aufgehört zu sprechen. Als der Vater Dorothea um Hilfe bittet, ahnt sie, dass diese Tragödie auch etwas mit ihr selbst zu tun hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STINE RUGEBREGT
LEONORAS HAUS
Roman
Umschlagbild: Nora Roggausch
Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
ISBN 978-3-86205-932-4 (E-Book)
© IUDICIUM Verlag GmbH, München 2012
Alle Rechte vorbehalten
www.iudicium.de
Als die Zehn Gebote in Stein gemeißelt waren,fehlte Platz für das elfte.
INHALTSVERZEICHNIS
Cover
Titel
Impressum
Zitat
Irgendwann nach der Jahrtausendwende
Maria
Dorothea
Herbert
Dorothea
Wilhelm
Leonora
Epilog
IRGENDWANNNACH DERJAHRTAUSENDWENDE
Er hörte, wie seine Mutter in der Küche hantierte. Hörte, wie sie einen Topf auf den Herd stellte. Er hielt den Blick auf seinen Teller gerichtet, während er langsam weiterkaute. Jetzt war sie mit dem Besteck beschäftigt. Im Geiste konnte er ihre Bewegungen genau verfolgen. Sie trocknete jedes einzelne Stück sorgfältig ab. Das Trocknen erfolgte immer nach einem festen Muster, von dem sie nie abwich. Zuerst kamen die ,Sonderteile‘, wie Suppenkelle, Fleischgabel oder Salatbesteck. Danach alle Löffel, große und kleine. Anschließend die Gabeln. Und zum Schluss die Messer. Messer ...
Er hörte auf zu kauen. Messer. Langsam hob er den Blick. Zunächst schaute er auf den Fleischbraten, der einladend auf seinem Holzbrett wartete. „Schneid‘ mir noch eine Scheibe ab“, schien er zu sagen. Neben dem Brett lag das Tranchiermesser. Einige Sekunden lang fixierte er das Messer. Dann glitten seine Augen über den Braten hinweg zu dem Platz gegenüber: dem Stuhl seiner Mutter. Auf dem jetzt Momo, die graue Katze, saß. Sobald seine Mutter aufgestanden war, war Momo frech auf ihren Platz gesprungen und starrte nun wie hypnotisiert auf den Braten.
Sein Gesicht bekam einen nachdenklichen Ausdruck. Momo schien seinen Blick zu spüren, denn plötzlich wandte sie die Augen vom Braten ab und schaute ihn an. Einige Sekunden lang sahen beide, Katze und Mann, einander intensiv an. Dann stand er auf und ging um den Tisch herum. Momo machte erwartungsvoll einen Katzenbuckel. Er nahm ganz ruhig das Tranchiermesser vom Tisch und stieß mit einer fließenden Bewegung zu. Legte das Messer wieder auf den Tisch. Momo gab nur einen kurzen Laut von sich, starb fast geräuschlos.
Seine Mutter kam aus der Küche. Nahm das Bild in sich auf. Und begann zu schreien, während sie hilflos, wie angewurzelt, dastand.
Er starrte sie stumm an, schrie aber in Gedanken: „Hör‘ auf!“
So laut er konnte schrie er. „Hör‘ auf, du Hexe, hör‘ auf, hör‘ auf!“
Er legte die Hände an die Ohren, seine stummen Lippen zuckten verzweifelt. Aber sie hörte nicht auf.
„Das halte ich nicht aus! Hör‘ auf, ich halte es nicht aus!“ Seine Gedanken kreischten ohrenbetäubend. Seine Hand griff wieder nach dem Messer, drehte es zu sich selbst – und stach zu. Er schloss die Augen.
Mit einem Mal war Ruhe. Er lag auf dem Rücken und er schwebte. Irgendwo tat ihm etwas weh, aber es war nicht unerträglich. Er schwebte, und als er die Augen aufmachte, sah er ein sanftes Licht. Plötzlich wusste er mit großer Gewissheit, warum er schwebte. Weil er auf diesem Licht lag, auf diesem angenehmen Licht. Er fragte sich, wie das möglich war, was es auf sich hatte mit diesem Licht. Es war so beruhigend. Er lächelte. Das Licht wurde heller, aber nicht grell. Je heller das Licht wurde, desto mehr zog sich der Schmerz zurück.
Jemand kam auf ihn zu. Nein, schwebte auf ihn zu.
Sein Vater. Er machte ein bekümmertes Gesicht. „Mein Sohn ...“ Sein Vater kniete sich an seine Seite. Er wollte ihn nicht sehen, wandte den Blick ab, schloss die Augen wieder.
„Nein, zuerst hör‘ mir zu“, sagte sein Vater. „Oder uns.“
Uns? Er öffnete die Augen. Seine Mutter. Bleib mir bloß weg!
Auch sie hatte sich niedergekniet. Sie rang verzweifelt ihre Hände.
„Hör uns zu, Max! Bitte, hör‘ uns zu! Geh‘ nicht so. Das ist doch keine Lösung!“
Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Doch, es war eine Lösung. Wieder schloss er die Augen. Endlich Ruhe!
Er wünschte, sie würden gehen! Ihn mit diesem wunderbaren Licht alleine lassen. Das mussten sie doch verstehen!
Sie wollten reden? Na, dann los! Er würde tun, als ob er schon tot wäre!
„MAX!“ rief jemand. Er zuckte zusammen. Nein! Sein Körper wand sich vor Angst. Diese Stimme! Er wollte flüchten. Aber, ach ja, das Messer! Er konnte sich nicht bewegen. Dieser Teufel. Dieser Dämon!
„Max ...“ Oh, dieser schmeichelnde, flehende Ton. Der stählerne Klang darin. Rasiermesserscharf. Angst, Angst, Angst!
Er stellte sich tot.
„Max ...“ Flehend. Aber anders als damals. Irgendwie anders. Was war das? Damals gehörte der flehende Ton zum Spiel. Zum teuflischen Vorspiel. Dieses Flehen klang anders. Klang echt.
Jetzt knieten sie alle drei an seiner Seite. Max spürte Hass. Einen Hass, so tief, dass er Raum und Zeit zu transzendieren vermochte. Auf einmal erfüllte ihn eine Klarheit, die er sein Leben lang nicht gekannt hatte. Auf einmal wusste er, dass er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich lebendig war. Und plötzlich wusste er mit absoluter Gewissheit, dass er diesen Hass, diesen leidenschaftlich tiefen Hass mitnehmen würde. Oder umgekehrt: Dass dieser Hass ihn ins nächste Leben zerren, mit ihm tanzen und ihn herumwerfen würde ...!
Nein, seine Eltern hatten recht: Es war keine Lösung. Es würde weiter gehen, immer weiter. Nichts war zu Ende!
Er spürte, wie sich, tief in seiner Brust, ein Schluchzen Bahn brach. Ein Schluchzen, verzweifelt und erschütternd, das wie ein Erdbeben seinen Widerstand zertrümmerte. Und aus dem Grund seines Herzens stieß er den uralten Ruf der Menschheit aus, so wie die letzte Wehe das Baby aus der Gebärmutter treibt:
„Herr, hilf mir!“
Und sieh da: Wie die Antwort Gottes spürte er schlagartig, wie sich Raum und Zeit, Vergangenheit und Zukunft auflösten. Aus dem Licht trat eine Gestalt und näherte sich ihm. Eine weibliche Gestalt. Er erkannte sie. Dorothea! Jetzt weinte er vor Erleichterung. Sie sah ihn mit unendlichem Mitgefühl an. Und sagte:
„Höre zu ...“
MARIA
Ja, ich bin schuldig. Das sage ich mal gleich vorweg. Und feige bin ich auch. Denn ich hoffe, dass diese Geschichte erst nach meinem Tod, wenn überhaupt, gelesen wird. Ich möchte keine Fragen und keinen Kommentar. Papier kann man einfach ohne Erklärungen abgeben. Warum ich sie erzählen will? Obwohl alles zu spät ist? Natürlich weil es zu spät ist. Weil ich Reue empfinde. Und weil Dorothea mich darum gebeten hat.
Nachdem sie Max in der Psychiatrie eingeliefert hatten, begann ich, meine Entscheidung anzuzweifeln. „Es ist doch nicht für immer“, hatte der Psychiater beruhigend gesagt. „Nur für eine Weile. Damit er die Ruhe bekommt, die er so dringend braucht.“
Trotzdem. Als ich Max sah, wie ihn ein Pfleger sanft beim Arm nahm, als ich sah, wie ergeben er sich wegführen ließ...; da wusste ich, dass wir ihn verloren hatten. Selbst wenn er bald wieder nach Hause kommen würde.
„Warum sollten wir unsere Geschichten erzählen“ fragte ich Dorothea. Sie schaute mich mit ihren ruhigen, dunklen Augen an. „Für Max“, antwortete sie. „Und für alle Anderen. Fülle einfach meinen Kopf mit euren Geschichten, und ich sorge dafür, dass sie zu gegebener Zeit weitergeleitet werden.“ Das war nun wieder typisch für Dorothea. Sie sagt manchmal Dinge, die ich einfach nicht verstehe. „Oder schreib‘ deine Geschichte auf.“
Aber für so etwas bin ich nicht gebildet genug. Also lass ich Dorothea schreiben. Sie ist eine nette Frau. Sie hat versucht, Max zu helfen, so gut sie konnte. Und vielleicht wäre es ihr gelungen, ihn wieder gesund zu machen, wenn ich mich nicht quergestellt hätte. Wenn ich ein bisschen mutiger hätte sein können. Ich hätte Herbert, meinen Mann, dazu bringen können, ein klares Machtwort zu sprechen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Genau genommen habe ich mich Vieles nicht getraut im Leben. Es war ja auch nie nötig. Immer hat jemand für mich gesorgt oder mir die Entscheidungen aus der Hand genommen. Es kam mir einfach nie in den Sinn, mal selbst etwas zu entscheiden. Wenn ich andere Frauen sehe, auch solche in meinem Alter, wundere ich mich über deren selbstbewusste Art. Bin ich denn wirklich so anders?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























