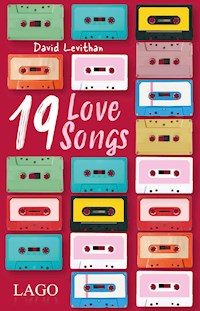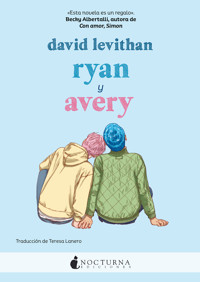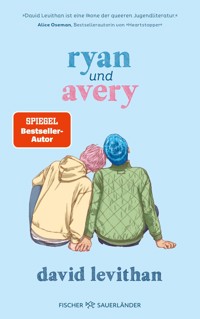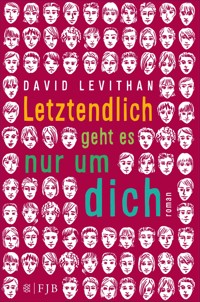
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Letztendlich
- Sprache: Deutsch
Kannst du jemanden lieben, der jeden Tag in einem anderen Körper lebt? ›Letztendlich geht es nur um dich‹ ist die ungewöhnliche und bezaubernde Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers "Letztendlich sind wir dem Universum egal". David Levithan beschreibt auf eine fesselnde Art und Weise die Geschichte von Rhiannon, die das Geheimnis von A und ihre Liebe zu ihm entdeckt. Rhiannon liebt ihren Freund Justin, auch wenn der sie in der Schule eiskalt abblitzen lässt. So ist er halt. Und wenn Rhiannon auf der Rückfahrt von der Schule den Radiosender wechseln will, kommt von Justin "Mein Auto, meine Musik". Lädt Rhiannon ihn zu einer Party ein, beschwert er sich, dass sie ihn immer 'festnageln' will. Eines Tages ist plötzlich alles anders: Justin lässt Rhiannon die Musik aussuchen, er singt aus voller Kehle mit und hört ihr aufmerksam zu. Rhiannon ist überglücklich. Doch dann kommt ein Fremder und behauptet, dass er für einen Tag in Justins Körper gewesen ist… "Wenn Glück sich so gut anfühlt, ist es eigentlich egal, ob es tatsächlich echt ist oder nicht." Die langersehnte Fortsetzung von David Levithans Weltbestseller ›Letztendlich sind wir dem Universum egal‹ erzählt das, was uns alle beschäftigt hat: Wie fühlt es sich an, wenn die Liebe deines Lebens jeden Tag in einem anderen Körper steckt? Ein cooler und romantischer Roman über Geborgenheit, Verlässlichkeit und die wahre Liebe. ›Letztendlich sind wir dem Universum egal‹ ist Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreise 2015, Kategorie Jugendjury.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
David Levithan
Letztendlich geht es nur um dich
Über dieses Buch
Kannst du jemanden wie A lieben, der jeden Tag in einem anderen Körper lebt? ›Letztendlich geht es nur um dich‹ ist die ungewöhnliche und bezaubernde Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers ›Letztendlich sind wir dem Universum egal‹. David Levithan beschreibt auf eine fesselnde Art und Weise die Geschichte von Rhiannon, die das Geheimnis von A und ihre Liebe zu ihm entdeckt.
Rhiannon liebt ihren Freund Justin, auch wenn der sie in der Schule eiskalt abblitzen lässt. So ist er halt. Und wenn Rhiannon auf der Rückfahrt von der Schule den Radiosender wechseln will, kommt von Justin »Mein Auto, meine Musik«. Lädt Rhiannon ihn zu einer Party ein, beschwert er sich, dass sie ihn immer ›festnageln‹ will.
Eines Tages ist plötzlich alles anders: Justin lässt Rhiannon die Musik aussuchen, er singt aus voller Kehle mit und hört ihr aufmerksam zu. Rhiannon ist überglücklich. Doch dann kommt ein Fremder und behauptet, dass er für einen Tag in Justins Körper gewesen ist…
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
David Levithan, geboren 1972, ist Verleger eines der größten Kinder- und Jugendbuchverlage in den USA und Autor vieler erfolgreicher Jugendbücher, unter anderem ›Will & Will‹ (gemeinsam mit John Green) und ›Two Boys Kissing‹. Sein Roman ›Letztendlich sind wir dem Universum egal‹ erhielt den Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 in der Kategorie Jugendjury. Er lebt in Hoboken, New Jersey.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Danksagung
Für meinen Neffen Matthew
(Möge dir jeder Tag Glück bringen)
1.Kapitel
Sein Auto kommt auf dem Parkplatz zum Stehen. Er steigt aus. Ich bin in seinem Blickwinkel, rücke nach und nach ins Zentrum – aber er hält nicht nach mir Ausschau. Er steuert auf die Schule zu und kriegt nicht mit, dass ich praktisch direkt vor ihm stehe. Ich könnte rufen, aber das mag er nicht. Das tun nur Mädels, die es nötig haben, sagt er – ständig nach ihren Freunden rufen.
Es tut weh, dass er mich so sehr erfüllen kann und ich ihn so wenig.
Hält er wegen gestern Abend nicht Ausschau nach mir? Ist unser Streit immer noch aktuell? Wie so oft ging es dabei um was total Blödes, aber worum es eigentlich ging, war absolut nicht blöd. Ich habe ihn nur gefragt, ob er Lust hätte, am Samstag mit auf Steves Party zu gehen. Mehr nicht. Und er hat mich angeblafft, warum ich ihn am Sonntagabend frage, was er den Samstag drauf unternehmen will. Er meinte, ich würde das ständig so machen, ständig versuchen, ihn festzunageln, als würde er nichts mit mir unternehmen wollen, wenn ich es nicht schon monatelang vorher mit ihm ausgemacht hätte. Ich hab zu ihm gesagt, es ist nicht meine Schuld, wenn er immer so einen Schiss davor hat, was zu planen oder sich zu überlegen, was als Nächstes ansteht.
Fehler. Ihm zu unterstellen, er hätte Schiss, war ein schwerer Fehler. Wahrscheinlich hat er nur dieses eine Wort gehört.
»Wovon redest du da überhaupt?«, sagte er.
»Ich rede von einer Party bei Steve, am Samstag«, gab ich zurück, in viel zu aufgebrachtem Ton, für ihn als auch für mich selbst. »Weiter nichts.«
Aber das ist natürlich nicht alles. Justin liebt und hasst mich genauso sehr, wie ich ihn liebe und hasse. Das weiß ich. Wir haben beide unsere wunden Punkte, bei denen wir in die Luft gehen, und wir sollten einfach nicht daran rühren. Aber manchmal können wir nicht anders. Wir kennen einander zu gut – und doch nie gut genug.
Ich bin in jemanden verliebt, der Schiss vor der Zukunft hat. Und blöd wie ich bin, bringe ich es immer wieder zur Sprache.
Ich folge ihm. Natürlich. Nur ein Mädchen, das es nötig hat, wäre sauer auf ihren Freund, bloß weil er sie auf einem Parkplatz nicht bemerkt hat.
Auf dem Weg zu seinem Spind frage ich mich, welchen Justin ich dort wohl vorfinden werde. Vermutlich nicht den süßen Justin, denn der lässt sich eher selten in der Schule blicken. Hoffentlich aber auch nicht den sauren Justin, denn so viel habe ich nun auch wieder nicht falsch gemacht, finde ich. Ich hoffe auf den gechillten Justin, den mag ich. Wenn es der gechillte Justin ist, können wir alle einen Gang runterfahren.
Ich stehe hinter ihm, während er seine Bücher aus dem Spind nimmt, und schaue auf seinen Nacken. Ich bin verliebt in seinen Nacken. Er hat so was … Sinnliches an sich, dass ich mich am liebsten vorbeugen und ihn küssen würde.
Endlich sieht er zu mir hin. Erst werde ich aus seiner Miene nicht schlau. Es kommt mir vor, als würden wir uns wechselseitig abchecken. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, denke ich, vielleicht macht er sich Sorgen um mich. Oder auch ein schlechtes Zeichen, weil er nicht kapiert, wieso ich hier bin.
»Hey«, sagt er.
»Hey«, gebe ich zurück.
Echt heftig, wie er mich ansieht. Bestimmt findet er irgendwas an mir auszusetzen. Er findet immer irgendwas.
Aber es kommt nichts in der Richtung von ihm. Seltsam. Und dann – was noch seltsamer ist – fragt er mich: »Alles okay mit dir?«
Ich muss echt jämmerlich aussehen, wenn er mich so was fragt.
»Klar«, sage ich. Weil ich nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Nein, ist es nicht – das wäre eigentlich die richtige Antwort. Aber nicht für ihn. So viel weiß ich inzwischen. Wenn das nämlich so was wie eine Falle ist – nicht mit mir. Und wenn es eine Retourkutsche für irgendwas ist, das ich gestern Abend gesagt habe, dann bringen wir es lieber schnell hinter uns.
»Bist du sauer auf mich?« Will ich die Antwort darauf wirklich hören?
Aber dann kommt es von ihm: »Nein, ich bin absolut nicht sauer auf dich.«
Lügner.
Wenn es bei uns Probleme gibt, bin normalerweise ich diejenige, die sie sieht. Ich mache mir Gedanken für uns beide. Bloß kann ich ihm das nicht allzu oft sagen, weil das ja quasi hieße, ich würde mir was drauf einbilden, dass ich den Durchblick habe und er nicht.
Ungewissheit. Soll ich wegen gestern Abend noch mal nachfragen? Oder so tun, als wäre es nie passiert – als würde so was nie passieren?
»Willst du dich immer noch heute mit mir zum Mittagessen treffen?« Erst nachdem die Frage raus ist, wird mir klar, dass ich schon wieder versuche, Pläne zu schmieden.
Vielleicht bin ich ja doch eins von den Mädels, die es nötig haben.
»Auf jeden Fall«, sagt Justin. »Das wäre super.«
Was ist das denn für ein Scheiß. Er spielt mit mir. Hundert pro.
»Können wir schon machen«, schiebt er nach.
Ich sehe ihm in die Augen, und er scheint es ernst zu meinen. Vielleicht sollte ich nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Und vielleicht kommt er sich auch einfach dämlich vor, weil ich so baff bin.
Ich nehme seine Hand. Wenn er das mit gestern Abend gut sein lassen kann, kann ich es auch. So läuft es zwischen uns. Wenn die blöden Streitereien vorbei sind, geht es uns wieder gut.
»Schön, dass du nicht sauer auf mich bist«, sage ich. »Ich will bloß, dass alles okay ist.«
Er weiß, dass ich ihn liebe. Ich weiß, dass er mich liebt. Das steht nie in Frage. Die Frage ist immer, wie wir damit umgehen.
Es wird Zeit. Die Glocke läutet. Ich muss mir ins Gedächtnis rufen, dass die Schule nicht allein dazu da ist, uns Gelegenheiten zum Zusammensein zu geben.
»Bis später«, sagt er.
Daran halte ich mich fest. Es ist das Einzige, das mir durch die Leere hilft, die ab jetzt herrscht.
In einer der Serien, die ich immer gucke, sagte eine Hausfrau mal: »Er ist ein Loser, aber er ist mein Loser«, und ich dachte: O Mist, eigentlich sollte ich das nicht nachvollziehen können, tue ich aber – na und? So ist es wohl mit der Liebe – du siehst, was für ein Chaot er ist, und liebst ihn trotzdem, weil du weißt, dass du auch ein Chaot bist, vielleicht sogar ein noch schlimmerer.
Unser erstes Date war noch keine Stunde alt, da ließ Justin schon die Alarmglocken schrillen.
»Ich warne dich – mit mir hat man nur Ärger«, sagte er beim Abendessen im TGI Fridays. »Ärger bis zum Abwinken.«
»Und diese Warnung bekommen auch alle anderen Mädels?«, gab ich neckisch zurück, ich war im Flirtmodus.
Aber was daraufhin von ihm kam, war keine Flirterei.
»Nein«, sagte er. »Bekommen sie nicht.«
So ließ er mich wissen, dass ich ihm nicht egal war. Obwohl wir noch ganz am Anfang standen.
Eigentlich wollte er es mir nicht sagen. Aber nun war es in der Welt.
Und auch wenn er sich im Einzelnen nicht mehr erinnert, wie unser erstes Date abgelaufen ist, weiß er doch noch, was er da gesagt hat.
»Ich hab dich gewarnt!«, brüllt er mich an den Abenden an, wenn es echt übel wird und kaum noch zu ertragen ist. »Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe!«
Manchmal klammere ich mich dann nur umso fester an ihn.
Und manchmal habe ich schon losgelassen und fühle mich grauenvoll, weil ich nichts tun kann.
Morgens kreuzen sich unsere Wege nur zwischen der ersten und zweiten Stunde, und da halte ich Ausschau nach ihm. Uns bleibt maximal eine Minute, aber nach der sehne ich mich. Als würde ich ihm meine Aufwartung machen, um ihn herum scharwenzeln. Liebe gefällig? Hier! Auch wenn wir da noch müde sind (was praktisch immer der Fall ist) und uns kaum was zu sagen haben, geht er nicht einfach an mir vorbei, so viel steht fest.
Heute lächle ich, weil bisher alles ziemlich okay gelaufen ist. Er erwidert mein Lächeln.
Gutes Zeichen. Ich halte immer Ausschau nach guten Zeichen.
Nach der vierten Stunde marschiere ich zu Justins Kursraum, aber offenbar hat er nicht auf mich gewartet. Also gehe ich in die Cafeteria zu unserem Tisch. Da ist er auch nicht. Rebecca hat ihn noch nicht gesichtet und wirkt nicht allzu überrascht, dass ich nach ihm suche. Dazu gebe ich keinen Kommentar ab. Ich sehe bei meinem Spind nach – Fehlanzeige. Vielleicht hat er es ja vergessen oder mich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Sicherheitshalber schaue ich noch bei seinem Spind vorbei, obwohl der ewig weit von der Cafeteria entfernt ist. Da geht er vor der Mittagspause eigentlich nie hin. Heute aber wohl doch, denn da ist er.
Es freut mich, ihn zu sehen, zugleich bin ich fix und alle, weil es so mühsam mit ihm ist. Er sieht schlimmer aus, als ich mich fühle – guckt in seinen Spind, als hätte der ein Fenster. Bei anderen würde man in so einem Fall vermuten, dass sie Tagträumer sind. Aber Justin ist kein Tagträumer. Wenn er ins Leere schaut, ist auch Leere in seinem Kopf.
Jetzt kommt er wieder zu sich. Genau in dem Moment, als ich auf ihn zutrete.
»Hey«, sagt er.
»Hey«, gebe ich zurück.
Ich könnte schon was zu essen vertragen, aber es ist nicht dringend. Wirklich wichtig ist nur, dass wir beide zusammen sind. Von mir aus kann das auch sonst wo sein.
Er verstaut sämtliche Bücher in seinem Spind, als wäre er mit dem Tag schon durch. Hoffentlich ist bei ihm nichts schiefgelaufen. Hoffentlich schmeißt er nicht wegen irgendwas das Handtuch. Wenn ich hier festsitze, dann soll er gefälligst auch hier festsitzen.
Er richtet sich auf und legt die Hand auf meinen Arm. Sanft. Viel zu sanft. So was kommt normalerweise von mir, nicht von ihm. Es gefällt mir, und dann auch wieder nicht.
»Fahren wir irgendwohin«, sagt er. »Wo willst du hin?«
Wieder denke ich, dass es die eine richtige Antwort auf diese Frage geben muss und ich alles kaputt mache, wenn ich die verkehrte erwische. Er will irgendwas von mir, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist.
»Ich weiß nicht«, sage ich.
Er lässt von meinem Arm ab, und ich denke, okay, falsche Antwort. Aber dann nimmt er meine Hand.
»Komm«, sagt er.
Sein Blick ist wie elektrisiert. Voller Power. Voller Licht.
Er sperrt den Spind ab und zieht mich mit sich. Ich blicke nicht durch. Wir gehen Hand in Hand durch die fast leeren Flure. Das tun wir sonst nie. Er fängt an zu grinsen, und wir gehen schneller. Wie kleine Kinder in der großen Pause. Laufen, ja rennen durch die Flure. Die anderen sehen uns an, als wären wir nicht ganz dicht. Es ist total lächerlich. Er flitzt mit mir zu meinem Spind und sagt, ich solle meine Bücher auch dalassen. Ich blicke immer noch nicht durch, mache aber mit – er ist in Superstimmung, und die will ich nicht ruinieren.
Als ich den Spind abgeschlossen habe, gehen wir weiter, zur Tür hinaus. Einfach so. Ziehen Leine. Wir reden ständig davon, abzuhauen, und jetzt machen wir es. Wahrscheinlich geht er mit mir Pizza essen oder so was in der Art. Wird wahrscheinlich ein bisschen spät werden für die fünfte Stunde. Wir gehen zu seinem Wagen, und ich will ihn gar nicht fragen, was er vorhat. Will ihn einfach machen lassen.
Er dreht sich zu mir und fragt: »Wo willst du hin? Sag ganz ehrlich, wo du gerne hinfahren würdest.«
Komisch. Das hört sich an, als wäre ich diejenige, die die richtige Antwort weiß.
Ich hoffe bloß, dass das kein Trick ist und ich es später nicht bereue.
Ich sage das Erste, was mir in den Sinn kommt.
»Ich will ans Meer. Fahr mit mir ans Meer.«
Als Nächstes wird er loswiehern und erklären, was er mit seiner Frage eigentlich gemeint hat: dass wir zu ihm nach Hause fahren sollen, wo keiner ist, und den Nachmittag mit Sex und Fernsehen rumbringen. Oder dass er Beweise sehen will von wegen keine Pläne machen und dass ich Spontanaktionen lieber mag. Oder er wünscht mir viel Spaß am Strand und geht Mittag essen. Alles durchaus realistische Möglichkeiten, und sie schwirren mir alle gleichzeitig durch den Kopf.
Das Einzige, was ich nicht erwartet hätte: dass er die Idee gut findet.
»Okay«, sagt er und fährt los. Ich denke immer noch, dass er nur Witze macht, aber dann fragt er mich, wie man da am besten hinkommt. Ich erkläre ihm die Route zu dem Strand, wo ich im Sommer früher oft mit meiner Familie gewesen bin. Wenn wir schon ans Meer fahren, kann es genauso gut dieser Strand sein.
Er sitzt hinterm Lenkrad und wirkt vergnügt. Das sollte mich eigentlich entspannen, aber es macht mich nervös. Es sähe Justin ähnlich, mich an irgendeinen sehr speziellen Ort zu bringen und mich da abzuladen. Ein Riesentheater darum zu veranstalten. Mich vielleicht sogar auszusetzen. Das halte ich zwar dann doch für eher unwahrscheinlich, aber denkbar wäre es. Um mir irgendwie zu beweisen, dass er sehr wohl im Voraus planen kann. Um mir zu zeigen, dass er nicht so viel Schiss vor der Zukunft hat, wie ich behauptet habe.
Du spinnst, Rhiannon, denke ich. Das sagt er ständig zu mir. Und meistens hat er recht.
Genieß es einfach, denke ich. Wir sind raus aus der Schule. Wir sind zusammen.
Er macht das Radio an und sagt, ich soll einen guten Sender suchen. Wie bitte? »Mein Auto, mein Radio« – wie oft habe ich das schon von ihm gehört? Aber er scheint es ernst zu meinen, also gehe ich die Sender durch und hoffe, irgendwas zu finden, worauf er steht. Wenn ich ein bisschen länger bei einem Song hängenbleibe, der mir gefällt, fragt er: »Warum nicht den?« Und ich denke: weil du den nicht ausstehen kannst. Aber das behalte ich für mich. Ich lasse den Song weiterspielen und warte darauf, dass Justin seine üblichen Witze reißt und sagt, die Sängerin höre sich an, als hätte sie ihre Tage.
Stattdessen singt er auf einmal mit.
Ich fasse es nicht. Justin singt nie mit. Er brüllt das Radio an, er gibt zu allem, was die Leute im Radio reden, Kommentare ab. Hin und wieder trommelt er im Takt aufs Lenkrad. Aber er singt definitiv nicht mit.
Ob er irgendwelche Drogen intus hat? Aber ich habe ihn schon erlebt, wenn er was genommen hatte, und da war er nie so.
»Was ist denn auf einmal in dich gefahren?«, frage ich.
»Musik«, sagt er.
»Ha.«
»Nein, echt.«
Er macht keine Witze. Er lacht mich nicht heimlich aus. So viel kann ich sehen. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber das steckt jedenfalls nicht dahinter.
Mal sehen, wie weit ich gehen kann.
»Wenn das so ist …«, sage ich und suche in den Sendern nach dem ultimativen Anti-Justin-Song.
Da. Kelly Clarkson. Mit diesem Lied von wegen, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter.
Ich drehe es lauter. Fordere ihn stumm heraus mitzusingen.
Überraschung.
Wir grölen beide los. Keine Ahnung, woher er den Text kennt. Aber ich stelle keine Fragen. Ich singe aus voller Kehle und hätte nie gedacht, dass ich den Song mal so toll finden würde wie eben jetzt, weil durch ihn alles okay wird – alles okay zwischen uns. Ich will an nichts anderes denken. Es gibt nur noch uns und das Lied – das haben wir noch nie gemacht, und es ist ein Supergefühl.
Als der Song aus ist, lasse ich das Beifahrerfenster herunter – ich will den Wind in meinen Haaren spüren. Wortlos lässt Justin auch die übrigen Fenster herunter, und es ist, als wären wir in einem Windkanal oder in einem Vergnügungspark und sausten in einem Fahrgeschäft dahin, dabei ist es doch nur eine Spritztour auf dem Highway. Er sieht so glücklich aus. Mir fällt auf, wie selten ich ihn so erlebe, so richtig durch und durch glücklich. Normalerweise hat er Angst davor, Glück zu zeigen – als könnte es ihm jeden Moment genommen werden.
Er nimmt meine Hand und fängt an, mir Fragen zu stellen. Persönliche Fragen.
Die erste lautet: »Wie geht’s eigentlich deinen Eltern so?«
»Äh … keine Ahnung«, sage ich. Seit wann interessiert er sich für meine Eltern? Er möchte, dass sie ihn mögen, das weiß ich, aber weil er sich nicht sicher ist, ob das der Fall ist, tut er so, als wäre es ihm egal. »Ach, du weißt schon. Mom versucht alles zusammenzuhalten, macht aber eigentlich nichts. Dad hat seine lichten Momente, aber er kann eine ziemliche Spaßbremse sein. Ich hab das Gefühl, je älter er wird, desto mehr ist ihm alles schnurzegal.«
»Und wie ist es jetzt bei euch zu Hause, seit Liza aufs College geht?«
Er hört sich an, als wäre er stolz darauf, dass er den Namen meiner Schwester weiß. Das klingt schon eher nach Justin.
»Ich weiß nicht«, sage ich. »Wir waren ja eher so was wie zwei Schwestern im Waffenstillstand, keine dicken Freundinnen. Ich glaub, sie fehlt mir gar nicht so sehr, auch wenn es sich mit ihr zu Hause irgendwie leichter anfühlte, weil wir dann eben zu zweit waren. Sie ruft nie an. Sie ruft nicht mal zurück, wenn Mom es bei ihr probiert. Aber das finde ich nicht schlimm, sie hat bestimmt Besseres zu tun. Und ich hab immer gewusst: Wenn sie mal geht, dann ist sie komplett weg. Deswegen ist das irgendwie kein Schock für mich oder so.«
Beim Reden merke ich, dass ich mich einem kritischen Punkt nähere – der Frage, wie es nach der Highschool weitergeht. Aber Justin scheint es nicht persönlich zu nehmen. Er fragt mich, ob ich die Schule in diesem Jahr sehr anders finde als im letzten. Komische Frage. So was will eher meine Großmutter wissen, aber doch nicht mein Freund.
Ich gehe es vorsichtig an.
»Keine Ahnung. Schule ist scheiße, so wie immer. Aber, weißt du – einerseits will ich es wirklich hinter mir haben, andererseits mache ich mir auch Sorgen über das, was danach kommt. Nicht dass ich schon alles durchgeplant hätte – habe ich nicht. Ich weiß schon, du denkst immer, ich hätte tausend Pläne, aber wenn du dir mal genau ansiehst, wie ich mich bisher auf das Leben nach der Highschool vorbereitet habe, dann ist da nur ein großer weißer Fleck. Wie bei allen anderen auch.«
Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, denke ich. Warum musst du davon anfangen?
Aber vielleicht gibt es ja einen Grund. Vielleicht habe ich davon angefangen, um zu sehen, wie er reagiert. Er macht das dauernd mit mir, aber in der Hinsicht bin ich auch kein Unschuldslamm.
»Wie siehst du das denn?«, frage ich.
Er sagt: »Ganz ehrlich, ich versuche bloß, von einem Tag zum nächsten zu leben.«
Das weiß ich. Aber es gefällt mir besser, wenn es so herauskommt, in einem Tonfall, der spüren lässt, dass wir auf derselben Seite sind. Ich warte, ob noch mehr von ihm kommt, ob er den Streit von gestern Abend noch mal aufwärmt. Aber er lässt es bleiben. Dafür bin ich ihm dankbar.
Wir sind jetzt mehr als ein Jahr zusammen, und in der Zeit habe ich mir mindestens hundertmal gesagt, das ist es jetzt – das ist der Neuanfang. Manchmal lag ich richtig. Aber nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ich will mich nicht der Vorstellung hingeben, dass zwischen uns auf einen Schlag alles besser geworden ist. Dass wir uns selbst irgendwie ausgebüxt sind und nicht mehr in den üblichen Rollen enden. Gleichzeitig will ich auch nicht die Augen vor dem verschließen, was hier abläuft. Vor diesem Glück. Denn wenn Glück sich so gut anfühlt, ist es eigentlich egal, ob es tatsächlich echt ist oder nicht.
Statt das Reiseziel in sein Handy einzugeben, bittet er mich, ihn weiter zu lotsen. Ich baue Mist und dirigiere ihn eine Ausfahrt zu früh vom Highway runter, aber als ich es merke, flippt er kein bisschen aus – er fährt einfach wieder drauf und nimmt die nächste Ausfahrt. Mittlerweile frage ich mich nicht mehr, ob er auf Drogen ist, sondern ob ihm vielleicht ein Arzt was verschrieben hat. Falls ja, wirkt es phänomenal.
»Ich sollte jetzt in Englisch sein«, sage ich bei der letzten Abzweigung vor dem Strand. Mehr sage ich nicht. Ich will es nicht vermasseln.
»Und ich in Bio.«
Aber das hier ist wichtiger. Meine Hausaufgaben kann ich nachholen, mein Leben nicht.
»Lassen wir’s uns einfach gutgehen«, sagt er.
»Okay«, gebe ich zurück. »Von mir aus gerne. Ich denke so oft ans Ausbrechen – da ist es echt schön, es tatsächlich mal zu tun. Für einen Tag. Statt ewig aus dem Fenster zu starren, tut es gut, mal auf der anderen Seite vom Fenster zu sein. Das sollte ich öfter machen.«
Vielleicht haben wir das die ganze Zeit gebraucht. Abstand von allem anderen und Nähe zueinander.
Irgendetwas ist hier im Gang – ich spüre es ganz deutlich.
Erinnerung. An diesen Strand bin ich oft mit meiner Familie gefahren, wenn es bei uns zu Hause zu heiß war oder meine Eltern dringend einen Tapetenwechsel brauchten. Hier waren wir dann umlagert von anderen Familien. Ich habe mir immer gern vorgestellt, jedes Handtuch wäre ein Haus, und eine gewisse Anzahl von Handtüchern ergäbe einen Ort. Bestimmt habe ich manche Kinder öfter gesehen, weil ihre Eltern mit ihnen auch immer dorthin fuhren, aber ich kann mich an keins mehr erinnern. Nur noch an meine eigene Familie – meine Mutter stets unter einem Schirm, weil sie keinen Sonnenbrand kriegen oder nicht gesehen werden wollte, meine Schwester pausenlos mit der Nase in einem Buch und nicht ansprechbar, mein Vater im Gespräch mit anderen Vätern, über Sport oder Aktien. Wenn es zu heiß wurde, jagte er mich ins Wasser und fragte, was für ein Fisch ich gern wäre. Ich wusste, dass die richtige Antwort fliegender Fisch lautete, denn dann hob er mich hoch und warf mich durch die Luft.
Wieso bin ich eigentlich noch nie mit Justin hier gewesen? Letzten Sommer sind wir weitgehend drinnen geblieben, haben Tag für Tag gewartet, bis seine Eltern zur Arbeit fuhren, und uns dann die Zeit mit Sex vertrieben, in jedem einzelnen Raum des Hauses und in ein paar von den begehbaren Schränken. Wenn das geschafft war, sahen wir fern oder spielten Videospiele. Manchmal machten wir einen Rundruf, um rauszufinden, was die restlichen Freunde so trieben, und wenn seine Eltern nach Hause kamen, waren wir bei irgendwem anders, tranken was oder sahen fern oder spielten Videospiele oder irgendeine Mischung aus den drei Sachen. Es war toll, keine Schule zu haben und zusammen zu sein. Aber es brachte uns irgendwie nicht weiter.
Ich lasse meine Schuhe im Wagen, so wie damals als Kind. Die ersten Schritte über den asphaltierten Parkplatz sind unangenehm, aber dann kommt der Sand, und alles ist gut. Heute ist keine Menschenseele am Strand; obwohl ich keine Horden erwartet hatte, ist das doch überraschend – als hätten wir den Strand bei einem Nickerchen ertappt.
Ich kann nicht anders, ich muss einfach losrennen und mich im Kreis drehen. Alles meins, denke ich. Der Strand. Die Zeit. Justin. Nichts und niemand wird sich dazwischenschieben. Ich rufe nach ihm, und es ist, als würde ich immer noch bei einem Song mitsingen.
Er sieht zu mir her, und ich denke: O nein, gleich sagt er, dass ich wie ein Vollidiot aussehe. Aber dann läuft er auf mich zu, packt mich und schwingt mich im Kreis. Er hat den Song gehört, und jetzt tanzen wir. Wir lachen und jagen einander zum Wasser, spritzen uns gegenseitig nass, spüren den Sog an den Beinen. Ich klaube ein paar Muscheln auf, und Justin macht mit, sucht nach Farben, die getrocknet anders aussehen werden, nach Meerglas und spiraligen Schneckenhäusern. Es ist so toll, das Wasser zu spüren und still zu stehen – weil ein ganzer Ozean an mir zerrt und ich die Kraft habe zu bleiben, wo ich bin.
Justins Gesicht ist wie ein offenes Buch. Er ist bis in die letzte Faser entspannt. So erlebe ich ihn sonst nie. Wir spielen miteinander, aber es ist nicht das Freund-Freundin-Spiel mit Strategien, Punktevergleich und geheimen Schachzügen. Nein, aus all dem haben wir uns wie mit einer Schere herausgeschnitten.
Ich frage ihn, ob er eine Sandburg mit mir baut, und erzähle ihm, dass Liza immer ihre eigene haben musste, direkt neben meiner. Ihre war jedes Mal ein Riesenhügel mit einem tiefen Graben drum herum, meine ein kleines Haus mit einer Eingangstür, einer Garage und vielen weiteren Einzelheiten. Letztlich baute ich im Sand einfach das Puppenhaus, das ich nie bekommen habe, und Liza die Festung, die sie vom Gefühl her brauchte. Sie rührte meine Burgen nie an – sie war nicht der Typ ältere Schwester, die die Konkurrenz zerstören musste. Aber ich durfte ihre auch nicht anfassen. Wenn wir mit ihnen fertig waren, überließen wir sie der nächsten Flut. Manchmal kamen meine Eltern dazu. Bei mir hieß es: »Ist das aber hübsch!«, und bei Liza: »Ist das aber groß!«
Justin soll mit mir eine Sandburg bauen. Ich will erleben, wie es ist, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Schaufeln und Eimer gibt es nicht, nur unsere Hände. Er nimmt den Ausdruck Sandburg wörtlich – legt ein viereckiges Fundament an und lässt mit feinen Fingern eine Zugbrücke entstehen. Ich mache mich an Türme und Türmchen – Balkone sind heikel, aber Spitzdächer bekomme ich hin. Gelegentlich macht er mir ein Kompliment – einzelne Wörtchen wie »schön« und »hübsch« und »toll« –, und es kommt mir vor, als ob der Strand diese Wörter irgendwie aus dem Kerker freisetzt, in dem Justin sie all die Monate gehalten hat. Ich habe immer geahnt – vielleicht auch gehofft –, dass die Wörter irgendwo da in ihm drin waren. Und jetzt weiß ich, dass sie es sind.
Es ist nicht besonders warm, aber ich spüre die Sonne auf Wangen und Hals. Wir könnten noch mehr Muscheln sammeln und mit dem Verzieren anfangen, doch allmählich bin ich es leid, dass das Bauen uns so in Beschlag nimmt. Als der letzte Turm fertig ist, schlage ich einen kleinen Spaziergang vor.
»Bist du zufrieden mit unserem Werk?«, fragt er.
»Ja, sehr.«
Wir gehen zum Wasser, um uns den Sand von den Händen zu spülen. Justin blickt zurück zum Strand, zu unserer Burg, und wirkt kurz ein bisschen verloren. Ja, verloren, aber an einem guten Ort.
»Was ist?«, frage ich.
Er sieht mich an, mit einem ganz sanftem Blick, und sagt: »Danke.«
Das hat er sicher schon das eine oder andere Mal gesagt, aber noch nie so – so, dass ich es gern im Gedächtnis behalten würde.
»Wofür?«, frage ich. Und meine eigentlich: Wieso gerade jetzt? Wieso jetzt endlich?
»Für das hier«, sagt er. »Für das alles.«
Ich möchte so gern daran glauben. Möchte so gern denken, dass wir endlich da sind, wo ich uns in meinem Innern immer schon gesehen habe. Aber es läuft zu einfach. Fühlt sich zu einfach an.
»Es ist okay«, sagt er. »Es ist okay, glücklich zu sein.«
Wie lange wünsche ich mir das schon. Es ist zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ist ja immer so. Es überwältigt mich, wie sehr ich ihn liebe. Ich spüre kein bisschen Hass auf ihn. Nur Liebe. Und es macht mir keine Angst. Im Gegenteil.
Ich weine, weil ich glücklich bin und mir wohl jetzt erst klarwird, dass ich immer nur erwartet habe, unglücklich zu sein. Ich weine, weil zum ersten Mal seit langer Zeit das Leben wieder einen Sinn ergibt.
Er sieht meine Tränen und macht sich nicht darüber lustig. Er wird nicht aggressiv und fragt, was er jetzt schon wieder falsch gemacht hat. Er sagt nicht, er hätte mich gewarnt. Er sagt nicht, dass ich aufhören soll zu heulen. Nein, er nimmt mich in die Arme und hält mich umschlungen und macht aus dem, was doch nur Worte sind, mehr als nur Worte. Trost. Er gibt mir etwas, das ich wahrhaftig spüren kann – seine Gegenwart, seinen Halt.
»Ich bin glücklich«, sage ich. Er soll nicht denken, dass ich noch aus einem anderen Grund weine. »Bin ich wirklich.«
Der Wind, der Strand, die Sonne – alles hüllt uns ein, doch es zählt nur unsere Umarmung. Ich halte ihn ebenso wie er mich. Wir sind ganz und gar im Gleichgewicht, beide stark, beide schwach, ein Geben und Nehmen.
»Was ist das hier?«, frage ich.
»Schsch«, sagt er. »Keine Fragen stellen.«
Ich spüre keine Fragen in mir – nur Antworten. Keine Furcht, nur Fülle. Ich küsse ihn und lasse unser vollkommenes Gleichgewicht auch dort herrschen, unseren Atem zu einem verschmelzen. Ich schließe die Augen. Da ist der vertraute Druck seiner Lippen, der vertraute Geschmack seines Mundes. Aber etwas ist nun anders. Dieser Kuss geht über unsere Körper hinaus, wird zu etwas Größerem, zu dem, wer wir sind und wer wir sein werden. Er kommt aus der Tiefe, und wir finden einen tieferen Teil unserer selbst. Wie ein Stromschlag, der auf Wasser trifft, wie eine Flamme, die Papier in Brand setzt, wie grell gleißendes Licht, das in unsere Augen fällt. Ich streiche über seinen Rücken und seine Brust, als müsste ich mich vergewissern, ob er auch wirklich da ist, ob das hier wirklich gerade geschieht. Meine Hand ruht auf seinem Nacken, seine auf meiner Hüfte. Meine Hand gleitet unter seinen Gürtel, doch er schiebt sie sanft wieder nach oben, küsst mich auf den Hals. Ich küsse ihn hinterm Ohr. Küsse sein Lächeln. Er zeichnet mein Lachen nach.
Genuss. Wir genießen es.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, welcher Tag heute ist. Ich habe nur das Jetzt, das Hier. Und das ist mehr als genug.
Nach einer Weile streiche ich ihm über den Arm und greife nach seiner Hand. Ein paar Sekunden, vielleicht auch ein paar Minuten stehen wir so da, Hand in Hand, Lippen auf Lippen, sacht, ohne das leiseste Drängen, weil wir uns ganz und gar gefunden haben.
Dann lösen wir uns voneinander, bleiben nur noch durch die Hände verbunden. Machen uns auf zu einem Strandspaziergang, wie Pärchen das so tun. Die Zeit schaltet sich wieder ein, aber ohne Schrecken.
»Ist das schön!«, sage ich. Und zucke unwillkürlich zusammen, weil Justin so eine Äußerung normalerweise mit »Da wäre ich von allein nie draufgekommen« abtut. Doch heute, an diesem Tag und an diesem Ort, ist es nur natürlich, dass er einfach nickt. Er sieht zur Sonne, die sich allmählich dem Horizont nähert. Weiter draußen auf dem Meer entdecke ich etwas, das ein Boot sein könnte, vielleicht aber auch nur Treibholz oder eine Luftspiegelung.
Jeder Tag soll so sein wie dieser. Wieso kann es nicht so sein?
»Das sollten wir jeden Montag machen«, sage ich. »Und jeden Dienstag. Und jeden Mittwoch. Und jeden Donnerstag. Und jeden Freitag.«
Scherz. Und auch wieder nicht.
»Dann wäre es nichts Besonderes mehr. So was macht man am besten nur einmal.«
Nur einmal? Was meint er damit? Wie kann er so was sagen?
»Nie wieder?«, frage ich, um sicherzugehen. Hier will ich ganz, ganz sicher sein.
Er lächelt. »Tja, man soll niemals nie sagen.«
»Ich würde niemals nie sagen«, gelobe ich.
Gesellschaft. Jetzt sind auch noch andere Paare am Strand. Nicht allzu viele, und alle älter als wir. Niemand fragt, warum wir nicht in der Schule sind. Alle scheinen sich über unseren Anblick zu freuen. Es gibt mir das Gefühl, dass wir hierhergehören, dass es richtig ist, was wir tun.
So wird es von jetzt an sein, denke ich. Und dann schaue ich zu Justin und denke: Sag, dass es von jetzt an so sein wird.
Ich will ihn nicht danach fragen. Ich will nicht danach fragen müssen. Zu oft sind meine Fragen schuld daran, dass die Dinge aus dem Ruder laufen.
Das hier soll nicht zu Bruch gehen, und ich gehe es ganz, ganz vorsichtig an.
Allmählich wird mir ein bisschen kühl. Stimmt schon, der Sommer ist längst vorbei. Als ich anfange zu zittern, legt Justin den Arm um mich. Ich schlage vor, zurück zum Wagen zu gehen und die Knutschdecke zu holen, die immer im Kofferraum liegt. Auf dem Weg kommen wir an unserer Sandburg vorbei, sie ist noch da, doch die Wellen rücken näher.
Wir gehen mit der Decke zurück zum Strand, wickeln sie uns aber nicht um die Schultern, sondern legen sie in den Sand und uns darauf, eng aneinandergeschmiegt. Wir schauen zum Himmel empor. Wolken treiben vorbei. Hier und da lässt sich ein Vogel blicken.
»Das ist unter Garantie einer der besten Tage überhaupt«, sage ich.
Ohne den Blick vom Himmel zu wenden, greift er nach meiner Hand.
»Erzähl mir was von anderen solchen Tagen«, sagt er.
»Ich weiß nicht …« Ich kann mir keinen Tag vorstellen, der so wäre wie dieser.
»Bloß einer. Der erste, der dir in den Sinn kommt.«
Ich denke an Zeiten, in denen ich glücklich war. So richtig glücklich. Schwebeballonglücklich. Und da kommt mir eine ganz verrückte Erinnerung. Keine Ahnung, wieso. Ich sage, dass sie bestimmt total dämlich klingt. Er will sie trotzdem unbedingt hören.
Ich drehe mich zu ihm hin, und er nimmt meine Hand, lässt sie auf seiner Brust Kreise malen.
Hier droht keine Gefahr.
Ich sage: »Keine Ahnung wieso, aber das Erste, was mir in den Sinn kam, war diese Modenschau für Mutter und Tochter.«
Er muss mir versprechen, nicht zu lachen. Das tut er.
»Da war ich in der vierten Klasse oder so«, sage ich. »Dieser Klamottenladen, Renwick’s, hat eine Spendenaktion für Opfer von einem Wirbelsturm veranstaltet und Freiwillige aus unserer Klasse gesucht. Ich hab meine Mutter gar nicht erst gefragt, sondern mich einfach eingetragen. Und als ich mit der Info nach Hause kam – na, du kennst ja meine Mom. Sie hat Zustände gekriegt. Sie schafft es ja kaum noch, in den Supermarkt zu gehen. Und dann eine Modenschau? Vor wildfremden Leuten? Genauso gut hätte ich sie bitten können, für den Playboy Modell zu stehen. O Gott, was für eine Horrorvorstellung.«
Es gibt Mütter, die haben in ihrer Jugend ständig Party gemacht, gelacht und gekichert, geflirtet und superenge Klamotten getragen. Meine Mom ist nicht von der Sorte. Ich schätze, sie war schon immer so, wie sie jetzt ist. Bis auf dieses eine Mal.
»Aber das Komische war: Sie hat nicht nein gesagt. Eigentlich wird mir erst jetzt so richtig klar, was ich ihr da zugemutet habe. Sie hat mich nicht gezwungen, zu der Lehrerin zu gehen und es rückgängig zu machen. Als es so weit war, sind wir zu Renwick’s gefahren und haben uns erklären lassen, wo wir genau hinsollten. Ich hatte gedacht, sie würden uns einen Partnerlook verpassen, aber so war es nicht. Sie meinten, wir hätten die freie Auswahl. Also sind wir kreuz und quer durch den Laden und haben alles Mögliche anprobiert. Ich bin natürlich auf die Abendkleider los. Und bin bei einem hellblauen Kleid gelandet, mit jeder Menge Rüschen. Ich fand es irrsinnig elegant.«
»War bestimmt todschick«, sagt Justin.
Ich haue ihn zum Spaß. »Halt den Mund. Lass mich meine Geschichte weitererzählen.«
Er lässt meine Hand auf seiner Brust ruhen, küsst mich, bevor ich weiterreden kann, und sagt: »Nur zu.«
Ich habe kurz den Faden verloren, weil Justin mich aus der Geschichte rausgezogen hat, hinein ins Hier und Jetzt. Dann weiß ich es wieder: Meine Mom. Die Modenschau.
»Okay, also ich hatte damit schon mal sozusagen mein Abschlussballkleid in klein. Und dann war Mom an der Reihe. Komischerweise ist sie auch zu den Abendkleidern hin. Bis dahin hatte ich sie noch nie so richtig edel angezogen gesehen. Und das hat mich wohl am meisten umgehauen: Nicht ich war Aschenputtel, sondern sie.
Als wir die Kleider ausgesucht hatten, haben sie uns geschminkt und so. Ich dachte, Mom rastet aus, aber sie hatte richtig Spaß dabei. Sie haben gar nicht viel mit ihr gemacht – nur ein bisschen mehr Farbe. Und das reichte auch vollkommen. Sie war echt hübsch. Kaum zu glauben, aber an dem Tag hat sie ausgesehen wie ein Filmstar. Die anderen Mütter haben ihr alle Komplimente gemacht. Und als dann die Show losging, sind wir rausmarschiert, und die Leute haben geklatscht. Mom und ich haben beide gelächelt, und zwar ganz echt, verstehst du?«
So echt wie das hier – Justin als Zuhörer neben mir, der Himmel über uns, der Sand unter uns. Es ist so durch und durch wirklich und echt, dass es zugleich auch unwirklich erscheint. Ich hatte keine Ahnung, dass man so viel auf einmal empfinden kann.
»Wir durften die Kleider zwar nicht behalten, aber ich weiß noch, dass Mom auf der Rückfahrt immer wieder gesagt hat, wie toll sie mich fände. Zu Hause hat Dad uns angeschaut, als wären wir Aliens, aber das Coole war, er hat keine blöden Bemerkungen gemacht, sondern mitgespielt. Wir wären seine Supermodels, hat er gesagt, und ob wir die Modenschau nicht noch mal machen könnten, nur für ihn in unserem Wohnzimmer, und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns halbtot gelacht. Und das war’s. Dann war der Tag vorbei. Ich glaube nicht, dass Mom sich seitdem irgendwann noch mal geschminkt hat. Und aus mir ist auch kein Supermodel geworden. Aber der Tag heute erinnert mich an den damals. Weil er so total anders war als jeder sonst.«
»Klingt so«, sagt er. Und wie er mich dabei ansieht –. Es kann nicht an dem liegen, was ich gesagt habe. Das heißt, es muss an mir liegen.
»Ich fasse es nicht, dass ich dir das gerade erzählt habe.« Damit räume ich ihm noch eine Chance ein, es sich anders zu überlegen.
»Wieso?«
»So eben. Keine Ahnung. Es klingt doch total dämlich.«
»Nein, es klingt nach einem guten Tag.«
»Was ist mit dir?«, frage ich. Schon klar, ich will es mal wieder wissen. Zuzuhören ist nicht das Gleiche wie, mir tatsächlich etwas von sich zu erzählen.
»Ich war noch nie bei einer Modenschau für Mutter und Tochter«, sagt er.
Ha, ha. Also nimmt er das Ganze vielleicht doch nicht richtig ernst. Ich haue ihm auf die Schulter und sage: »Nein. Erzähl mir von einem Tag, der auch so besonders für dich war wie der hier.«
Seine Miene wird nachdenklich. Erst vermute ich, dass er mit sich ringt, ob er mir etwas erzählen soll oder nicht. Doch dann merke ich, nein, er sucht nur nach einer guten Antwort.
»Da war ich elf«, fängt er an. »Ich habe mit meinen Freunden Verstecken gespielt. Die brutale Variante, wo man beim Abschlagen richtig fest zuhaut und sich rauft. Wir waren im Wald, und aus irgendeinem Grund kam ich auf die Idee, ich müsste auf einen Baum klettern. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, glaube ich. Aber ich hab einen mit ein paar Ästen weit unten gefunden und bin einfach hoch. Höher und höher. Es war kinderleicht. In meiner Erinnerung war der Baum turmhoch. Wolkenkratzerhoch. Irgendwann bin ich sozusagen über die Baumgrenze drüber. Kletterte immer weiter, aber es waren keine anderen Bäume mehr um mich herum. Ich war ganz allein, klammerte mich an den Baumstamm, ewig weit vom Boden weg.
Es war wie im Märchen. Anders lässt es sich nicht beschreiben. Ich hörte meine Freunde brüllen, wenn sie gefangen wurden, das Spiel lief langsam aus. Aber ich war vollkommen woanders. Ich sah die Welt von oben, und das ist schon was Außergewöhnliches, wenn man es zum ersten Mal erlebt. Ich war bis dahin noch nie geflogen. Ich glaube, ich war sogar noch nie in einem hohen Gebäude gewesen. Und da hockte ich nun, schwebte über allem, was ich kannte. Ich hatte es an einen besonderen Ort geschafft, und zwar ganz allein. Niemand hatte mir dabei geholfen. Niemand hatte mich da raufgeschickt. Ich bin einfach geklettert und geklettert und geklettert, und das war die Belohnung. Die Welt im Blick zu haben und mit mir allein zu sein. Ich merkte, dass das genau das war, was ich brauchte.«
Bei der Vorstellung von ihm da oben kommen mir fast die Tränen. Er erzählt mir zwar dann und wann etwas aus seiner Kindheit, aber nicht so was wie das hier. Normalerweise sind es nur die schlimmen Erlebnisse. Alles, was ihm schwer zugesetzt hat und was er jetzt meistens als Entschuldigung anbringt.
Ich schmiege mich an ihn. »Das ist echt irre.«
»Ja, das war es.«
»Und das war in Minnesota?«
Er soll sehen, dass ich noch weiß, was er mir erzählt hat – die Umzüge mit seiner Familie, wie kalt es dort war –, und dass er mir ohne Bedenken noch mehr erzählen kann.
Ich möchte ihm auch noch mehr erzählen. Das war schon immer so, aber jetzt, da er zuhört – richtig zuhört –, hat das Erzählen eine ganz neue Bedeutung für mich.
»Willst du wissen, welcher Tag noch so war wie der hier?«, frage ich und rücke noch näher an ihn heran, als wollte ich aus uns beiden ein Nest bauen und alle Erinnerungen darin bergen.
Er zieht mich an sich, sichert das Nest. »Klar.«
»Unser zweites Date«, sage ich.
»Echt?« Er wirkt überrascht.
»Weißt du das noch?«
Nein. Aber das ist kein Drama, weil wir nie offiziell Buch geführt haben, was nun ein Date war und was nicht. Schließlich haben wir uns vor unserem ersten Date schon oft in Gesellschaft von anderen gesehen und miteinander geflirtet. Ich meine aber das zweite Mal, bei dem wir zusammen gekommen und gegangen sind und dazwischen fast immer zusammen waren.
»Bei Dacks Party?«, frage ich.
»Jaaa …«
Immer noch verschwommen. »Keine Ahnung – vielleicht zählt es ja auch nicht als Date«, sage ich. »Aber es war das zweite Mal, dass wir rumgemacht haben. Und, keine Ahnung, du warst einfach so … so süß dabei. Werd jetzt nicht sauer, okay?«
Ich will das hier nicht kaputtmachen. Ich fürchte, ich mache es gerade kaputt. Warum kann ich nicht aufhören, wenn gerade alles gut ist?
Aber dann sagt er: »Ich wüsste nicht, was mich hier und jetzt sauer machen sollte, Ehrenwort.« Und legt die Hand aufs Herz. Diese Geste habe ich bei ihm noch nie gesehen.
Lächeln. Ich mache es nicht kaputt. »Okay«, sage ich. »Also, in letzter Zeit – hast du es irgendwie immer eilig. Ich meine, wir schlafen miteinander, aber wir sind uns nicht so richtig … nahe. Und es ist schon okay so. Ich meine, es macht Spaß und alles. Aber hin und wieder ist es auch gut, wenn es so ist wie jetzt. Und bei Dacks Party – da war es so. Als hättest du alle Zeit der Welt für mich. Das war toll. Damals hast du mich noch so richtig angesehen. Es war – als wärst du auf diesen Baum geklettert und hättest ganz oben mich gefunden. Es war ganz allein unser Moment, obwohl wir bei irgendwelchen wildfremden Leuten im Garten waren. Irgendwann – weißt du das noch? – hast du gesagt, ich soll ein Stückchen rücken, weiter ins Mondlicht. ›Das bringt deine Haut zum Leuchten‹, hast du gesagt. Und genau so war es für mich. Als ob ich leuchte. Weil du mich so angeschaut hast, im Mondlicht.«
Noch nie hat er so viel von mir zu hören bekommen. Ich glaube nicht, dass ich in all der Zeit, die wir nun schon zusammen sind, jemals die Worte einfach habe heraussprudeln lassen, ohne sie vorher auf die Waagschale zu legen.
Was ist das hier?, frage ich mich. Denn jetzt beugt er sich zu mir und küsst mich, und das taucht alles in ein romantisches Licht. Justin hat auch schon vorher immer mal wieder romantische Anwandlungen gehabt. Aber noch nie hat er es zustande gebracht, dass alles, das ganze Universum, in Romantik erstrahlt. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich so sehr danach. Ich will seine Lippen auf meinen spüren. Ich will mein Herz genauso und nicht anders pochen fühlen. Ich will dieses Nest aus unseren Körpern. Ich will es, weil es auf so unwirkliche Weise wirklich ist.
Es gäbe für uns beide noch viel anderes zu sagen, aber mir ist nicht danach. Nicht weil ich Angst hätte, etwas kaputtzumachen, sondern weil ich jetzt in diesem Moment alles habe und nichts weiter brauche.
Wir schließen die Augen, ruhen in unseren Armen.
Irgendwie haben wir es an den besseren Ort geschafft, zu dem sich immer alle hin wünschen.
Ich merke nicht einmal, wie meine Lider schwer werden. Uns ist so wohl miteinander, dass wir offenbar einfach weggedöst sind.
Dann schrillt mein Handy los, übertönt das Meer. Ich weiß, wer dran ist, möchte es gern ignorieren, kann es aber nicht. Ich schlage die Augen auf, rücke von Justin ab und greife nach dem Handy.
»Wo bist du?«, fragt Mom.
Ich checke die Uhrzeit. Die Schule ist schon eine ganze Weile aus.
»Ich bin bloß mit Justin unterwegs.«
»Dein Vater kommt heute rechtzeitig, und ich möchte, dass wir alle zusammen zu Abend essen.«
»Ist gut. Das schaffe ich. Bin so ungefähr in einer Stunde da.«
Kaum sind die Worte heraus, beginnt die stehengebliebene Uhr wieder zu ticken. Ich hasse meine Mutter dafür, und mich, weil ich es zulasse.
Justin hat sich aufgesetzt und kapiert offenbar, was Sache ist.
»Ist schon ganz schön spät«, sagt er, hebt die Decke hoch und schüttelt sie aus. Dann falten wir sie zusammen, bewegen uns zueinander, auseinander und wieder näher zueinander, bis die Decke zum Quadrat geworden ist. Normalerweise rollen wir sie einfach zusammen und schmeißen sie wieder in den Kofferraum.
Die Rückfahrt ist irgendwie anders – kein Abenteuer mehr, einfach eine Rückfahrt. Ich erzähle ihm Sachen, von denen er sonst nie was wissen will: anderer Leute Beziehungsdramen; dass Rebecca alles daran setzt, auf ein gutes College zu kommen und uns alle hinter sich zu lassen (was sie definitiv tun sollte); und dass ich auch Druck habe, um gut abzuschneiden oder wenigstens gut genug.
Nach einer Weile ist die Sonne untergegangen, alle Scheinwerfer sind angeschaltet, und die Songs, für die wir uns entscheiden, sind von der ruhigen Sorte. Ich lehne mich an seine Schulter, mache die Augen zu und schlafe noch mal ein. Das hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich fühle mich einfach so wohl. Normalerweise will ich etwas beweisen oder einen Anspruch klarstellen, wenn ich mich an ihn lehne. Aber jetzt – geschieht es einfach, um ihn zu spüren. Um wieder in unserem Nest zu sein.
Als ich aufwache, sind wir nicht mehr weit weg von meinem Zuhause. Anders wäre es mir lieber.
Wenn ich nicht in Depressionen verfallen will, muss ich jetzt irgendwie eine Brücke schlagen – zwischen dem hier jetzt und dem nächsten Mal, bei dem wir so zusammen sind. Wann genau das sein wird, spielt keine Rolle. Ich muss nur wissen, dass es sein wird.
»Was meinst du, wie viele Tage könnten wir schwänzen, ohne Ärger zu kriegen?«, frage ich. »Wenn wir vormittags da sind, würden sie es vielleicht gar nicht mitbekommen, dass wir nachmittags abhauen?«
»Sie kommen uns bestimmt auf die Schliche«, sagt er.
»Vielleicht nur einmal pro Woche? Oder einmal pro Monat? Ab morgen?«
Ich hätte gedacht, dass er darüber lacht, doch er wirkt irgendwie gequält. Nicht wegen mir, sondern weil er nicht ja sagen kann. Ich kann oft schlecht damit umgehen, wenn er Trübsal bläst. Jetzt kommt es mir fast recht, weil er damit dem Tag ebenso viel Bedeutung beimisst wie ich.
»Wenn es nicht geht, sehe ich dich trotzdem in der Mittagspause?«, frage ich.
Er nickt.
»Und vielleicht können wir ja nach der Schule noch irgendwas zusammen machen?«
»Ich denke schon«, sagt er. »Wobei, ich weiß nicht so genau, was sonst noch so ansteht. Ich habe gerade was anderes im Kopf.«
Pläne. Vielleicht hat er ja recht – vielleicht versuche ich tatsächlich, ihn immer festzunageln, statt den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. »Ist schon gut«, sage ich. »Morgen ist morgen. Lassen wir es heute einfach schön ausklingen.«
Ein letzter Song. Eine letzte Kreuzung. Eine letzte Straße. Und wenn du dich noch so sehr an einen Tag klammerst, irgendwann entschwindet er dir.
»Da wären wir«, sage ich kurz vor unserem Haus.
Es soll immer so sein, würde ich gern zu ihm sagen.
Er hält an. Löst die Zentralverriegelung.
Schön ausklingen lassen
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: