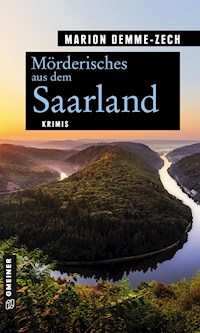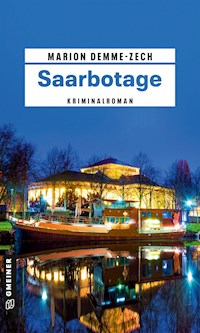Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Wolfgang Forsberg
- Sprache: Deutsch
Eine Wasserleiche wirbelt bei einer Überfahrt auf der Saar das Leben von vier Menschen durcheinander. Während sich die Freundinnen Hanne und Gabriele nach dem Leichenfund auf die Suche nach den besonderen Umständen von Siegfried Brokatts Tod machen und auch Kommissar Forsberg den kuriosen Spuren nachgeht, verfolgt Dackel Günther seine ganz eigenen Pläne. Dass bei den Ermittlungen vieles nicht zusammenpasst, könnte daran liegen, dass der Tote im gelben Parka nicht wirklich Siegfried Brokatt ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Demme-Zech
Letzter Ausstieg Saar
Kriminalroman
Zum Buch
Aufgetaucht Ein Burnout führt die strebsame Ethnologin Hanne an die Saarschleife. Auf Drängen ihrer Therapeutin nimmt sie an einer Single-Wanderung teil, wo sie statt eines Mannes die sympathische Gabriele kennenlernt. Hannes Stimmung hellt sich auf, was sich abrupt ändert, als auf einer Fährfahrt eine Leiche angespült wird. Den gelben Parka bekommt Hanne noch zu fassen, die Leiche selbst treibt die Saar hinab. Mit den aufgefundenen Papieren identifiziert die Polizei den Toten als Siegfried Brokatt. Dass es sich bei der Leiche um Gustav Kallenborn, einen Freund Siegfrieds, handelt, ahnt niemand. Ein Zufall ließ Kallenborn über Bord gehen und Siggi, dem das Leben nie gut zuspielte, nimmt die Chance wahr. Kurzerhand steigt er in Kallenborns Leben ein. Was wahnwitzig erscheint, geht auf: Niemand vermisst Kallenborn. Einzig Hanne und Gabriele sowie Kommissar Forsberg rücken Siggi mit ihren Ermittlungen immer näher. Es beginnt eine verrückte Jagd nach einem Toten, der nicht tot ist, und einer Leiche, die niemand vermisst.
Marion Demme-Zech wurde im Saarland geboren. Dort lebt sie noch heute, mit Tochter und Mann direkt unterhalb einer Burg. Sie studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und ein bisschen Bauingenieurwesen. Anfänglich schrieb sie pädagogische Autorenbeiträge, in den letzten Jahren folgten Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien. »Letzter Ausstieg Saar“ ist nach »Ahrtrüffel« ihr zweiter Kriminalroman im Gmeiner-Verlag.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Marion Demme-Zech
ISBN 978-3-8392-6640-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Alles kommt zu seinem Ende
Endlich werden Tag’ zu Jahren
und die finstere Nacht zum Licht.
Endlich werden Nächt’ zu Tagen,
wenn der helle Mond anbricht.
Endlich werden dürre Äste
ganz mit Rosen ausgeziert.
Endlich, endlich kommt das Beste
wenn das Schlimmste sich verliert.
aus: Verklingende Weisen –
Volkslieder aus Lothringen, Louis Pinck, Band III, 1933.
Unter Gleichgesinnten
Ich ertrage alles, vielleicht sogar Glück.
Hanne Wallenstein
Gibt es eine bessere Chance,
um Gleichgesinnte zu treffen und kennenzulernen?
Die Gemeinde Mettlach lädt herzlich ein zur
1. Single-Kultur-Wanderung
am 1. September 2019
Anmeldung bei der Tourismuszentrale Mettlach: 06864 86867564
Start ist um 9.30 Uhr in Mettlach vor der Alten Abtei.
Gibt es eine bessere Chance, um Gleichgesinnte zu treffen und kennenzulernen?
Exakt die Worte standen auf dem bunten Flyer für die Wanderung, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Aber ja, es gibt weit bessere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Selbst wenn mir in dieser Sekunde keine einfällt. Was unter Umständen nur daran liegt, dass es zutiefst unangenehm ist, hier am frühen Morgen in Mettlach, inmitten dieser ganzen Schar mir völlig fremder Menschen, zu stehen.
»… ich wünsche Ihnen viel Freude und nette Begegnungen bei unserer ersten Single-Kultur-Wanderung«, schließt Herr Schmitz seine Ansprache.
Erleichtert, dass diese unangenehme Situation ein Ende gefunden hat, hebe ich meinen prall gefüllten Rucksack an, um ihn mir auf den Rücken zu schnallen. Doch ich habe mich zu früh gefreut.
»Bevor es allerdings losgeht, stellen wir uns erst einmal alle vor und erzählen, warum wir hier sind. So lernen wir uns gleich besser kennen«, fährt der Führer fort und zwinkert mir zu. Mir, die ich unglücklicherweise direkt neben ihm stehe.
»Bitte, Hanne, Sie dürfen den Anfang machen.«
Ich nicke brav und schnappe zugleich nach Luft, denn mit einem Mal sind alle Augen auf mich gerichtet. Auf mich, die ich schon seit Wochen so gut wie keinen Menschen, außer meinen Eltern und Frau Tietze-Meiermann, zu Gesicht bekommen habe.
Angespannt überlege ich, was am besten zu sagen sei, während ich völlig grundlos über meinen Ellenbogen reibe und versuche, die Blicke der anderen zu ignorieren. Mir kommt der Gedanke, ehrlich zu sein und die Wahrheit zu sagen. Schlicht und einfach zu erzählen, dass mich im Grunde meine Therapeutin zu dieser Tour gezwungen hat, obwohl sie wissen müsste, wie unangenehm das alles für mich ist. Warum schickt sie mich zu einer Single-Kultur-Wanderung? Genau diese Therapeutin, Frau Tietze-Meiermann, allerdings hatte mir vergangene Woche auch geraten, nicht bei jeder Gelegenheit »grundehrlich« zu sein, wie sie es nannte.
»Zu viel Offenheit stößt manche Menschen vor den Kopf«, verkündete sie mir.
Unsicher, ob das jetzt einer der Momente ist, in denen es angeraten sei, die Dinge »etwas verblümter« darzustellen, wenn man den Wortlaut meiner Therapeutin nutzen möchte, suche ich nach einem alternativen Einstieg. Je länger es dauert, desto unruhiger werde ich. Mein Kopf ist wie leergefegt, und so versuche ich, aus purer Not heraus, die Aktion möglichst schnell hinter mich zu bringen.
»Ich bin Frau Doktor Wallenstein, Ethnologin mit Schwerpunkt auf außereuropäischen Gesellschaften. Für meine Teilhabe an dieser Veranstaltung kann ich Ihnen gegenwärtig keinen adäquaten Grund nennen. Ich suche keinen Partner … derzeit.« Ich bemerke, dass ich rot werde und nicht das Geringste dagegen unternehmen kann. Also rede ich einfach weiter in der Hoffnung, dass der peinliche Moment dann schneller vorbeigeht. »Ehrlich gesagt bin ich nicht unzufrieden, so allein«, füge ich hinzu.
Die Blicke haften weiterhin erwartungsvoll auf mir. Daraus schließe ich, dass ich womöglich noch mehr preisgeben muss. »Aber das ist sicher kein Problem, denn die Wahrscheinlichkeit, auf einer Single-Wanderung einen Partner zu finden, ist so oder so als eher gering einzuschätzen, das wurde in verschiedenen Studien …«
Der Gesichtsausdruck von Herrn Schmitz verunsichert mich. Er sieht verwirrt aus. Womöglich läuft die Vorstellung in die falsche Richtung, sage ich mir und breche meine Ausführungen ab, um es mit konstruktiver Kritik zu versuchen.
»Ähm, was ich kurz anmerken wollte, Herr Schmitz: Hinsichtlich des Flyers, das kann man so eigentlich nicht schreiben.«
Herr Schmitz legt die Stirn in Falten. Allem Anschein nach kann er mir nicht folgen.
»Es ist doch unlogisch, alle Singles als Gleichgesinnte zu bezeichnen. Der Umstand, Single zu sein, macht Alleinstehende nicht automatisch zu einer Gruppe mit gleichen Interessen. Da hinkt letztlich Ihre komplette Aussage. Eigentlich ist die ganze Idee zu dieser Veranstaltung ziemlich absurd.«
Ich verstumme. Nochmals eine Pause, und von Neuem blickt man mich nur an.
»Habe ich etwas Falsches gesagt?«, frage ich Herrn Schmitz.
»Nein, nein. Ganz und gar nicht«, entgegnet er freundlich und legt mir kurz die Hand auf die Schulter. »Alles prima, Frau Wallenstein. Wir müssen uns lediglich ein wenig beeilen. Constanze, könntest du dich vielleicht vorstellen?«
»Hallo, ich bin die Conny! 38 Jahre alt und Grundschullehrerin. Seit ein paar Monaten bin ich wieder Single. Leider!« Das letzte Wort zieht Constanze in die Länge. »Aber ich bin mir sicher, eines Tages werde ich den Mann meiner Träume finden.«
Während »die Conny« mit einer Stimme, deren Frequenz nur schwer zu ertragen ist, allerlei Details über ihr Liebesleben ausplaudert, und die Augenpaare, insbesondere die männlichen, an ihr kleben, wünsche ich mich an einen anderen Ort oder in eine andere Zeit, im günstigsten Fall sogar in ein anderes Leben.
Ganz automatisch wandern meine Gedanken zu Frau Tietze-Meiermann, die mir all dies eingebrockt hat. Konsequent stößt sie mich mit der Nase darauf, dass ich in keiner Lebenslage wie all die anderen Menschen bin. Kein Regelfall zu sein, ist offensichtlich mein größter Fehler, und als Allheilmittel sieht meine Therapeutin es an, mich unter Menschen zu bringen. Der Rahmen, in dem dies geschieht, scheint zweitrangig zu sein.
»Sie müssen mal raus! Sich unterhalten, austauschen, amüsieren, ein wenig flirten vielleicht sogar«, schnitt sie vor einer Woche das Thema an. Dabei reichte sie mir mit einem erdrückend optimistischen Lächeln den Handzettel zur Single-Wanderung.
Ich sah mir den Zettel an und zog die Augenbrauen hoch: »So wirklich passt das aber nicht zu mir.« Dabei hätte ich schon wissen können, dass jede Widerrede zwecklos war.
»Rein zu Übungszwecken«, hielt Frau Tietze-Meiermann dagegen und fügte dann hinzu. »Sie wollen doch, dass es Ihnen bald besser geht?«
Was für eine Frage! Als Patientin in einer Therapie ist man, was das Argumentieren betrifft, in einer kümmerlichen Position. Der Therapeut nimmt als Profi die Deutungshoheit für sich in Anspruch, und so kann prinzipiell alles, was du sagst, symptomatisch sein.
Dafür brauchte es im Fall meiner Therapeutin nicht einmal Worte. Frau Tietze-Meiermann lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und blickte mich nach meiner letzten Frage wortlos an. Spätestens nach dem unüberhörbaren Seufzer des Bedauerns machte sich bei mir das Gefühl breit, ich hätte trotz der vielen Gespräche der vergangenen Monate rein gar nichts dazugelernt.
»Aber …« Mein letzter Vorstoß in Richtung Vernunft wurde gnadenlos niedergeschlagen.
»Kein Aber!«, unterbrach mich die Tietze-Meiermann. »Trauen Sie sich! Zeigen Sie, dass Sie etwas an Ihrem Leben ändern wollen!«
Was sollte ich darauf sagen? Unter diesem Druck gab ich nach und buchte die Wanderung für Singles. Ich machte es einzig und allein, um mir – oder vielleicht weit eher noch ihr – zu beweisen, dass ich kein Drückeberger bin. Von da an bis heute lebte ich mit dem diffusen Gefühl, einen großen Fehler begangen zu haben, und wie es aussieht, war die Befürchtung berechtigt.
Mittlerweile ist das Wort an Klaus – dem Klausi. Conny strahlt. Dem Äußeren nach zu urteilen, hat sie große Hoffnungen auf diesen Tag gesetzt. Ich frage mich, wie sie es mit dem engen Kleid und den Stöckelschuhen über die 15 Kilometer lange Strecke schaffen möchte, behalte aber diese kritische Frage für mich, wie mir es Frau Tietze-Meiermann empfohlen hat.
Endlich ist die Vorstellungsrunde zu Ende. Nachdem ich weit mehr Details aus dem Leben der Mitwandernden erfahren habe, als mir lieb ist, kommt sogar der Part mit der Kultur zum Tragen.
»Auf der gegenüberliegenden Saarseite, auf Schloss Saareck, hat vor Kurzem das holländische Königspaar genächtigt«, verrät uns Herr Schmitz und deutet auf das hübsche rote Gebäude nahe am Saarufer, das heute als Gästehaus dient.
»Wie romantisch«, plappert Oliver, nein Olli, sofort los. Worauf ein künstlich klingendes Kichern von Conny folgt.
Auch wenn es für mein Allgemeinbefinden nicht dienlich sein dürfte, all diese Vorurteile gegen völlig fremde Menschen zu verspüren, komme ich nicht umhin festzustellen, dass die Vorstellungsrunde meine Toleranzgrenze bereits gesprengt hat. Aber gleichgültig wie, wir marschieren los. Zwölf Frauen, sieben Männer.
Gegenwärtig gesellen sich die Herren zu den Damen ihrer Wahl, und da ich niemals enorm anziehend auf Männer gewirkt habe, bin ich nicht verwundert, allein zu wandern, während der Geräuschpegel um mich herum, das Kichern und Murmeln ansteigt. Wir wandern ein Stück durch die kleine Stadt, und ich gestehe mir ein, zumindest was den Erlebniswert und die Aussichten betrifft, hat man uns nicht zu viel versprochen. Mettlach ist ein sympathisches Städtchen, das hatte ich in den »saarlandlosen« vergangenen Jahren fast vergessen.
Unser Weg führt einmal quer durch den Abteipark. Der alte Turm und der Abteibrunnen, die geschwungene Brücke, seltene alte Bäume und der stille See mit zahlreichen Enten und Gänsen, hier ist es malerisch. All das wäre mir allein, ohne den wildgewordenen Trupp an Singles, der in diesem Moment seine Chancen auslotet, weitaus angenehmer.
»Sehen Sie nicht immer alles so schwarz!«, gab mir Frau Tietze-Meiermann letzte Woche zum Abschluss unserer Stunde mit auf den Weg. »Suchen Sie das Gute in den Dingen.«
Ich versuche es und entscheide: Herr Schmitz, unser Führer, der sich in dieser Sekunde gut gelaunt zu mir gesellt, ist de facto ein Lichtblick. Ein angenehmer Zeitgenosse, der das Versprechen »Kultur«, ernst zu nehmen scheint und an jeder Ecke etwas zu erzählen weiß. Gebildet, sachkundig und, wie er mir sogleich vorbeugend mitteilt, glücklich verheiratet. Was will man mehr? Ich sehe die Sache, wie mir aufgetragen wurde, positiv und erkläre Herrn Schmitz heute zu meinem perfekten Wanderpartner. Am besten, ich weiche ihm nicht mehr von der Seite.
»Jetzt geht es zur Burg Montclair, einer mittelalterlichen Burgruine, die auf einem beeindruckenden Bergrücken liegt, der von der Saarschleife umströmt wird«, erklärt er uns, nachdem wir an der Lutwinuskirche – oder wie die Mettlacher ihr Gotteshaus laut Schmitz weit lieber nennen, »dem Mettlacher Dom« – eine kurze Pause eingelegt haben. Unser Führer wendet seinen Blick wieder nach vorne und flüstert mir mit einem Augenzwinkern zu: »Ich hoffe, Sie haben eine gute Kondition.«
Diese Hoffnung muss ich leider enttäuschen und viele andere auch. Und schon wieder erkenne ich etwas Gutes: Es wird beim Aufstieg zur Burg Montclair deutlich stiller. Das pausenlose Plappern und Murmeln versiegt, während wir die insgesamt 170 Höhenmeter auf kurzer Strecke bewältigen.
»Partnersuche ist eben kein Ponyhof«, bemerkt Herr Schmitz, oben an der Burgruine angekommen, und schmunzelt in seinen grauen Vollbart. Den Spruch findet er als Einziger witzig. »Wir haben eine Stunde Aufenthalt. Gerne könnt ihr euch die Burg und das Museum anschauen oder eine Kaffeepause im Burginnenhof einlegen.«
Während die meisten den Weg in Richtung Innenhof einschlagen, entscheide ich mich für die Variante Kultur. Ich war immer schon weit wissbegieriger als der Durchschnitt, kommt mir in den Sinn, als ich den anderen hinterherblicke. Eine übereifrige Streberin, hätten meine Mitschüler damals womöglich gesagt. Das hat meine Beliebtheit in den verschiedenen Klassen nicht gesteigert, aber immerhin, mit dem unstillbaren Wissensdrang war ich zu jeder Zeit der Liebling der Lehrer. Und später beim Studium der Professoren. Auf irgendeine Weise war ich immer schon anders, aber an der Universität fiel dieser Umstand erstmals weniger ins Gewicht. Die Dozenten schätzten meinen Eifer und Perfektionismus. An diesem Ort war ich endlich kein Sonderling mehr, sondern konnte zeigen, was in mir steckt. Ich wurde wertgeschätzt, zumindest fachlich, und mein Drang weiterzukommen war augenfällig. Mit 25 hatte ich meinem Professor die Dissertation vorgelegt und danach lief alles quasi wie von selbst. In wenigen Jahren hatte ich an der Uni weit mehr erreicht als mancher Dozent bis zu seinem Ruhestand. Ich war erfolgreich, fast könnte man sagen, eine Koryphäe auf meinem Fachgebiet. Privat jedoch war ich immer noch so unbeholfen wie zur Grundschulzeit. Das allerdings wurde mir immer gleichgültiger. Ich stürzte mich in die Arbeit, beruflich lief schließlich alles in die gewünschte Richtung, und dann kam mir plötzlich, ganz und gar unerwartet, mein Leben, wie ich es kannte, abhanden.
Es ist bitter, derzeit. Ich wünsche mich täglich, ja fast jede Minute, in diese Zeit zurück. Und doch – trotz all der Wochen, in denen ich nichts unversucht gelassen habe, mein Leben umzukrempeln und an mir zu arbeiten – kann ich keinerlei Besserung spüren. In mir ist nur Leere. Vielleicht ist es an der Zeit zu akzeptieren, dass meinem Leben sämtliche Bestimmung verloren gegangen ist, denke ich gerade, als eine Hand meine Schulter berührt. Ich zucke zusammen. Jemand hat mich angesprochen.
»Manu, richtig?«
Ich drehe mich um.
»Nein, Hanne«, entgegne ich.
»Ja, stimmt: die Hanni! Was für ein wunderschöner Name!«
Ich nicke brav, würde aber weit lieber die Flucht ergreifen. Doch das wäre definitiv unhöflich und feige dazu. Also harre ich aus und übe mich tapfer in Kommunikation. »Und Sie sind … äh, ich meine, du bist Klaus?«
»Ja, der Klausi!«
Ah ja. In der Vorstellungsrunde erklärte der Klausi uns, dass er auf dieser Tour »seine Prinzessin« sucht. Der Gedanke daran jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken, und ich denke noch weit mehr an Flucht. Doch ich halte durch, stehe stumm da und betrachte ratlos meine Wanderstiefel.
»Kommst du mit zu den anderen? Drüben stehen Biergarnituren«, fragt mich Klausi lässig. Da ich wohl seiner Einschätzung nach nicht ausreichend große Begeisterung zeige, fügt er hinzu: »Ich habe extra eine Flasche Prosecco für einen Engel wie dich eingepackt.«
Mir wird mulmig. Großartig, das hat mir noch gefehlt, geht mir durch den Kopf. In meiner Not setze ich auf eine höfliche Lüge: »Das ist wirklich nett von dir, aber vielen Dank. Eigentlich wollte ich mir unbedingt das Museum anschauen und zu den Türmen hinaufsteigen.«
Klausi zieht eine übertrieben enttäuschte Schnute. Der Großteil der Gruppe bevorzugt es, eine Rast einzulegen, und mein neuer Bekannter gehört gewiss ebenfalls zu der Kategorie »Entspannung statt Burggeschichte«. Trotzdem hängt er sich an mich ran.
»Da komme ich doch mit!«, sagt er, und es klingt wie eine Drohung. Klausi folgt mir die Treppe hinunter ins Burgmuseum. Die unteren Ausstellungsräume sind neu gestaltet. Es gibt einen Medientisch und allerlei antike Fundstücke. Nicht ganz so ungehindert wie erhofft, betrachte ich die Vitrinen, und es dauert nicht allzu lange, bis Klausi wieder zu sprechen beginnt. »Den Teil mit der Kultur nimmst du aber sehr ernst, Hanni! Dabei könnte man doch hier alleine, nur zu zweit, etwas weit Schöneres mit seiner Zeit anfangen.«
Na vielen Dank, Frau Tietze-Meiermann, denke ich. Wenn das die neuen Erfahrungen sind, die sie mir vor ein paar Tagen angepriesen hat, kann ich verzichten. Ich will gar nicht genauer wissen, was Klausi mit »weit Schöneres« meint. Meine ehrliche Antwort schlucke ich artig hinunter und zucke stattdessen ratlos mit den Schultern. Das ist ein Fehler. Die Geste scheint mein Begleiter als Aufforderung zu verstehen. Er geht in die Vollen.
»Was meinst du? Dieses alberne Rumgeplänkel zu Beginn könnten wir uns doch wirklich sparen. Hast du Lust, nachher mit zu mir zu kommen? Ich koche was für uns, und wir schauen, was ich dir kulturell zu bieten habe.«
Ach du Schreck! Verwirrt blicke ich den Endfünfziger mit den dünnen Haaren an. Auf so eine Dreistigkeit hat mich Frau Tietze-Meiermann in keiner Weise vorbereitet.
»Nein!«, sage ich völlig überzeugt, dass in diesem Fall nichts mehr außer Ehrlichkeit helfen dürfte.
»Nein?«, erkundigt sich Klaus ungläubig. »Bist du dir sicher?«
»Ich glaube, ich muss mal zur Toilette«, gebe ich zurück, denn ich bin der Ansicht, dass es für Klausi besser ist, wenn ich ihm die ausführlichen Gründe für mein Nein erspare.
Selten war einer meiner Toilettenbesuche derart ausgedehnt. Als ich wieder auf der Bildfläche erscheine, vorsichtig und voll Unbehagen, wirkt Klaus nicht bekümmert. Mein Romeo hat sich zwischenzeitlich »der Gabriele« angenähert. Oder im Falle von Klausi wahrscheinlich eher »der Gaby«. Für sie tut es mir ein wenig leid, ich hingegen bin erleichtert. In einem Punkt muss man Frau Tietze-Meiermann recht geben: Heute sammle ich einen ganzen Schwung neuer Erfahrungen.
Zum Glück ruft Herr Schmitz die Gruppe bald wieder zusammen, wir wandern weiter. Auf einem recht abenteuerlichen Serpentinenpfad geht es die zuvor hart erkletterten Höhenmeter wieder hinab. Diesmal heftet sich Gabriele an meine Fersen. Wenn ich mich nicht täusche, nimmt sie gerade Reißaus vor Klausi.
»Hallo Hanne, richtig?«, fragt sie, als sie zu mir aufgeschlossen hat.
»Ja, richtig«, antworte ich und freue mich darüber, mit vollem Namen angesprochen zu werden.
»Ich begleite dich ein Stück, falls dir das recht ist?« Sie sieht mich fragend an, und ich nicke höflich, auch wenn ich faktisch am liebsten allein wandere.
Nach ein paar Minuten jedoch muss ich mir eingestehen, dass sich im Fall Gabriele die therapeutisch verordnete Scheinheiligkeit auszahlt, denn auf dem Weg nach unten beweist Gabriele sich als äußerst angenehme Wanderpartnerin. Jedes Wort, das sie sagt, ist abgewogen, und sie spart sich jegliche privaten Fragen aus. Stattdessen berichtet sie allerlei von der Burg Montclair und den Sagen, die man sich von ihr erzählt. Vom Hufeisenabdruck auf dem Breitenstein vor der Burg habe ich als Kind schon gehört. An die Handlung erinnere ich mich vage. Doch die Sage von den Bienen, die den Grafen Montclair und seine Burgleute vor den Besatzern retteten, ist mir unbekannt.
»Die Angreifer wollten in jenen Tagen die Bewohner aushungern. Nach und nach gingen die Vorräte zur Neige, und die Menschen auf der Burg dachten schon ans Aufgeben«, klärt mich Gabriele auf. »Da entdeckte jemand auf der Suche nach letzten Nahrungsmitteln die Bienenstöcke. Die Bewohner warteten bis zum Morgengrauen, und als die Belagerer erneut anrückten, warfen sie die Bienenkörbe zu den Feinden hinunter. Die Körbe brachen auseinander, und die Bienen machten sich über die Eindringlinge her. Die Angreifer flüchteten und gaben die Belagerung auf. Die Bienen haben die Bewohner der Burg Montclair also gerettet«, beendet Gabriele die kleine Episode und lächelt mich an. Verlegen senke ich den Kopf. Die Geschichte gefällt mir und Gabrieles Art ebenfalls. Sie scheint viel zu lesen und an allem interessiert zu sein – das ist erfreulich.
Zusammen erreichen wir so den Uferweg. Laut Herrn Schmitz dürfte die Fähre, die uns zum anderen Saarufer übersetzt, direkt in unserer Nähe sein. Mit dem Finger weist Gabriele hinauf zur Cloef. Hier, wo sich die Saar zu einer Kehrtwende entschieden hat, ist die Kulisse atemberaubend: der steil aufragende bewaldete Bergrücken mit der Burg Montclair auf unserer Uferseite und den Felsformationen auf der anderen mit dem Aussichtspunkt Cloef und dem über allem thronenden Baumwipfelpfad. Mitten hindurch, umgeben von Talhängen, fließt die Saar und spiegelt dieses großartige Panorama wieder.
Es ist eine eigenwillige Landschaft, die mir völlig unerwartet entgegentritt. Ehrlich gesagt hatte ich in meinen vielen Jahren in Mainz immer die Meinung vertreten, das Saarland sei nicht weiter erwähnenswert. Umso mehr verwundert mich nun der Anblick. Das letzte Mal war ich mit meinen Großeltern in dieser Gegend, wohl noch zu Grundschulzeiten. In jenen Jahren gab es oben in der Nähe der Cloef einen Märchenpark, der mittlerweile geschlossen sein soll. Vermutlich war ich damals weit interessierter an dieser Attraktion als an den Schönheiten der Natur, überlege ich ein wenig amüsiert. In diesem Moment muss ich mir fast eingestehen, dass die Wanderung eine nette Abwechslung ist nach all den Wochen, die ich, meist allein, zu Hause in meinem alten Kinderzimmer zugebracht habe. Dieser Gedanke macht mich mit einem Mal seltsam mutig.
»Was machst du … so in deiner Freizeit? Oder auf der Arbeit?«, frage ich Gabriele ein bisschen zu steif und unbeholfen. Im Small Talk bin ich ungeübt, doch ich gebe mir alle Mühe. Mehr kann man nicht erwarten.
Es ist verblüffend, wie einfach richtungslose Kommunikation ist. Auch wenn ich das von mir nicht behaupten kann, die meisten Menschen erzählen gerne von sich. Gabriele berichtet von ihren Kindern, ihrer Ehe und der Scheidung. Sie ist 52 und seit zwei Jahren allein. Ihre Tochter studiert in Koblenz. Lehramt. Seit ihre »Jüngste« weggezogen ist, arbeitet Gabriele in der Sommerzeit mehrmals die Woche im Garten der Sinne, einer Gartenanlage in Merzig. Sie stehe meist an der Kasse, schön sei es da, sagt sie. Ich könne doch mal vorbeischauen, zu einem Kaffee und einem Stück Kuchen, wenn ich Lust haben sollte. Das würde sie freuen. Ich nicke und finde es beachtlich, dass Gabriele immer weiter erzählt, während sie, gewiss nicht absichtlich, versäumt, mir Fragen über mein Leben zu stellen. Das ist kein Problem, ich bin ihr sogar dankbar dafür, denn ich wüsste nicht, was ich in diesem Fall berichten sollte. Keine Kinder, keine Hobbys. Nicht einmal eine Scheidung habe ich vorzuweisen.
»Kosten Sie doch Ihre viele freie Zeit voll aus«, rät Frau Tietze-Meiermann gerne, wenn ich sie aufsuche und abermals keine Erfolge präsentieren kann. Meine regelmäßigen Katastrophen nimmt sie mit einem Lächeln zur Kenntnis. Ich soll es mir gutgehen lassen. Das ist ihrer Ansicht nach die beste Therapie. Dabei hatte ich das Bedürfnis, das Leben einfach nur zu genießen, all die Jahre nicht. Ich mochte mein komplett ausgefülltes Leben, ich mochte die Tage ohne die verdammte Leere und völlig frei von nutzlosen Fragen. In diese sinnerfüllte Zeit wünsche ich mich zurück, auch wenn ich arbeitete bis spät in die Nacht und danach kaum ein Auge zumachte. Alles war perfekt, zumindest bis die ersten Panikattacken auftauchten, die zuerst nur nachts ihr Unwesen trieben und sich noch gut vor den Kollegen verstecken ließen. Doch sie kämpften sich beharrlich in meinen Tag vor und bescherten mir damit weit mehr Freizeit, als jedem Menschen lieb sein dürfte.
Der Umstand ließ mich zu einem Kind werden, dem man sagt, was es zu tun oder zu lassen hat. Ich hasse diesen Zustand. Gleichwohl füge ich mich, denn die Furcht, noch einmal ungebremst in ein solches Loch zu fallen, ist weitaus größer als mein Freiheitsdrang.
»Wir sind da!«, sagt Gabriele.
Mit einem Mal stehen wir am Steg direkt vor der Fährenglocke. Die Gruppe ist ein paar 100 Meter hinter uns, das stellen wir erst fest, als wir uns verwundert umblicken. Der Fährmann hat gerade erst am anderen Ufer angelegt und lässt eine kleine Gruppe Radfahrer aussteigen. Es ist zu verlockend, wir schauen beide auf die Glocke.
»Sollen wir schon …?«, fragt Gabriele unentschlossen und weist auf die Kordel.
»Du oder ich?«, erwidere ich statt einer Antwort.
»Ich bin für du«, sagt Gabriele und grinst wie ein Teenager.
Okay, dann ich, sage ich mir und fühle mich fast wie ein Kind. Ich nehme die braune Schnur in die Hand, und Sekunden später ertönt ein silberhelles Bimmeln, das wie eine unsichtbare Welle breit durch das Flusstal schwingt. Ich sehe Gabriele an, und wir beide lachen. Ohne jeden Grund, einfach so. Es fühlt sich merkwürdig an, irgendwie schräg. Ich bin mir nicht sicher, wann ich das letzte Mal aus vollem Hals gelacht habe. Kein aufgesetztes Lächeln oder Nicken, um anderen zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist. Ich meine ein echtes, faktisches Lachen, das ganz selbstverständlich hervorbricht. Der Umstand bereitet mir Angst. Auch wenn alle behaupten, glücklich zu sein wäre eine Sache, die jedermann anstrebe – vielleicht sogar das große Ziel des Lebens – kann ich dem nicht bedingungslos zustimmen. Vermutlich bin ich auch hier wieder einmal nicht wie all die anderen. Glück, oder wie immer man es nennen mag, macht mich schwindlig. Das Gefühl der Ausgelassenheit weckt in mir Unbehagen. Nervös kratze ich mich unter dem Kragen meines Polohemdes. Mein Herz rast, ich konzentriere mich darauf, tief zu atmen und mich von dem Gefühl nicht einfangen zu lassen. Ich halte es aus, sage ich mir, ich stehe diesen Moment durch, so gut ich kann, denn am heutigen Tag habe ich den festen Vorsatz, kein Feigling zu sein. Ich ertrage im Augenblick alles – selbst Glück.
Dass die kleine Fähre fast schon unseren Steg erreicht hat und auch das Aufschließen der Gruppe, registriere ich nur am Rande.
»Einen schönen guten Tag«, grüßt der Fährmann, und diese Worte holen mich wieder zurück ins Hier und Jetzt. Sonnengebräunt und bestens gelaunt sieht er aus, als wäre Unbekümmertheit sein Tagesgeschäft. Beneidenswert, finde ich und sehe ihm dabei zu, wie er uns den Eingang zur Fähre öffnet. Nachdem wir den bescheidenen Obolus entrichtet und er uns die Fahrkarten gegeben hat, sehen wir uns nach einem passenden Platz um.
»Ganz vorne am Bug«, schlägt Gabriele vor und setzt sich wie selbstverständlich neben mich. Bald schon sind alle Plätze belegt. Wir rücken zusammen, was manchen besonders gut gefällt. Wieder wird gekichert. Herr Mann, unser Fährmann, kündigt an, dass die Überfahrt lediglich drei Minuten dauere. »Die Zeit reicht nicht aus, um seekrank zu werden«, scherzt er.
Die Ankündigung finde ich erleichternd, trotzdem bin ich aufgeregt, als der Motor losknattert und die Fähre Fahrt aufnimmt. Für mich, die ich seit Monaten kaum das Haus verlassen habe, sind diese wenigen Minuten bereits ein erstaunliches Abenteuer. Ich nicke Gabriele zu und drehe mich zum Wasser. Ich will die Aussicht während der Fahrt genießen, wie auch immer das mit dem Genießen funktioniert, heute werde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
Da die Fähre nur zwölf Personen befördern darf, bleibt ein Teil der Gruppe am Saarufer, während die andere Hälfte übersetzt. Conny und Klausi sind mit von der Partie. Gabriele stößt mich verstohlen an und weist ganz leicht mit dem Kopf zu den beiden hinüber. Sie halten Händchen. Wahnsinn, denke ich. Das ging ja erstaunlich schnell, wenn man überlegt, dass Klaus oben bei mir und später auch bei Gabriele einen Anbändelversuch startete. Möglicherweise verspricht so eine Single-Wanderung für aufgeschlossene Menschen, wie es Tietze-Meiermann nennen würde, weit mehr, als man erwarten würde. Mir ist es egal, ich gönne es ihnen. Ich selbst bin, ehrlich gesagt, vollkommen zufrieden damit, Gabriele getroffen zu haben und mich auf dieser kleinen Überfahrt zu befinden. Das allein ist für mich schon ein großer Schritt.
»Was machst du eigentlich so?«, unterbricht Gabriele in diesem Moment meine Gedanken.
»Ich?«, entgegne ich überrascht. Gerade hatte ich all meine Probleme für einen kurzen, viel zu seltenen Moment aus den Augen verloren. Soll ich Gabriele nach all dem, was sie mir von ihrem Leben erzählt hat, mitteilen, dass ich Rentnerin bin? Mit 45 Jahren. Dass ich seit unendlich erscheinenden vier Monaten aus Mangel an Alternativen den zeitlich begrenzten Ruhestand genieße oder, besser gesagt, ertrage? »Zeitweise Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit«, heißt es in der Behördensprache. Bisher war mir diese Option völlig unbekannt. Ausrangiert, beiseitegelegt erscheint mir als Bezeichnung für meinen Fall weit angemessener. Kein Wunder also, dass ich nur sehr zögerlich antworte. »Nun gut, im Moment könnte man sagen …«
Aber ich sage nichts mehr. Ein dumpfes Poltern lässt uns alle hochschrecken. Ein paar schreien sogar auf. Der Schlag kam von unterhalb des Kahns, da bin ich mir sicher. Höchstens ein paar Meter entfernt. Uns hat etwas gestreift, und dieses Etwas, das gegenwärtig vielleicht immer noch unter uns treibt, kann nicht eben klein gewesen sein. Gabriele schaut mich bang an. Mit beiden Händen krallt sie sich an der Sitzfläche der Fähre fest.
»Ein Ast. Hundert Pro! Das kommt öfter vor«, beschwichtigt der Fährmann. Seine Stimme klingt wie aus der Ferne. Ein Blick in das Gesicht des Bootsführers, in dem nun kein Fünkchen Gelassenheit mehr zu finden ist, verrät, dass dies nicht wirklich öfter passiert. Kurz darauf klappert es wieder. Dieses Mal zwar leiser, doch so, als würde jemand an der Unterseite des Bootes Einlass fordern. Alle rücken dichter zusammen. Es ist eine gespenstische Atmosphäre, die sich an Deck breitmacht.
Mit festem Griff hält der Fährmann weiter Kurs Richtung Ufer, während er mit den Augen die Wasseroberfläche absucht. Ich drehe mich ebenfalls zur Saar, recke den Hals und schaue am Bug vorbei in die Tiefe. Was auch immer sich dort im Wasser verbirgt, es schwimmt scheinbar weiterhin unter unserer Fähre.
Ich stehe auf.
»Vorsichtig!«, sagt Gabriele, deren Finger die Sitzfläche nicht loslassen. Eine ihrer brünetten Haarsträhnen klebt an ihrer Wange.
»Keine Sorge« beruhige ich sie und umfasse im gleichen Moment mit meinen Armen den Fahnenmast, um sicheren Halt zu haben und den Kopf weiter über den Bug hinauszulehnen. Ein Gegenstand schimmert durch das grünlich-trübe Wasser hindurch. Nur leicht. Trotzdem würde ich sagen, er ist eindeutig gelb. Ein leuchtend helles Gelb, womöglich ein Eimer oder ein abgerissener Stofffetzen.
»Da ist etwas! Stopp! Das müssen Sie sich ansehen«, alarmiere ich den Fährmann, der sogleich den Motor abstellt und sich an der Gruppe vorbei drängt, um zu mir nach vorne zu kommen.
Als er neben mich tritt, sich über die Brüstung beugt und diesen unbeschreiblichen Ausdruck in seinem Gesicht bekommt, hätte ich es ahnen können. Instinktiv hätte ich wissen müssen, dass es besser ist, nicht hinzusehen. Ohne den Anblick wäre mir die Sache gleichgültiger gewesen und niemals derart nahe gegangen. Doch was immer es ist – Neugier, Sensationslust oder einzig pure Dummheit – ich kann nicht anders. Ich will wissen, was diesem eben noch so entspannten Mann ein solches Entsetzen ins Gesicht getrieben hat. Was kann derart furchtbar sein?
Als ich mich zum Wasser drehe, sehe ich den Grund, er ist schon fast gänzlich aufgetaucht. Die Strömung unterhalb der Fähre, die ihre Fahrt gedrosselt hat, treibt ihn an die Oberfläche. Er sieht aus, als ob er nach einem langen Tauchgang emporsteigt. Doch dass er kein Taucher ist, der gleich aus dem Wasser steigt, sieht man sofort an den Augen des Mannes, die weit geöffnet sind. Die aufgequollene Haut und der eigentümliche Geruch lassen ebenso keinen Zweifel zu. All das zusammen zeugt davon, dass diese Person schon seit einiger Zeit nicht mehr am Leben ist.
Wasserleichen sind ein grausiger Anblick, sagt man allgemeinhin, und jetzt kann ich diese Behauptung zweifelsfrei bestätigen. Während unser Fährmann bestürzt zurückzuckt, kaum fähig, sich auf den Beinen zu halten, bleibe ich seltsam ungerührt. Ich weiß nicht, woher ich die Ruhe oder den Mut nehme, doch ich stürze zum Steuerstand, um mir den Bootshaken zu greifen. Jemand muss den Mann aus dem Wasser ziehen, bevor ihn die Strömung wieder erfasst und weitertreibt. Der Fluss darf ihn nicht mitnehmen.
Gabriele schreit auf, als ich mit dem Haken auf sie zustürme und mich erneut über die Reling lehne. Es wird hektisch auf der Fähre. Sie wankt bedrohlich, da alle panikartig nach hinten drängen. Bei dem ganzen Tumult ist es schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, die lange Stange in die passende Position zu bringen. Zumal die Strömung den Körper mit aller Kraft mit sich nehmen will. Nur mit Glück bekomme ich die Innenseite der gelben Regenjacke mit dem Haken zu fassen. Ich halte die Stange mit festem Griff. Auch wenn es mir zunehmend an Kraft fehlt und die Strömung immer wieder nach ihm greift, ich lasse ihn auf keinen Fall los!
Nicht mir, sondern dem Toten scheint es an Vehemenz und Mut zu fehlen. Plötzlich und völlig unerwartet lockert er den Zug am Haken. Er gibt auf. Bevor ich erfasse, was geschieht, hat sich der Körper der Jacke entledigt. Der Mann gleitet hinaus aus dem Parka, er ist frei und der Strömung wehrlos ausgesetzt. Während ich ohnmächtig dabei zuschauen muss, wie die Leiche fortgetrieben wird, halte ich den gelben Fetzen weiter am Haken. Das Wasser gurgelt aus Ärmeln und Taschen und jagt der flussabwärts treibenden Leiche hinterher.
»Ich brauche etwas zum Festhalten!«, flüstert jemand neben mir. Es ist Gabriele. Zusammengekauert sitzt sie auf dem Boden, die Beine angezogen, den Blick starr auf ihre Knie gerichtet, den Rücken fest an die Sitzbank gepresst. Ihr Gesicht sieht verändert aus. Fast schimmert es bläulich.
»Ich brauche etwas zum Festhalten«, stammelt Gabriele ein weiteres Mal.
»Nur eine Sekunde noch«, verspreche ich und ziehe den Anorak mit energischem Ruck an Bord. Noch mal ein Aufschrei. Der gelbe Stoff fällt vor uns auf den Boden. Er und die Wasserlache, die sich vor unseren Augen bildet, sind in dieser Sekunde alles, was von der plötzlich und so unerwartet zum Vorschein gekommenen Erscheinung geblieben ist. Das Ganze hat keine zwei Minuten gedauert, und doch hat es eine schauerliche Atmosphäre auf dem Boot hinterlassen. Totenstille breitet sich aus, alle sehen zu dem gelben Etwas.
Als ich meine Hand auf Gabrieles lege, zuckt sie scheu zusammen.
»Keine Sorge. Uns passiert nichts. Wir sind gleich am Ufer.« Meine Stimme ist seltsam monoton, fast als gehöre sie nicht zu mir. Beschwörend blicke ich zum Fährmann, der sich hierauf alle Mühe gibt, die Fassung wiederzuerlangen. Er weiß, er ist jetzt am Zug, auch wenn ihn die Sache erkennbar mitgenommen hat. An die Reling gestützt richtet er sich auf, geht zurück zum Steuer und lässt den Motor an. Die Maschine heult kurz auf. Das allein reicht schon aus, um Gabriele und die anderen erneut aufschrecken zu lassen.
Merkwürdigerweise bin ich in diesen Sekunden, in denen allen der Schock ins Gesicht geschrieben steht, weitaus gefasster als in den ganzen vergangenen Monaten, in denen nichts, aber auch gar nichts geschehen ist.
In den letzten Minuten sind wir fast bis hinunter zur Saarschleife getrieben, stelle ich fest. Der Rest der Gruppe, der vermutlich immer noch am Ufer ausharrt, wird verwundert sein und sich fragen, wo die Fähre nur bleibt. Derzeit ist niemand von ihnen zu sehen. Wacker stellt sich die Fähre gegen die Strömung und nimmt wieder Kurs auf. Es wird dauern, bis wir den Bootssteg auf der anderen Saarseite erreichen. Bis dahin wird die Leiche längst weiter flussabwärts getrieben sein, überlege ich und taste mit der freien Hand meine Jackentasche ab. Gabrieles Hand, die sich wie versteinert um die meine gelegt hat, kann ich nicht loslassen.
»Bitte mach du das!«, sage ich zu Olli und strecke ihm mein Handy hin. »110!«
Olli verharrt einen Augenblick regungslos, er braucht ein paar Sekunden, bis er reagiert, aber letzten Endes nimmt er doch das Smartphone in die Hand und nickt mir zu.
»Sag, sie sollen sich unbedingt beeilen. Bitte!«, fordere ich ihn auf. Fast fühle ich mich, als wäre ich in einem Film. Als gäbe es ein Drehbuch, das nur ich kenne. Ich spiele meine Rolle genau nach Anweisung. Warum man allerdings mir eine Hauptrolle in diesem absonderlichen Geschehen zugesprochen hat, ist mir völlig unbegreiflich.
»Siegfried Brokatt«, folgert Hauptkommissar Forsberg später mit einem Blick auf Pass und Führerschein. »Der Mann heißt Siegfried Brokatt. Gerade einmal 39.«
Die Papiere steckten in der Innentasche des gelben Parkas. Ebenso wie ein Schlüsselbund und ein paar durchweichte Hustenbonbons.
»Seltsamerweise gab es keine Suchmeldung in den letzten Tagen. Niemand scheint den Mann zu vermissen. Komisch. Aber na ja, vielleicht war er alleinstehend und der Einsamkeit erlegen. Allein zu sein, hat schon so manchen verzweifeln lassen«, bemerkt der Hauptkommissar mit einem Hauch Bitterkeit in der Stimme.
Ich schaue zu Gabriele. Ihr Gesicht ist immer noch völlig versteinert. Ein Sanitäter hat ihr eine Decke übergelegt. Leichenblass steht sie da und starrt verschüchtert Kommissar Forsberg an. Ich halte weiterhin ihre Hand wie die eines Kindes.
»Soso, Single-Wanderung«, fährt der Hauptkommissar mit deutlich abschätzigem Ton fort, während er unsere Versionen der Geschichte und die Personalien aufnimmt.
»Kultur-Single-Wanderung«, korrigiere ich, als würde das einen Unterschied machen. Zweifellos hat das nun einen seltsamen Beigeschmack. Dass eine solche Wanderung auf diese Weise endet, damit hätte wohl niemand gerechnet. Die anderen Singles haben später am Ufer alle miteinander keinen guten Eindruck gemacht. Der Schock über den unerwarteten Fund saß bei allen tief. Einige konnten sich nur schwer beruhigen und wurden von den Sanitätern erstversorgt.
Eben wurde die Gruppe von der Polizei entlassen und mit Taxis nach Mettlach zurückgebracht. Nur Herr Mann, der Fährmann, Gabriele und ich sind als Hauptzeugen für Rückfragen der Kripo vor Ort verblieben.
Es ist schon weit mehr als eine Ironie des Schicksals, dass ich auf einer Single-Wanderung statt einer erfreulichen Männerbekanntschaft, wie sie mir Frau Tietze-Meiermann ans Herz gelegt hat, eine – und das muss mir meine Therapeutin zugutehalten, wenigstens männliche – Leiche aus dem Wasser fische. Wobei man von herausfischen in Wahrheit nicht sprechen kann. Fatalerweise, denn genaugenommen hatten wir beim Eintreffen von Polizei und Kripo einzig eine Jacke und eine ziemlich verrückte Geschichte vorzuweisen. Die dazu passende Leiche fehlte, auch wenn hier jeder unterschreiben würde, dass Siegfried Brokatt, den wir nur für wenige Sekunden zu Gesicht bekamen, mit hundertprozentiger Sicherheit tot war.
Herr Forsberg scheint nicht an unserer Aussage zu zweifeln. »Auch wenn wir die Leiche noch nicht haben, die Bereitschaftstaucher und die Wasserschutzpolizei sind schon auf dem Weg. Sie werden die Saar gezielt absuchen. Ich bin mir sicher, man wird schon sehr bald fündig werden.«
Um diesen Job beneide ich die Taucher nicht.
»Nach Ihrer Beschreibung, Frau Wallenstein, konnten Sie keine Verletzungen erkennen?«
»Nein«, erwidere ich.
Herr Mann stimmt mir zu. »Da war nichts zu sehen.«
»Ist Ihnen sonst noch etwas Ungewöhnliches aufgefallen, das uns weiterhelfen könnte?«, fährt der Kommissar mit seiner Befragung fort.
Wir sehen uns schulterzuckend an. Nein! Ungewöhnlich war das Ganze, ohne Zweifel, aber über das bisher Gesagte hinaus weiß niemand von uns noch etwas zu berichten, womit sich die Vernehmung dem Ende zuneigt. Die allerletzte Frage des Kommissars bringt mich jedoch ins Stutzen.
»Sind Sie denn wenigstens fündig geworden auf Ihrer Single-Wanderung?«, fragt Herr Forsberg scharfzüngig, beinahe bissig. Er wartet unsere Antwort nicht ab, sondern klappt sein Notizbuch zu. »Danke für Ihre Unterstützung! Bitte halten Sie sich in den nächsten Tagen für weitere Fragen zur Verfügung«, beendet er das Verhör routiniert. Allem Anschein nach hat es der Kommissar eilig. »Eine Menge Krankmeldungen und viel zu tun heute«, murmelt er beiläufig und lässt uns mit diesen Worten stehen. Auf dem Weg zu seinem Dienstwagen stoppt Forsberg bei einem Kollegen mit der Bitte, man solle ihn umgehend informieren, wenn es etwas Neues geben sollte. Dann fährt er davon, und ich stelle fest, dass Gabrieles Griff sich wieder lockert. Die Anwesenheit des Hauptkommissars hat sie, so scheint es, weitere Nerven gekostet.
Mehr als ratlos bleiben wir drei zurück. Wie geht man nach einem solchen Erlebnis wieder zur Tagesordnung über? Keine Ahnung. So recht weiß anscheinend niemand von uns, was jetzt das Richtige wäre. Sprachlos stehen wir uns gegenüber.
Herr Mann findet zuerst die Fassung wieder. »Soll ich Sie nach Mettlach fahren, damit Sie nach Hause können?«, bietet er uns an. Der Kommissar hatte dem Fährmann eben mitgeteilt, dass die Fähre für den Rest des Tages geschlossen bleibt, damit Spurensicherung und Taucher das Boot nach möglichen Hinweisen absuchen können. »So wie es aussieht, gibt es heute keine Überfahrten mehr«, stellt Herr Mann mit einem Schulterzucken fest. »Das heißt, ich habe Zeit.«
Wir nicken dankbar. Während der Fährmann seinen Wagen holt, stehe ich mit Gabriele am Ufer und blicke flussabwärts zur Saarschleife. Für heute hat sie ihren Zauber verloren. Da fällt mir etwas ein. »Moment«, sage ich zu Gabriele. Ich lasse ihre Hand kurz los und gehe Richtung Steg. »Ich muss noch was holen. Bin gleich wieder da.«
»Entschuldigung, ich habe auf der Fähre meinen Rucksack vergessen«, erkläre ich den beiden jungen Polizisten, als ich näher trete. Sie sperren den Ort in diesem Augenblick ab.