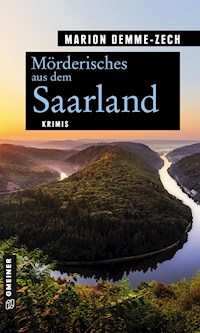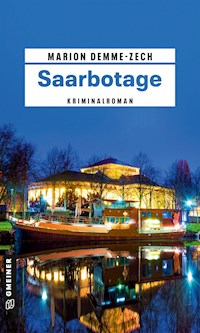
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Wolfgang Forsberg
- Sprache: Deutsch
Ein Anschlag bei einem Saarbrücker Volksfest ruft die Kommissare Antonia Kuppertz und Wolfgang Forsberg auf den Plan. Ein Artist wird von einer Drohne attackiert und stürzt metertief in die Saar. Nur mit viel Glück überlebt er. Weitere Attentate machen mehr als deutlich: Der Verbrecher kennt keinerlei Skrupel. Als der Saboteur sogar Kommissar Forsberg ausschaltet, muss seine Kollegin Antonia ungewöhnliche Wege gehen. Auf der Jagd nach dem Täter besucht sie mit dem eigensinnigen Dackel Günther die Polizeihundestaffel und kommt dem Attentäter gefährlich nah. Zu nah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Demme-Zech
Saarbotage
Kriminalroman
Zum Buch
Finstere Pläne Eine Reihe von kuriosen Anschlägen im Saarland gibt den Kommissaren Antonia Kuppertz und Wolfgang Forsberg Rätsel auf. Ob nun bei einem Saarbrücker Volksfest, dem Stadtlauf in Dillingen oder beim Dreh eines Saarkrimis an der Daarler Brücke in Saarbrücken, der Saboteur zeigt sich äußerst fantasievoll bei seinen Attacken. Richtig brenzlig wird es für die beiden Kommissare, als ein vergifteter saarländischer Krimmelkuchen sie von Jägern zu Gejagten werden lässt. Mit einem Mal findet sich Wolfgang Forsberg auf der Intensivstation des Krankenhauses wieder und Antonia Kuppertz steht vollkommen allein da. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen und heftet sich mit dem eigenwilligen Dackel Günther an die Fersen des Serientäters. Fast sieht es aus, als wäre er so gut wie gefasst. Da allerdings wendet sich das Blatt …
Die Saarländerin Marion Demme-Zech studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und ein bisschen Bauingenieurwesen. Als Autorin startete sie mit pädagogischen Autorenbeiträgen für diverse Verlage, einige Jahre später entdeckte sie ihre kriminelle Ader. Zuerst mit einer Reihe von Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien, 2020 erschien schließlich ihr erster Kriminalroman. Wenn Sie nicht gerade Morde »anzettelt«, widmet sie ihre kreative Zeit auch gerne ungewöhnlichen Reiseführern und Gesellschaftsspielen über ihre Heimat.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Petair / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7036-3
Zitat
»Nein, nein. Die Abenteuer zuerst, Erklärungen nehmen solch eine schreckliche Zeit in Anspruch.«
Lewis Carroll
Gluck-Gluck-Gluck
Antonia Kuppertz
Tbilisser Platz, Saarbrücken. 7. August um 18:11 Uhr
Wo bleibt Wolfgang bloß? Es ist schon gute 20 Minuten her, dass ich meinen Kollegen angerufen habe. Nervös knabbere ich an meiner Unterlippe.
Um mich herum, auf dem Tbilisser Platz vor dem saarländischen Staatstheater, wird es immer enger. Die Musik, die von der Bühne herüberschallt, ist ohrenbetäubend. Überall sind Stände aufgebaut, überall drängen sich Menschen. Jugendliche, Familien, Senioren – es ist ein einziges Gewimmel.
Ein schöner Mist, urteile ich. In manchen Jahren gab es an die 300.000 Besucher. Einen besseren Ort und eine passendere Zeit als den Samstagabend hätte er sich nicht aussuchen können.
Ich schaue erneut auf mein Smartphone. Nichts! Wenn Wolfgang nicht bald auftaucht, muss ich das allein erledigen. Nochmals lasse ich ihn nicht entwischen.
Da endlich sehe ich Wolfgang. Mein Kollege kommt über die alte Brücke auf mich zu. Wahrscheinlich hat er irgendwo oben am Schloss geparkt, was heute Abend eine echte Herausforderung gewesen sein dürfte. Ich gehe ihm durch das Getümmel entgegen.
»Mensch, Toni. Ich war schon auf Höhe Völklinger Hütte, als dein Anruf kam«, legt er sofort los. »Bist du dir sicher, dass das Schreiben von Mister Surprise ist? Wir haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Das Attentat auf der Burg Dagstuhl dürfte fast ein Jahr her sein.«
»Schau es dir selbst an«, erwidere ich und halte Wolfgang das Handy mit dem Foto vom Brief entgegen. Das Original liegt bereits bei Chris, dem Leiter der Spurensicherung, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass der Verfasser uns auf dem Blatt irgendwelche Hinweise hinterlassen hat. So dumm ist der Kerl nicht.
GLUCK-GLUCK-GLUCK
Mehr steht da nicht auf dem Stück Papier, das am Mittag, als ich nach der Dienstbesprechung wieder in mein Büro kam, auf dem Schreibtisch lag. Die Großbuchstaben sind von Hand geschrieben. In einer recht unbeholfenen Schrift.
»Das ist Mister Surprise. Er plant wieder irgendeinen Sabotageakt – gar kein Zweifel!«
Wolfgang schaut sich das Bild auf meinem Handy genau an, während ich darüber nachdenke, dass es nicht leicht sein wird, den Verfasser der Nachricht hier in der Menge zu entdecken. »Möglicherweise sollten wir die SEKler dazu rufen und den Platz räumen lassen.«
»Toni, du weißt schon, dass das lediglich drei Worte sind. Das ist das dritte Mal im letzten halben Jahr, dass du Alarm schlägst, weil du dir sicher bist, Mister Surprise sei wieder am Werk.«
»Ich hab ein komisches Gefühl. Das ist wie ein Déjà-vu. Genau so hat es mit dem Psycho jedes Mal angefangen. Mit einem Rätsel und kurz darauf ging der Ärger los.« Während ich das sage, wandert mein Blick über die Menschenmenge. Mittlerweile drängen sich die Besucher des beliebten Saarbrücker Volksfestes dicht an dicht.
»›Gluck-Gluck-Gluck!‹ Das ist kein Rätsel! Prinzipiell kann das alles Mögliche bedeuten. Es heißt weder, dass das Schreiben von ihm sein muss, noch, dass es heute genau an diesem Ort einen Anschlag geben wird.« Ich setze an zu antworten, doch Wolfgang gibt mir keine Gelegenheit. »Vielleicht ist das einfach ein Dumme-Jungen-Streich. Sollen wir deswegen eines der beliebtesten Feste des Landes aufmischen?« Wolfgang stockt und blickt mich ernst an. »Und das einzig und allein mit der Begründung, dass du ein komisches Gefühl hast.«
»Okay, okay, ich verstehe ja, was du mir sagen willst. Aber was, wenn ich recht habe, und wir haben nichts unternommen? Schau dich um, so viele Menschen, die alle gekommen sind, um ein paar schöne Stunden zu verbringen. Willst du das Risiko eingehen, dass einige davon die Heimreise nicht mehr antreten? Hast du die vielen Kinder gesehen?«
Wolfgang atmet schwer aus und schüttelt den Kopf. »Mensch, Toni! Was meinst du, was wir zu hören kriegen, wenn wir das SEK umsonst anfordern und die Veranstaltung ruinieren? Da können wir demnächst die Akten im Archiv ordnen.«
Ich lege die Stirn in Falten. Wolfgang hat nicht ganz unrecht. Dennoch gebe ich nicht auf: »Mister Surprise hat seine Taten vorab immer angekündigt, und immer waren es solche rätselhaften Botschaften. Das kannst du nicht abstreiten.«
»Das stimmt.« Wolfgang reibt sich mit seiner Hand über den Vollbart. »Ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich und außerdem: Das Sicherheitskonzept vor Ort ist extrem ausgereift, das hast du in den letzten Wochen selbst mitbekommen. Eine Menge Kollegen sind heute Abend im Einsatz und halten die Augen offen. Außerdem Feuerwehr, THW, Malteser und obendrein ein Riesentrupp privater Sicherheitsleute. Sogar ein extra Funknetz gibt es, mit dem alle dauerhaft in Verbindung stehen. Über 800 Personen, die einzig und allein für die Sicherheit der Besucher verantwortlich sind, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Das ist eine Menge. Überall stehen Betonwände und mobile Sperren. Die Eingänge sind bewacht …«
»Das weiß ich, Wolfgang.«
»Was die Sicherheit angeht, ist man quasi auf den Empfang der Queen vorbereitet.«
»Aber möglicherweise nicht auf die schrägen Ideen von Mister Surprise.«
Wolfgang stöhnt und nimmt sein Handy aus einer der hinteren Hosentaschen. »Ich kann dir sagen … Gabriele reißt mir den Kopf ab. Eigentlich wollten wir heute Abend essen gehen, und ich war sowieso schon spät dran. Den Tisch für das Romantikdinner auf dem Linslerhof habe ich vor Wochen reserviert.«
Na toll! Wenn ich eins nicht will, dann ist es, die Beziehung zwischen Wolfgang und Gabriele durcheinanderzubringen, die zurzeit wieder halbwegs repariert scheint. Schlimm genug, dass bei mir jede Liaison im Chaos endet, da wäre es wenigstens nett zu sehen, dass es woanders im Großen und Ganzen funktioniert. »He, stopp!«, sage ich deshalb. »Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Fahr nach Hause, ich seh mich allein um.«
»Jetzt ist es so oder so zu spät«, wendet Wolfgang ein und hält sich das Smartphone ans Ohr. »Hallo, Gabriele. Schatz, es wird ein bisschen …« Weiter kommt er nicht. Klar erkennbar wurde am anderen Ende aufgelegt. »Super!«, brummt Wolfgang.
»Verdammt! Tut mir echt leid.«
Wolfgang steckt sein Handy zurück in die Jeans. »Genug geredet, schauen wir uns um. Falls du falschliegst, spendierst du den Riesenblumenstrauß, den es jetzt mindestens braucht, um das jemals wieder in Ordnung zu bringen.«
Dazu bin ich gerne bereit. Das wäre mir weit lieber, als richtigzuliegen. Beide gehen wir die alte Sandsteintreppe zu den Saarwiesen hinunter. Ich werde Gabriele später erklären, dass das alles allein meine Schuld gewesen ist. Jetzt kontrollieren wir erst einmal das Gelände. Das ungute Gefühl in meinem Bauch will nicht verschwinden. »Am besten fangen wir auf der Festwiese an«, schlage ich vor. »Gegen acht tritt der Top Act auf. Irgendein Fast-Superstar-Gewinner oder so.«
Knappe zwei Stunden später, in denen wir uns beinahe ausnahmslos durch dichte Menschenmengen gezwängt haben, stehen wir etwas abseits am Saarufer, nahe der Römerbrücke, und blicken über das belebte Gelände. Ich fühle mich mies. Richtig mies sogar.
»Bist du immer noch davon überzeugt, dass Mister Surprise hier seine üblen Spielchen treiben möchte?«, fragt Wolfgang ziemlich angesäuert.
Ich antworte nicht. Was soll ich sagen? Wie es scheint, habe ich überreagiert.
»Nimm mir das nicht krumm, Toni, aber vielleicht wären ein paar Tage Urlaub, schlicht und einfach zum Ausspannen, nicht das Dümmste.« Er schaut mich auf diese väterlich besorgte Weise an, die ich so gar nicht mag. »Wie viele Überstunden hast du denn diese Woche gemacht?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung«, lüge ich. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich viel zu viel Zeit auf der Arbeit verbringe. Aber zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf, seit Harald nicht mehr da ist.
»Vielleicht verabredest du dich mal wieder. Das wäre doch gar nicht so …«
»Und vielleicht kümmerst du dich einfach mal um deine eigenen Angelegenheiten«, sage ich schärfer als beabsichtigt. Ich hasse es, wenn man sich in mein Leben einmischt.
»War ja nur so ein Gedanke«, erwidert Wolfgang. »Dafür muss man nicht gleich in die Luft gehen. Am besten wechseln wir das Thema. Okay?«
Ich nicke.
»Du stimmst mir sicher zu, dass wir hier auf dem Fest nichts Außergewöhnliches entdecken konnten?«
Ich nicke noch mal.
»Demnach hatte ich recht: Die Zeiten von Mister Surprise sind passé. Ich verstehe wirklich, weshalb du überreagiert hast. An dem Abend in Dagstuhl, als Mister Surprise diese Riesenmenge an Sprengstoff auf dem Dixi-Klo deponiert hatte, war es verdammt knapp. Das ist gerade noch mal so gutgegangen. Obwohl es schon ein Jahr her ist, träume ich heute noch davon und wache manchmal nachts schweißgebadet auf.« Mit heiserer Stimme spricht er weiter. »Hättest du mich nicht in letzter Sekunde gerettet, würde ich jetzt nicht hier stehen. Das weiß ich sicher. Ich bin dir was schuldig.«
»Unsinn«, antworte ich. »Du hättest das Gleiche für mich getan.«
»Ich hoffe, ich hätte den gleichen Mumm wie du. Aber das kann man nie wissen, wenn es um Leben und Tod geht. Was ich jedoch damit sagen wollte, ist, dass man so ein Erlebnis, selbst als Profi, nicht einfach so vergisst. Das steckt uns beiden in den Knochen. Trotzdem solltest du dir bewusst machen: Die Sache ist vorbei. Bei seinem letzten Anschlag hätten wir Mister Surprise beinahe geschnappt. Er ist dem SEK fast in die Arme gelaufen und nur um Haaresbreite entkommen. Seitdem ist Funkstille. Seit einem guten Jahr. Vermutlich ist ihm die Sache schlichtweg zu heiß geworden.«
»Kann sein«, gestehe ich ein, während ich meinen Blick auf die Saar richte, die, seitdem die Dunkelheit eingesetzt hat, in buntes Licht getaucht ist. Ebenso wie die Römerbrücke und die Uferpromenaden auf beiden Seiten. Alles völlig friedlich. Wolfgang hat vermutlich recht mit allem, was er sagt.
Während ich noch über Wolfgangs Worte nachdenke, merke ich, dass mir jemand seine Hand auf die Schulter legt. »Toni?«, fragt eine Männerstimme.
Überrascht drehe ich mich um. Wolfgang hat den Neuankömmling offenbar schon erkannt und begrüßt ihn mit: »Ach, Jan-Alexander. Hi. Ewig nicht mehr gesehen.«
Nun kann ich den athletischen und bestimmt fast zwei Meter großen Mann auch zuordnen. Es ist Dannhäuser, einer der Gruppenführer bei den Saarbrücker SEKlern. Wie es aussieht, ist er mit Freunden auf dem Fest unterwegs.
»Definitiv! Ist schon etwas her unser letztes Zusammentreffen. War das nicht damals in Dagstuhl bei der Aktion mit diesem Psycho, als dir das Dixi fast um die Ohren geflogen ist?« Dannhäuser lacht. »Wie hieß der Kerl noch?«
»Mister Surprise«, antworte diesmal ich. Dannhäuser war bei diesem Einsatz an der Burg mit seinen Kollegen keine enorme Hilfe gewesen. Er hat Mister Surprise entkommen lassen, was ihn damals nicht darin hinderte, weiter großspurig Sprüche zu reißen.
»Kein Wunder, dass wir uns länger nicht gesehen haben, bei den großen Aktionen sind schließlich meist nur wir vom SEK gefragt«, sagt er zu Wolfgang und stemmt seine Hände in die Hüften. Er hat sich offenbar kein bisschen verändert. Das angeberische Achselshirt lässt die muskulösen Arme und die breite Brust unverhüllt. »Heute allerdings bin ich in privater Mission unterwegs.« Nachdem er das gesagt hat, wandert sein Blick zu mir. Für meinen Geschmack bleibt er viel zu lange haften. »Und ihr so?«
»Auch rein privat«, schwindelt Wolfgang. »Ein Feierabendbier unter guten Kollegen.«
»Klasse. Dann kann ich euch ja was ausgeben. Einen Sekt vielleicht?«
»Schade«, beeile ich mich zu sagen. »Aber leider wollten wir in der Sekunde nach Hause gehen. Ich bin todmüde. War ein langer Tag.«
»Sehr, sehr schade. Vielleicht bei anderer Gelegenheit?« Dannhäuser zwinkert mir zu, und Wolfgang grinst. Das sehe ich aus dem Augenwinkel.
»Mal schauen.« Ich gebe mir Mühe, betont kühl zu klingen. Es zeigt Wirkung. Endlich verabschiedet sich die Clique. Ich kenne Wolfgang, er wird gleich seine dummen Sprüche reißen. Also nehme ich ihm vorab den Wind aus den Segeln: »Gnade, Wolfgang. Was immer du sagen willst, behalte es bitte einfach für dich! Der Abend war so oder so schon blöd genug. Echt!«
Als ich in seine gut gelaunte Miene blicke, ist mir klar, dass er sich die Chance nicht entgehen lassen wird. »Ach Mensch, und dabei hätte der Abend doch so schön enden können«, behauptet er, und das Grinsen in seinem Gesicht wird noch breiter. »An Gelegenheiten für Verabredungen fehlt es dir jedenfalls nicht.«
»Pff.« Mehr sage ich nicht und verdrehe die Augen. Nach dem Ehefiasko mit Harald, der mich gleich mehrfach hintergangen hat und ein selbstgefälliger Egomane war, ist mein Bedarf an Idioten für Jahrzehnte gedeckt. Von Männern lasse ich zukünftig meine Finger.
Aber Wolfgang hört nicht auf. »Rein optisch ist er doch ein Hingucker, dein Jan-Alexander. Du darfst halt keine Unterhaltung mit ihm führen, Abstriche muss man immer machen. Und das Alter passt auch prima, Mitte 30. Ein Prachtkerl in den besten Jahren. Was meinst du, wie sich deine Mutti freuen würde, wenn du mit lauter süßen kleinen Jan-Alexanders in Achselshirts daherkämst?«
»Wolfgang, hör auf, das will ich mir gar nicht vorstellen.«
»Und ein paar süßen Tonis natürlich auch.«
»He, es reicht!«, warne ich ihn.
Tatsächlich gibt er klein bei. »Ist ja gut! Ein bisschen verstehe ich dich sogar. Dannhäuser wäre auch nicht mein Typ. Dann schlage ich vor, wir zwei machen uns jetzt wirklich auf den Heimweg.«
»Mir recht, ich habe hinten am Theater gepar…«, setze ich an zu antworten, da übertönt mich die Stimme des Ansagers: »… und nun folgt eine spektakuläre Darbietung mit einem echten Düsenjäger«, preist der Moderator der Veranstaltung, dessen blecherne Stimme das ganze Gelände beschallt, den nächsten Programmpunkt an. Im Moment steigen die Fackelschwimmer aus dem Wasser. »Es erwartet Sie eine nie dagewesene, phänomenale Show mit einem Flyboard Air. Nervenkitzel und Wasserspaß pur. Bis zu 15 Meter hoch und mit mehr als 50 Stundenkilometern wird unser legendärer Wasserartist mit Düsenantrieb über die Saar fliegen.« Gegen Ende wird die Stimme des Moderators noch schriller. »Bitte einen tosenden Applaus für Monsieur de la Lune, den Starartisten aus Frankreich.«
Die Menge macht, was ihr aufgetragen wird. Erst folgt jubelnde Beifallsbekundung, dann wird es deutlich stiller. Auf dem Wasser tut sich was. Alle recken gespannt ihre Hälse.
»Hört sich spannend an! Ich würde sagen, das schauen wir uns noch an und dann ist Feierabend«, sagt Wolfgang und weist mit dem Finger auf einen sich auf dem Wasser nähernden Jetski. Das dahinter, mit den bunten Streifen und dem schwarzen Neoprenkomplettanzug, scheint der angekündigte Flyboardartist zu sein. Er schwebt vier, fünf Meter über dem Wasser und zündet in dieser Sekunde eine orangefarbene Rauchfackel. Der Nebel, die mehrfarbige Beleuchtung und dahinter einfach nur Dunkelheit – ein bizarrer Anblick.
»Erinnerst du dich an das Hoverboard von Marty McFly in ›Zurück in die Zukunft‹? Das war so ähnlich. Nicht übel die Nummer.«
»Ja. Richtig«, antworte ich nicht ganz so euphorisch. Meine Stimmung ist und bleibt im Keller.
»Zieh bloß nicht so ein Gesicht«, fordert mich Wolfgang mit einem breiten Lächeln umrahmt von seinem dunklen Vollbart auf. »Du brauchst doch keine Trübsal zu blasen, nur weil du mir und Gabriele den seit Wochen geplanten romantischen Abend ruiniert hast. So was machst du doch hobbymäßig.«
Ich schlucke herunter, was mir Freches auf der Zunge liegt. Leider hat Wolfgang völlig recht. Ich habe den beiden den Abend verdorben. Also halte ich mich zurück.
Aber Wolfgang gibt den Versuch nicht auf, mich auf seine ganz spezielle Art aufzumuntern, obwohl er eigentlich stinksauer sein müsste. »Wahrscheinlich muss ich heute Nacht in der Garage schlafen. Oder draußen im Gartenhaus, direkt neben dem Rasenmäher.«
»Freunde wie dich braucht man«, kontere ich. Sich mit Wolfgang zu kabbeln macht Spaß, weil es ohne einen Funken Feingefühl funktioniert. Also setze ich noch eins drauf. »Sei doch ehrlich, du bist nicht gerade der gefühlvolle Robert-Redford-Typ, der den ganzen Abend ein Kompliment nach dem anderen raushaut. Hundertpro habe ich Gabriele eine enorme Enttäuschung erspart.«
»Pah. Hast du eine Ahnung. Wenn du wüsstest, wie …« Wolfgang verstummt. Irgendetwas am Himmel zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. »Verdammt!«, zischt er.
»Was ist passiert?«, will ich wissen und wende meinen Kopf ebenfalls nach oben. »Oh mein Gott!« Jetzt sehe ich es auch. Der Artist auf dem Board schwebt hoch in der Luft und kämpft mit dem Gleichgewicht. Er wankt gefährlich hin und her. In das Rauschen der Triebwerke hat sich ein Surren gemischt. Ich erkenne nichts Genaues, nur vier kleine, leuchtend rote Punkte. Aber der Ton ist prägnant. Dort oben fliegt eine Drohne, und wie es aussieht, attackiert sie den Flyboardartisten.
Als der Artist nach vorn kippt und mit seinem Board geradewegs in die Tiefe stürzt, geht ein Raunen durch das Publikum.
»Warum hilft ihm keiner? Ich kann gar nicht hinschauen«, murmelt eine Frau neben mir.
Als schon kaum Hoffnung mehr besteht, dass die Sache glimpflich ausgehen wird, gelingt es dem Stürzenden, sich mit einem beherzten Schwung aus der Hüfte wieder aufzurichten. Unfassbar, er hat die Kontrolle über das Board zurückerlangt. In einer langen Kurve fliegt er dicht über der Wasseroberfläche und erneut hinauf in die Höhe. Einige Leute klatschen und pfeifen laut. Womöglich vermuten sie, das gehöre zur Show. Aber ich glaube das nicht.
Mir bleibt fast die Luft weg, als ich erkenne, wie die vier roten Punkte der Flugdrohne zum zweiten Mal auf den Mann zusteuern.
Wolfgang zieht mich am Arm. Er hat sich unter dem Absperrband in Richtung Saarufer hindurchgezwängt. »Das geht nicht gut! Beeil dich, Toni.«
Ich folge ihm, ohne den Artisten aus den Augen zu lassen. Ich habe ebenfalls kein gutes Gefühl.
Mit einem röhrenden Geräusch fliegt die Drohne erneut auf den Flyboardfahrer zu. Dieses Mal mit neuem Ziel. Mit voller Wucht knallt sie gegen den Helm des Fahrers und nun gibt es kein Halten mehr. Der Artist stürzt schnurgerade in die Tiefe. Nach dem dumpfen Klatschen, als er die Oberfläche durchdringt, erobert sich das verdrängte Nass seinen Raum wieder zurück. Es rauscht und wirbelt. Luftblasen steigen gluckernd auf und werden weniger. Die stockfinstere Saar hat den Mann verschluckt.
Rein gar nichts mitbekommen
Eine Person
Landtagsgebäude, Saarbrücken, 7. August um 22:08 Uhr
Ich schließe das Fenster zur Straßenseite im ersten Obergeschoss.
Schade, denke ich mit Blick auf den malträtierten Quadrocopter und lege ihn zurück in den schwarzen und gewissenhaft ausgepolsterten Alukoffer, der auf dem Tisch vor mir bereitsteht. So wie es aussieht, hat die Kamera einen Schlag abgekommen. Bedauerlich um das gute Stück, trotzdem hat sich der Einsatz gelohnt. Die Aufnahmen sind vermutlich vom Feinsten. Ein Jammer, dass ich das Video nur für mich selbst verwenden kann. Im Netz würde es viral gehen, bombensicher. Aber was nicht drin ist, ist nicht drin. In jedem Fall ist es in diesem Jahr ausnahmsweise ein hübsches Spektakel, auch wenn ich solchen Festen normalerweise aus dem Weg gehe. Ich schließe den Deckel und lasse die Schnappschlösser zufallen. Alles erledigt!
Den Rollkoffer hinter mir herziehend, verlasse ich den Raum, der Hund folgt mir. Braves Tier, da braucht es keine Worte. Wir sind ein Team. Wie ein Schatten bewegen wir uns vorbei an der Tür zum Plenarsaal, die imposante weiße Treppe mit dem schwarzen Geländer hinab. Unten am Eingang schiebe ich den Koffer in einen kleinen Nebenraum. Den hole ich später nach Dienstschluss ab. Einen Schlüssel für das Landtagsgebäude habe ich schließlich.
Als ich durch die hohe zweiflügelige Holztür mit den Glaselementen nach draußen trete, dreht sich mein Kollege um.
Hans-Conrad ist viel zu einfältig, um etwas zu ahnen. »Ah! Da bist du ja endlich. Das war vielleicht ein langer Rundgang. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Ist drinnen alles okay?«
»Ja. Sicher«, gebe ich zur Antwort. »Nichts Auffälliges. Und bei dir?«
»Du hast ordentlich was verpasst. Typisch. Im Augenblick gibt es ein Riesenspektakel da drüben auf der Saar bei einer Wassershow.« Er zeigt auf den Fluss. Die Musik auf dem Festgelände ist verstummt. Man hört nur den Lärm vorbeifahrender Autos auf der Stadtautobahn. Blaue Lichter nähern sich. »Schaut nicht gut aus. Einer ist von so ’nem fliegenden Skateboard ins Wasser gestürzt. Der war enorm weit oben. Bestimmt 20 oder 30 Meter, oder noch mehr, und dann ist er einfach in die Tiefe gerauscht. Schwupps, weg war er. Seitdem herrscht da eine Menge Hektik. Polizei, Notarzt und so weiter. Ich hoffe nur, die finden den Kerl.«
»Ui«, gebe ich mich erstaunt. »Seltsam. Davon habe ich nichts mitbekommen.«
Pas de panique – keine Panik
Antonia Kuppertz
Saarufer Höhe Alte Brücke, Saarbrücken, 7. August um 22:08 Uhr
Mit offenem Mund starre ich auf die fast schwarze Saar, die anscheinend nicht plant, den Mann, den sie vor ein paar Sekunden verschluckt hat, wieder freizugeben.
»Dass für uns gleich Feierabend ist, nehme ich zurück«, sagt Wolfgang und wendet sich an einen der Bootsführer am Saarufer. »Sie müssten uns bitte behilflich sein.«
Noch bevor der Mann antworten kann, ist Wolfgang an Bord. »Los, Toni. Steig ein! Schnell«, fordert er mich auf, was ich tue, ohne groß nachzudenken. Das Schaukeln an Bord von Schiffen und mein Magen – die beiden Dinge harmonieren leider ganz und gar nicht. Doch egal, Notfall ist Notfall.
Die Familie des Bootsführers, die sich die Show vermutlich von der Saar aus ansehen wollte, rückt erschrocken zusammen.
»Rainer, jetzt lass endlich den Motor an«, fordert die Frau. Rainer jedoch scheint von den Ereignissen um sich herum viel zu schockiert und zu keiner Reaktion fähig, weshalb seine Frau ihn kurzerhand vom Fahrersitz drängt und selbst das Steuer übernimmt. »Festhalten!«, fordert sie. Das Motorboot nimmt rasant Fahrt auf. Es wankt unangenehm. Ich umklammere mit beiden Händen die Reling, während ich die aufsteigende Übelkeit im Zaum zu halten versuche und die Wasseroberfläche mit den Augen absuche.
Dort vorn, ein Stück flussabwärts, rund 50 Meter von der eigentlichen Showfläche entfernt, ist der Mann in die Saar eingetaucht. Als wir uns der Stelle nähern, gibt es keine Spur von ihm.
»Wahrscheinlich ist er abgetrieben«, murmelt Wolfgang neben mir. »Wir müssen weiter flussabwärts«, richtet er sich an die Frau. »Seien Sie aber bitte vorsichtig. Nicht, dass wir ihn mit dem Boot streifen.«
Was die Strömung betrifft, ist ein Fluss wie die Saar nicht zu unterschätzen, selbst für geübte Schwimmer, geht mir durch den Kopf, während ich auf die andere Seite des Bootes wechsle und dort Ausschau halte. Flüsse sind tückisch, das habe ich als Kriminalkommissarin im Rahmen meiner Ermittlungen häufiger erfahren müssen. Ich beuge mich über die Reling und gebe mir Mühe, das Schwanken des Bootes zu ignorieren.
Der Jetski-Fahrer, der den Artisten vermutlich aus Sicherheitsgründen begleitet hat, schaut sich ebenfalls aufgeregt um und ruft etwas auf Französisch. Hinter uns höre ich Motoren, die sich nähern. »Haben Sie vielleicht irgendwo eine Taschenlampe?«, frage ich die Familie.
»Ja, Sekunde«, sagt die halbwüchsige Tochter und verschwindet für einen Moment unter Deck, um kurz darauf mit einem Handscheinwerfer wiederzukommen. »Ich hoffe, die Akkus sind voll.«
»Prima. Danke!« Gottlob funktioniert die Lampe. Ich leuchte über die Wasseroberfläche. Nun rücken auch die anderen Hilfskräfte näher heran, ebenfalls mit Strahlern ausgerüstet. Aber nichts – der Artist bleibt spurlos verschwunden.
»Nicht gut«, raunt Wolfgang und fasst damit meine Befürchtungen in zwei Wörtern zusammen. Je länger es dauert, desto aussichtsloser ist so eine Suche.
»Vielleicht sollten wir noch ein Stück flussabwärts fahren«, fordere ich und deute in die von mir angepeilte Richtung. Die Dame am Steuer reagiert sofort.
Ich leuchte über den Bug hinweg in die Schwärze hinein. Da ist nichts, rein gar nichts. Nur Wasser. Wir sind schon recht weit von unserem Ursprungsort entfernt, geht mir durch den Kopf, als ich die Freitreppe der Berliner Promenade in der Ferne ausmache. Verdammt noch mal, irgendwo muss der Kerl doch sein.
»Da!«, sagt mit einem Mal der Bootsführer, der offenbar wieder zum Leben erwacht ist. »Ich glaub, da hinten ist eine Hand.« Er weist mit dem Finger auf die Stelle im Wasser und tatsächlich: Das könnte eine Hand sein. Doch was auch immer es ist, es taucht in dieser Sekunde unter.
Die Dame am Steuer nimmt Fahrt auf und hält auf den Punkt zu. Wir nähern uns. Schneller, denke ich, trotz meiner Übelkeit. Der Hilferuf einer erstickten Stimme hallt durch die Nacht: »À l’aide!«
Wolfgang hat den rot-weißen Rettungsring bereits in der Hand. »Pas de panique!«, versucht er, den Schwimmenden zu beruhigen. Als der Mann den zugeworfenen Ring zu fassen bekommt, ist an Deck ein Aufatmen spürbar.
Kurze Zeit später liegt der Flyboardfahrer erschöpft auf den feucht glitzernden Bootsplanken. Die Rettung kam keine Sekunde zu früh. Die Lippen des Mannes sehen aus, als wären sie in blaue Farbe getaucht worden.
»Wir kümmern uns um Sie. Nous vous aidons. Tout de suite«, sage ich und habe damit die wenigen Französischkenntnisse aufgebraucht, über die ich nach der Schulzeit noch verfüge. Der Mann ist unterkühlt und braucht schleunigst Hilfe.
Zum Glück sind die Rettungskräfte kurze Zeit später, als wir das Ufer erreichen, bereits vor Ort und übernehmen die Versorgung.
»Das wird wieder«, sagt der eintreffende Arzt, nachdem er sich zum Artisten hinuntergebeugt hat. »Sie sind in guten Händen.«
Ich bin erleichtert. Zum einen, dass wir den Mann gefunden haben, aber auch, dass ich festen Boden unter meinen Füßen spüre. Als die Sanitäter den Artisten auf einer Trage in Richtung Krankenwagen abtransportieren, kommen Kollegen auf uns zu. Diesmal sind wir die Zeugen. Ein komischer Rollentausch, denke ich, während wir alles Beobachtete zu Protokoll geben.
Etwa eine Stunde später werden wir entlassen. Was für eine verrückte Nacht, sage ich mir, als ich mit Wolfgang allein am Ufer stehe und die seltsamen Ereignisse Revue passieren lasse. »Was denkst du?«, frage ich ihn. »Du glaubst jetzt doch auch, dass Mister Surprise zurückgekehrt ist, oder?«
Wolfgangs Blick ist starr auf die Saar gerichtet, wo für heute Abend keine Show mehr zu erwarten ist. Die Reihen haben sich nach dem Vorfall schnell gelichtet, und die Musik und der Lärm sind weitgehend verstummt.
»Na ja«, beginnt Wolfgang. Er sieht mitgenommen aus. »Was die Sabotage mit der Drohne angeht, hattest du das richtige Gefühl. In jeder Hinsicht. An die Version mit Mister Surprise glaube ich trotzdem nicht. So eine Flugdrohne bekommen eine Menge Kinder und Jugendliche zu Weihnachten geschenkt, die kosten heute nicht mehr viel. Wahrscheinlich wollte sich ein Halbwüchsiger wichtigmachen und hatte keine Ahnung, was er damit anrichten würde.«
»Na ja, das finde ich allerdings eher …«
Wolfgang wendet den Kopf und zieht beide Augenbrauen hoch. Ich breche den Versuch ab, ihn von meiner Meinung zu überzeugen. Wenn Wolfgang und ich eins gemeinsam haben, dann sind es unsere Dickschädel. Für heute Abend fehlt mir die Kraft für weitere Diskussionen. Das klären wir morgen. Deshalb sage ich bloß: »Weißt du was, Wolfgang? Ehrlich gesagt hätte ich rein gar nichts dagegen, wenn du – ausnahmsweise – recht behältst.«
Eine Extraportion saarländische Tradition Teil I
Eine Person
Irgendwo im Saarland, 8. August um 15:17 Uhr
Einen saarländischen »Krimmelkuchen« habe ich noch nie gebacken. Das ist Neuland für mich. Ich lese mir das Rezept abermals durch. Alle Zutaten stehen auf der Arbeitsplatte bereit, zusammen mit dem neuen Handrührer und der silbernen Schüssel.
»Wenn Sie so etwas eher selten machen, reicht ein Handrührgerät völlig aus«, hat mir die Verkäuferin im Elektroladen vor ein paar Tagen geraten, und ich habe genickt. Was heißt hier selten, dachte ich mir. Es ist zwar das erste Mal, dass ich backe. Was den Rest des Vorhabens angeht, bin ich aber kein Laie. Das dürften meine beiden Freunde, für die ich die Überraschung vorbereite, mittlerweile wissen.
Ein Paket Mehl, einen zerbröselten Würfel Frischhefe, einen Becher lauwarme Milch. Dazu kommt ein Löffel vom bereits abgewogenen Rohrzucker. Der karamellisiere besser, hat mir der Mitarbeiter im Supermarkt verraten. Ziemlich seltsam, dass er mich so offenkundig gemustert hat. Als hätte er etwas von meinen Plänen geahnt. Darum würde ich mich später kümmern.
Ich werfe einen Blick in die Schüssel. Das Gemisch sieht nicht aus wie Teig, zumindest nicht wie die, die ich aus den Backsendungen im Fernsehen kenne. Vielleicht nach dem Umrühren, hoffe ich und schiebe den Stecker des Handmixers in die Steckdose.
RASTEN SIE DIE KNETHAKEN EIN – STUFE 2 – FUENF MINUTEN.
Ich stelle die Eieruhr ein. Dann schalte ich den Handrührer an. Die Knethaken wirbeln los und ich stecke sie in die Masse. Teigstücke jagen aus der Schüssel an meinem Kopf vorbei und landen auf der Arbeitsplatte, der Fensterscheibe und natürlich auch auf dem Boden. Ein einziges Chaos, trotzdem halte ich durch. Fünf Minuten Stufe 2. Ich hoffe, es bleibt noch etwas in der Schüssel. Ein schöner Mist, hätte mir jemand vorab verraten, welche Sauerei so ein bisschen Backen verursacht, hätte ich mir eine andere Überraschung ausgedacht.
Kurz vor Ablauf der Zeit habe ich den Dreh raus. Man darf die Rührer nicht anheben. Warum hat mir das niemand gesagt? Das war Unterlassung oder – und das glaube ich viel eher – volle Absicht!
Ich blicke auf das Blatt.
LASSEN SIE DEN TEIG GEHEN: 20 MINUTEN: ZUGEDECKT:
Aber womit? Das steht wieder nirgendwo. Jemand hat sich einen Spaß daraus gemacht, unvollständige Informationen zu veröffentlichen. Das ist Schikane.
Ich schaue mich um und überlege. Die Tageszeitung muss herhalten. Die mit den Nachrichten von dem Chaos an der Saar. Ich lege sie obenauf, wird schon passen, entscheide ich.
Während der Teig »geht«, so steht es in der Anleitung, reinige ich die Knethaken unter heißem Wasser. Mit einem guten Schuss Spülmittel. Was für eine Schmiererei. Die Masse ist wie Kaugummi, kaum ist sie von den Haken gelöst, klebt sie auch schon am Topfreiniger oder an meinen Fingern. Klebriges mag ich nicht. Ich werfe den Schwamm kurzerhand in den Mülleimer und wasche mir die Hände mit purem Spülmittel. Es klebt weiterhin, erst mit dampfendem Wasser löst sich der Teig von meiner Haut.
Ein Blick auf die Uhr verrät: noch elf Minuten.
Nun gut. Ich gehe ins Wohnzimmer und nehme mir die Fernbedienung. Der Hund liegt im Korb und hebt kurz seinen Kopf. Der Fernseher klickt und der Bildschirm wird hell.
Nachrichten.
»Muss nicht sein« murmele ich in Richtung Hund. »Das tun wir uns nicht an. Oder? Ist viel zu schlimm, was auf der Welt passiert.«
Ich schalte um. Ah, Küchenschlacht. Das passt doch wunderbar. Uns bleiben fünf Minuten. Dort gibt es heute Krimmelkuchen – was für ein Zufall.
Azubi – und das in meinem Alter
Günther, der Dackel
In einem Mehrfamilienhaus, Tholey, 8. August um 15:42 Uhr
»Prima, dann ist das abgemacht. Günther lebt die Woche über, bis der Kurs zu Ende ist, bei mir und Gabriele.«
»Okay, Wolfgang. Und du denkst nicht, dass er für die Ausbildung ein bisschen zu alt ist?«
»Ne! In seinem Fall sind das spezielle Umstände, schließlich haben wir sein Talent erst spät entdeckt. Das ist alles längst mit den Zuständigen im Präsidium geklärt. Die machen eine Ausnahme. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass die wirklich nur die Besten aufnehmen, Siggi?«
»Ja. Hast du. Also gut, hoffen wir, er hat ein bisschen Spaß dabei.«
»Ach, sicher, hier ist er doch komplett unterfordert. Das ist eine Riesenchance für den Jungen.«
»Wenn du meinst …«
»Unbedingt! Er wird aufblühen unter all den anderen.«
»Na, ich bin gespannt. Ein bisschen störrisch kann er ja manchmal sein.«
»Das gewöhnt er sich dort ab. Dann sehen wir uns morgen gegen halb sieben?
»Halb sieben. Echt? Das wird ihm nicht schmecken.«
»Jetzt komm aber! Um die Zeit habe ich längst meine Joggingrunde hinter mir. Du und Hanne, ihr lasst euch zu sehr von dem Kerlchen auf der Nase herumtanzen. Dieses ganze Verpäppeln ist nicht gut. Und außerdem: Das Aufstehen wird wohl von allem, was ihn die kommenden Wochen erwartet, die leichteste Übung sein.«
»Das sagst du so.«
»Du wirst dir doch von so einem Vierbeiner nicht die Butter vom Brot nehmen lassen! Zeig mal, wer bei euch die Hosen anhat.«
»Ist ja gut! Ich krieg das hin! Morgen früh ist er pünktlich fertig, gestriegelt und abfahrbereit, keine Sorge.«
»Und er soll vorab nicht so viel futtern. Mit vollem Bauch kann man nicht gut trainieren …«
Nicht dass das Gequatsche von wegen verzogen und verhätschelt nicht schon eine einzige Taktlosigkeit gewesen wäre, seit der Punkt Verpflegung zur Sprache gekommen ist, habe ich die Nase gestrichen voll. Wie kann es sein, dass die zwei dort an der Tür stehen und in aller Selbstverständlichkeit über mich verfügen – und das, ohne dass ich das kleinste bisschen daran beteiligt bin?
Nix da, sage ich mir. Morgen in aller Früh erwartet den Herrn Oberkommissar eine glatte Dienstverweigerung, denn vor zehn geht gar nichts, das macht mein Biorhythmus nicht mit. Und was soll dieses Gerede von wegen Unterforderung und Riesenchance und so weiter? Wen juckt das? Von solchen Ambitionen bin ich völlig frei. Nicht jeder strebt nach Höherem. Ich bin, was das angeht, eher der maßvolle Typ. Ja! Das beschreibt es treffend. Ein Asket, der seinen Minimalismus pflegt und nicht wie die große Masse dem Erfolg nachjagt.
Solange Speiseplan und Fernsehprogramm stimmen, bin ich mit meinem Leben – genau so, wie es jetzt ist – rundum zufrieden. Wunschlos glücklich.
Punkt. Aus. Und Ende! – Ende mit drei Ausrufezeichen. Mindestens.
Eine Extraportion saarländische Tradition Teil II
Eine Person
Irgendwo im Saarland, 8. August um 15:47 Uhr
Ausgerechnet in dem spannenden Moment, als die Jury ihr Urteil zum Dessert der drei Kandidaten abgeben möchte, fordert die Eieruhr meinen zweiten Einsatz in der Küche ein.
Als ich den Raum betrete, riecht es seltsam. Irgendwie bitter. Das ist die Hefe, vermute ich. Ich hebe die Zeitung an und werfe einen Blick in die Schüssel. Erstaunlich, der Teig hat sich deutlich vergrößert, genau wie es auf der Backseite im Internet angekündigt wurde. Bis jetzt scheine ich alles richtig gemacht zu haben.
Ich nehme erneut das Rezept zur Hand, das ich in Druckbuchstaben auf einem Blatt notiert habe.
ERHITZEN SIE DIE BUTTER UND VERMISCHEN SIE SIE MIT DEM VANILLEZUCKER, EINEM EI, EINER PRISE SALZ SOWIE DEM RESTLICHEN ZUCKER.
Den Vanillezucker schütte ich zusammen mit der soeben in einem kleinen Topf erhitzten Butter in die bereitstehende silberne Schüssel. Dazu kommt der Rest des Rohrzuckers, die geforderte Prise Salz und ein frisches Bio-Ei vom Markt. Das war zwar ein bisschen teurer, aber letzten Endes will man doch auch gesund leben. Ein zweites Mal stecke ich die Knethaken in den Handmixer und stelle die Eieruhr ein. Fünf Minuten. Diesmal spritzt es nicht mehr. Ich bin schon fast Profi, was das betrifft. Als es piepst, schalte ich den Mixer aus und schaue abermals auf das Rezept.
IST EIN ELASTISCHER TEIG ENTSTANDEN, HABEN SIE ALLES RICHTIG GEMACHT.
Elastisch, wann ist ein Teig elastisch, frage ich mich und drücke widerstrebend meinen Zeigefinger in die weiche Masse. Sie gibt nach, das könnte durchaus mit Elastizität gemeint sein. Ich wende meinen Blick auf das Blatt. Was ist die nächste Anweisung?
NEHMEN SIE DEN TEIG AUS DER SCHUESSEL.
Oh, ne! Nicht unbedingt beherzt greife ich zu. Einmal mehr pappt die Masse an meinen Händen. Erst jetzt lese ich die Notiz in der Klammer.
(BESTAEUBEN SIE HAENDE UND ARBEITSPLATTE MIT MEHL, DAMIT ES NICHT KLEBT.)
»Verdammt!«
Ich reibe über die Teigreste an meiner Hand, was für noch mehr Kleberei sorgt. Als alles nichts hilft, wasche ich mir erneut die Finger. Diesmal unter dampfendem Wasser. An einem Geschirrtuch trockne ich mir die Hände ab. Die Haut ist rot und am karierten Leinenstoff pappt überall Teig. Entnervt werfe ich das Tuch in den Mülleimer. Vom Mehl nehme ich mir eine gute Handvoll, verteile es auf meinen Handflächen und der Arbeitsplatte. Weißer Staub steigt auf. Fast eine richtige Wolke.
Wenn ich fertig bin, darf ich nochmals die ganze Wohnung putzen. Backen ist eine Megaschweinerei. Hätte ich das geahnt! Doch jetzt, wo ich schon so weit gekommen bin, ziehe ich es durch, schließlich dient es einer höheren Sache.
Ich versuche, eine Kugel zu formen, so wie früher im Kindergarten. Der Teig wird nicht rund, er gleicht weit eher einer Röhre.
»Rolle, rolle, keine Bange – immer länger wird die Schlange« – so lautete der Spruch, den Frau Schluter, meine Erzieherin, früher beim Ausrollen vor sich hingesagt hat. Für Frau Schluter habe ich eine Schwäche gehabt. Sie war streng und machte keine Kompromisse. Die anderen Kinder haben sie nicht gemocht – mich aber auch nicht.
Aufs Neue drücke ich die Masse zusammen und beginne von vorne. Diesmal nimmt der Teig eine halbwegs runde Form an. Mit dem Lineal ermittle ich an verschiedenen Stellen den Durchmesser und schneide mit dem Messer Überlängen ab. Das Überflüssige landet im Mülleimer.
LASSEN SIE DIE TEIGKUGEL EIN WEITERES MAL IN EINER ABGEDECKTEN SCHUESSEL GEHEN.
Das steht auf dem Zettel. Wie lange, allerdings nicht. Ich stelle die Uhr auf 25 Minuten und entsorge die mit Teig verschmierten Knethaken im Müll. Für die Zukunft hat sich das Thema Backen erledigt.
Zeit für den Mörser entscheide ich. Das ist der Part, auf den ich mich am meisten freue. Die Samen waren ohne großen Aufwand zu bekommen. Außerdem sind sie ebenfalls aus biologischem Anbau, könnte man sagen.
Frau Wiesberger, meine von krankhafter Neugier befallene Nachbarin, hat mir vorgestern den Wunsch nach Saatgut auf der Stelle erfüllt. »Sie interessieren sich für Pflanzen. Das wusste ich ja gar nicht«, hat sie sofort losgeplappert, als ich gefragt habe, ob ich davon Samen haben könne. »Christrosen sind aber auch wirklich zauberhaft. Die Hummeln lieben sie, und sie lassen sich kinderleicht selbst im Garten ziehen.« Ohne weitere quälende Worte schüttelte die Wiesberger eine der Blüten sanft. Sofort purzelte rund ein Dutzend schwarz-weiße Samen mit gelbem Köpfchen in ihren offenen Handteller, das sie gleich an mich weiterreichte. Mir schauderte, als sich unsere Hände berührten.
»Bitte schön. Bloß in ein bisschen Erde setzen und regelmäßig gießen, ist nicht viel Aufwand. Nächstes Jahr blüht es dann auch in ihrem Garten. Aber waschen Sie sich nach dem Pflanzen unbedingt die Hände. Die Samen sind verdammt giftig.«
»Ach«, sagte ich und zeigte mich erstaunt. Dabei wusste ich genau über dieses Detail bereits Bescheid. Die Hände wollte ich mir ohnehin gründlich waschen, nachdem mich Frau Wiesberger angefasst hat. Das hätte sie nicht extra erwähnen müssen.
Vielleicht sollte ich ernsthaft ein paar der Samen beiseitelegen und diese, wie von Frau Wiesberger empfohlen, pflanzen, überlege ich, während ich mit dem Stößel und leichtem Druck die erste Portion trockener Saatkörner gegen die steinerne Reibschale presse. Es knistert zart, als die Samen aufplatzen und in feine Teile zerfallen. Ich fülle nach. Was am Ende übrig bleibt, ist nicht viel, vielleicht ein halber Teelöffel voll Pulver, das in der Mitte der Schale verweilt. Harmlos wirkt das, ist es aber nicht. Christrosen sind zauberhafte Pflanzen, genau wie die Wiesberger gesagt hat.
Die Schüssel mit dem Pulver schiebe ich beiseite, denn das Schrillen der Eieruhr gibt das Ende der Wartezeit bekannt. Jetzt folgen die letzten Arbeitsschritte. Ich stelle nochmals alles, was es braucht, in eine Reihe vor mich: Mehl, ein Päckchen Butter und wieder Rohrzucker. Außerdem einen Teigroller aus Holz, frisch erworben.
LEGEN SIE DAS BACKBLECH MIT BACKPAPIER AUS UND ROLLEN SIE DEN TEIG AUF EINER BEMEHLTEN FLAECHE IN DER GROESSE DES BLECHS AUS.
Mit dem Lineal, das noch auf der Arbeitsplatte bereitliegt, messe ich die Innenfläche des Backbleches aus.
41,4 mal 33,7 Zentimeter notiere ich auf einem Extrablatt. Ziemlich ungerade Maße. Das werde ich trotzdem hinbekommen. Ich nehme den Teigroller zur Hand und überlege, ob ich so etwas jemals benutzt habe. Es braucht ein kleines bisschen Zeit, bis ich den Dreh raushabe. Immer wieder zieht sich die gummiartige Masse zusammen. Wie soll man da den exakten Umfang erlangen? Das Thema Backen ist mir ein einziges Rätsel.
In meiner Not rolle ich den Teig großflächiger aus. Fertig! Nun stellt sich die Frage, wie er von der Arbeitsplatte aufs Backblech kommt. Anheben, mein erster Impuls, funktioniert nicht. Allein beim Versuch entstehen überall Risse. Es ist zum Verzweifeln.
Also nehme ich nochmals Mehl, aufs Neue staubt es höllisch. Ich streue es weiträumig rund um den Teig, klemme mir das Kuchenblech zwischen Bauch und Arbeitsplatte und strecke die Arme aus. Was für ein Elend! Vorsichtig ziehe ich den ausgerollten Teig in Richtung Blech. Aus dem Oval wird eine geometrisch nicht mehr einordbare Form. Ich bugsiere die Masse trotzdem weiter – was für eine Wahl habe ich? Backen ist Schwerstarbeit. Mit angehaltenem Lineal, hinzugenommenen Geodreieck und Fleischmesser wird aus dem Ärgernis zu guter Letzt ein mäßig erkennbares Rechteck.
Jetzt fehlen nur noch die Streusel – das Allerbeste am Kuchen, wenn man dem Rezept glauben möchte. Daran besteht kein Zweifel, denn genau hier kommt meine neue Lieblingszutat ins Spiel. Jedoch erst ganz am Ende, zu Beginn folge ich noch exakt dem Rezept:
GEBEN SIE MEHL, ZUCKER UND WEICHE, ZERKLEINERTE BUTTER IN EINE SCHUESSEL UND KNETEN SIE DIE ZUTATEN MIT DEN HAENDEN ZU EINEM KRUEMELIGEN TEIG.
Das Füllen der Zutaten in die Schüssel ist schnell erledigt, darin habe ich mittlerweile Übung. Allerdings steht nun das Kneten an. Mit den Fingern. Es kostet mich Überwindung, in die Masse hineinzugreifen. Doch mit dem Gedanken an meine Mission gebe ich mir einen Ruck. Es handelt sich schließlich um eine Herzensangelegenheit. Viel zu viel Zeit habe ich unnötig verstreichen lassen.
Als die Zutaten vermischt sind, folgt der schönste Part. Das feine, blumige Pulver, das in aller Seelenruhe auf der Arbeitsplatte auf seinen Einsatz gewartet hat, hat seinen Auftritt. Das hebt meine Stimmung. Von nun an wäre es nicht mehr ratsam, den Teig mit den Fingern zu bearbeiten. Die besondere Streuselmischung für besondere Freunde ist schnell kreiert: Mit einem Rührlöffel hebe ich die Zusatzkomponente vorsichtig, ja fast feierlich unter. So lange, bis niemand mehr auf den Gedanken kommen könnte, in der Schüssel wäre etwas anderes als schlichte Streusel. Ich hebe das Gefäß an meine Nase und rieche daran. Völlig neutral! Man könnte fast versucht sein, ein wenig zu kosten. Interessieren würde mich der Geschmack schon, um freiwillig davon zu probieren, müsste ich allerdings verrückt sein. Und der Umstand trifft auf alle anderen, aber garantiert nicht auf mich zu.
Die auf so außergewöhnliche Weise abgeschmeckten Streusel gebe ich mit einem Schöpflöffel auf den Hefeteig. Perfekt. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich fertig. Ich spicke abermals auf mein Rezeptblatt.
BACKEN SIE DEN KUCHEN 30 MINUTEN LANG. OBER- UND UNTERHITZE 200°C
Das ist ein Arbeitsschritt, mit dem ich mich leicht anfreunden kann. Ich schiebe das Backblech in den Ofen und stelle die Uhr auf die angegebene Zeit ein. Jetzt heißt es von Neuem warten und Aufräumen. Der Teigroller, Schopf- und Rührlöffel und die Schüssel landen umgehend im Müll wie schon die Knethaken zuvor.
Obwohl heute Sonntag ist und damit gestern Putztag war, nehme ich den Bodenwischer erneut aus der Abstellkammer und putze zweimal über die weißen Fliesen. Danach fahre ich mit einem feuchten Lappen und einem Spritzer Desinfektionsmittel über die Schränke und die Arbeitsplatte. Die Küche sähe nun halbwegs passabel aus, wäre da nicht der viele Mehlstaub an den Fenstern.
Also mache ich mich auch hier ans Werk, dabei bemerke ich Frau Wiesberger. Trotz Sonntagsruhe werkelt sie im Vorgarten in der Nähe der Christrosen, die mittlerweile längst verblüht sind. Typisch! Ich werde das Gefühl nicht los, die liebe Frau Nachbarin arbeitet einzig und allein im Garten, um mich durch das Küchenfenster hindurch beobachten zu können. Da! Schon wieder. Sie schaut verstohlen in meine Richtung. Als sie mich die Scheiben mit dem Geschirrtuch trockenreiben sieht, winkt sie sogar. Jetzt reicht’s! Mal ernsthaft, was denkt die sich? Ich ziehe die Vorhänge zu. Neben der Wiesberger zu wohnen, fühlt sich an, als sei man das Opfer einer 24-Stunden-Observation.
Im Schutz des schweren Stoffs blicke ich zu ihr hinüber. Irgendetwas stimmt mit der Frau nicht, so viel Unkraut kann es in einem wenige Quadratmeter großen Vorgarten gar nicht geben. Womöglich hat sie einen ersten Verdacht. Dass sie immer so unbedarft daherkommt, ist vielleicht bloße Masche. Um das Problem werde ich mich wohl oder übel kümmern müssen, entscheide ich. Die Angelegenheit ist längst überfällig.
Ich wende mich wieder dem Backofen zu. Noch drei Minuten. Der Geruch nach Frischgebackenem hat sich im ganzen Haus ausgebreitet. Selbst den Hund hat es aus dem Wohnzimmer gelockt.
»Na, sieht nicht schlecht aus. Oder?«, frage ich und beuge mich zu ihm hinunter. Wir blicken beide durch das Sichtfenster auf das kleine Meisterwerk, das dort im Herd seine letzten Minuten verbringt. »Allerdings ist dieser Leckerbissen nicht für uns bestimmt.«
Die Uhr zeigt noch zehn Sekunden an.
Um keine Verzögerung zu riskieren, postiere ich mich vor dem Backofen. Mit dem Erklingen des Alarms öffne ich die Backofentür und greife nach dem Kuchenblech.
»Autsch.« Sofort ziehe ich meine Hände wieder zurück. Das Backblech ist höllisch heiß. Meine Fingerspitzen brennen. Ein seltsames Gefühl. Ich hebe meine Hand vors Gesicht und frage mich, ob es klug wäre, sie unter dem Wasserhahn zu kühlen. Doch dann entscheide ich mich, den Schmerz zu genießen, und schaue dabei zu, wie sich meine Hautfarbe in tiefes Rot wandelt. An den Rändern kräuselt sich die Haut. Zwei Blasen wölben sich auf und werden größer. Und da, mit einem Mal und viel zu schnell, ist dieser besondere, bittersüße Moment auch schon wieder vorbei.
Jammerschade.
Es kann also weitergehen. Ich greife mir das nun weit kühlere Blech und stelle es auf zwei Korkuntersetzern auf der Arbeitsplatte ab. Einwandfrei sieht das aus, urteile ich mit einem Blick auf mein erstes eigenes Backwerk. Nun muss es nur noch kalt werden und natürlich auch schmecken, aber das sollen andere beurteilen, sage ich mir.
Eine Stunde später schiebe ich den fertigen Kuchen vom Backblech in den extra für diesen Anlass verwahrten Kuchenkarton vom »Café Lolo«. »Genuss mit Tradition«, steht auf dem Deckel. Bei der Verpackung wird niemand Verdacht schöpfen, wenn es »Café Lolo« heißt, greifen immer alle zu.
Ich fühle mich fantastisch. Vorfreude dürfte das vermutlich sein – und warum auch nicht? Ein saarländischer Krimmelkuchen, das ist eine wunderbare Tradition und ein äußerst passendes Präsent für meine alten Wegbegleiter! Ich bin riesig gespannt, wie das Geschenk ankommt. Diese kleine Überraschung steht schon viel zu lange aus. Wie könnte man besser seine Dankbarkeit zeigen?
Mitten in der Nacht
Günther, der Dackel
In einem Mehrfamilienhaus, Tholey, 9. August um 6:03 Uhr
Es ist mitten in der Nacht, als es läutet. Hanne geht zur Tür. Ich kann jede ihrer Handlung anhand der Geräusche zuordnen. Erst die Schritte, dann die Pause, als sie durch den Türspion schaut, und schließlich das Scheppern der Schlüssel beim Aufsperren der Tür.
»Moin, ist er startbereit?« Das ist das Ekel, unüberhörbar.
»Morgen, Wolfgang, du bist aber früh dran«, erinnert ihn Hanne an die eigentliche Abmachung und informiert ihn auch gleich über die Sinnlosigkeit seines Kommens. »Es ist erst kurz nach sechs. Bis jetzt konnte ich ihn nicht überzeugen aufzustehen. Frühstück steht auch noch aus, sonst hat er schlechte Laune.«
»Schlechte Laune? Siggi und du habt wirklich gar keine Ahnung von Tieren.« Hanne erwidert nichts. Das passt dem Haarspalter Wolfgang gut in den Kram, denn Ratschläge zu meiner Erziehung hat er reihenweise parat. »Hunde sind keine Menschen, von daher haben sie auch keine miese Laune. Dass ihr das einfach nicht einsehen wollt. So ein Tier braucht Orientierung und Führung. Jemanden, der ihm zeigt, wie der Hase läuft.«
Mit diesen Worten bringt Wolfgang meinen Kreislauf schneller als jeder Espresso in Schwung. Was erlaubt der sich? Wir drei verstehen uns dufte – niemand braucht seine Ratschläge, die wohl noch aus dem Altertum der Hundeerziehung stammen. Moderne Menschen wollen einen selbstbewussten Hund mit Ecken und Kanten.
»Willst du einen Kaffee?«, fragt Hanne, das Thema ignorierend. Man hört sie schlurfen, sie geht in Richtung Küche. In dieses Geräusch mischen sich schwere Schritte. Wie es klingt, stapft ihr Wolfgang hinterher.
»Kaffee wäre super, schwarz und ohne Zucker«, sagt er, und ich denke nur: Ja, schwarz, das wundert mich überhaupt nicht. Das passt zu seiner Seele.
Ich lausche weiter. Hanne nimmt eine Tasse aus dem Schrank und gießt ein. »Bin gleich wieder da«, sagt sie, woraufhin Schritte folgen, die stetig lauter werden.
Och nö. Gnade! Ich will liegen bleiben. Die Taktik ist klar: Ich gebe keinen Ton von mir und kuschle mich mit geschlossenen Augen tief in meine Decke. Ich nächtige noch, das ist unübersehbar.
Doch das zieht heute offenbar nicht. Hanne ist, offenkundig aufgestachelt von Wolfgangs harschen Worten, äußerst ungnädig mit mir. Ohne Vorwarnung und die nötigen Streicheleinheiten, um gut in den Tag zu starten, hebt sie mich hoch und entreißt mich meinem urgemütlichen Paradies im Schlafzimmer.
Siggi schnarcht vor sich hin. Gilt hier das Gebot der Gleichbehandlung nicht? Vor neun schält er sich nicht aus den Daunen, das ist amtlich. Ich frage mich, warum man ihn nicht zum Training schickt? Ein bisschen Sport würde dem Schreibtischtäter deutlich besser tun als mir.
Aber heute scheint das Mitspracherecht ausgesetzt zu sein. »Guten Morgen, Güntherlein«, flötet Hanne, während sie mich auf ihrer Schulter abgelegt und durch den Flur trägt. Als ob das Gesäusel jetzt noch irgendetwas gut machen könnte. »Heute ist dein großer Tag«, behauptet sie.
Hanne ist ein Schatz, doch was diesen Spruch angeht, liegt sie so was von daneben. Heute ist viel eher einer der finstersten Tage meines gesamten Lebens. Es muss Jahre her sein, dass ich um die Zeit wach gewesen bin. Ich hätte nicht mal bescheinigt, dass es diese Uhrzeit überhaupt noch gibt.