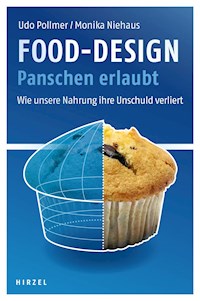11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Zu viel, zu süß, zu fett, zu salzig – die Verbote der gesunden Ernährung machen die Lust aufs Essen nicht selten zum Frust. Dabei beruhen viele dieser Ernährungsweisheiten auf Mißverständnissen, Fehlinterpretationen und Halbwahrheiten, sagen Udo Pollmer und Susanne Warmuth. In der um viele Stichworte aktualisierten Neuausgabe ihres Bestsellers werfen sie einen kritischen Blick auf unsere liebgewonnenen Ernährungsrituale, untersuchen den Wahrheitsgehalt von Kampagnen der Nahrungsmittelindustrie und nehmen zahlreiche andere Fehlinformationen aufs Korn: von A wie Alkohol bis Z wie Zucker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97441-7
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: Christina Hucke
Covermotiv: @ Stockfood
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zur Neuausgabe
Vorwort
Zitat
Abnehmen
Acrylamid
Alkohol
Antioxidanzien
Apfelsaft
Aromen
Backfisch
Ballaststoffe
Bestrahlung
Beta-Carotin
Bier
Bismarckhering
Blau
Blutgruppendiät
BMI
Bodenhaltung
Brot
BSE
Calcium
Champagner
Chateaubriand
Chemiebier
Cholesterin
Cola
Croissant
Diät
Dicke Deutsche
Eier
Eisbein
Enzyme
Ernährungsbedingte Krankheiten
Essen
Etikett
Fast food
Fett
Fettarm
Fettbewußt
Fleisch
Fliegen
Freilandhaltung
Frische
Frischkornbrei
Fruchtsaft
Frühstück
Fünf am Tag
Gammelfleisch
Geiz ist geil
Genfood
Gesunde Ernährung
Gesundheit
Grapefruit
Grillen
Grüner Tee
Heilige Kuh
Japan
Junk food
Kaffee
Kalorien
Kannibalismus
Karotten
Kater
Kaugummi
Kaviar
Kinder
Knickebein
Knoblauch
Kochen
Kopfsalat
Krebs
Lebensmittelqualität
Lebensmittelskandale
Leberwurst
Legebatterie
Leipziger Allerley
Light-Produkte
Magersucht
Mangel im Überfluß
Milch
Mittelmeerdiät
Muckefuck
Müsli
Nährwertempfehlungen
No-name-Produkte
Obst
Ökotrophologie
Olivenöl
Osteoporose
Pflanzliches Fett
Pilze
Pizza
Probiotika
Radikale
Reinheitsgebot
Rinderwahn
Risikofaktoren
Rohkost
Rohmilchkäse
Säure-Basen-Haushalt
Salz
Schlanke
Schokolade
Schweinefleisch
Sekt
Sojamilch
Spinat
Stollen
Süßigkeiten
Süßstoff
Supersize me
Tafelwasser
Toast Hawaii
Tomaten
Traubenzucker
Trinken
Trüffel
Übergewicht
Übersäuerung
Vanillearoma
Vegetarier
Vitamine
Vitamin B1
Vitamin C
Vitamin E
Vitaminmangel
Vogelgrippe
Vollkornbrot
Vollwerternährung
Vollwertkost
Wein
Weißer Reis
Weißmehl
Zimt
Zucker
Zuckerkrankheit
Zuckerkulör
Zufuhrempfehlungen
Zusatzstoffe
Zur Neuausgabe
Es ist angerichtet! Ein Update populärer Ernährungsirrtümer
In einer Neuauflage steckt naturgemäß viel Neues. Wir werden Ihnen einen Strauß neuer Kreationen servieren, einige der altbewährten wurden neu arrangiert und mit aktuellen Informationen nachgewürzt. In den Kernaussagen mußte hingegen nicht viel geändert werden, denn die Forschung hat vieles bestätigt, was in der ersten Auflage nur angedeutet werden konnte – beispielsweise, daß Calciumgaben nicht etwa die Knochen stärken, sondern die Verkalkung fördern. Dumm gelaufen …
Wenig überraschend gibt es noch immer keine Belege dafür, daß das Befolgen einschlägiger Ernährungsvorschriften – sei es Low Fat, Low Carb, Fünf am Tag oder andere phantasievolle Ernährungstips – langfristig zu weniger Pfunden oder gar zu mehr Gesundheit führt. Dafür liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor, die zeigen, daß die verfemten Dicken ihren schlanken Altersgenossen am Ende eine lange Nase drehen – und aller üblen Nachrede zum Trotz sogar länger leben als diese.
Das Scheitern ihrer überholten Gewichts- und Ernährungskonzepte scheint deren Verfechter allerdings wenig zu kümmern. Wie gehabt rufen sie in der Öffentlichkeit nach mehr Geld für Programme zur Durchsetzung der gerade aktuellen Ernährungsmarotten (vom Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung stammt gar die Forderung nach »Zwangsmaßnahmen«), obwohl die Lage hinter den Kulissen offensichtlich immer desperater wird. Bezeichnend dafür ist das Fazit des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Jahr 2007: »Die Ernährungswissenschaft muss sich künftig als Wissenschaft von der Rettung der Volksgesundheit lösen und sollte keine Heilsversprechen mehr abgeben.«
Ja, dann rette sich, wer kann, vor den immer noch herumgeisternden allumfassenden Heilsversprechen der Ernährungswissenschaft – am besten durch Entsorgung sämtlicher Ratgeber der Art »gesund durch gesunde Ernährung«. Dieses Buch bietet Ihnen als erste Hilfe eine bunte Auswahl topaktueller Rettungswesten, dank derer Sie die Flut heilloser Ratschläge ratloser ErnährungsberaterInnen hoffentlich heiter und unbeschadet überstehen. Glück auf!
Gemmingen/Darmstadt, im Herbst 2007
Udo Pollmer
Susanne Warmuth
Vorwort
Essen ist menschlich
»Mir kommt es so vor, als habe die ganze Ernährungsaufklärung in 40 Jahren nur eines erreicht: Die Menschen essen weiterhin, was sie immer gegessen haben. Sie tun es jetzt nur mit schlechtem Gewissen.«
Professor Volker Pudel als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
»Alles, was Spaß macht, ist entweder verboten, unanständig oder ungesund.« Dieser Stoßseufzer eines Genießers bringt es auf den Punkt. Wir leben fürwahr in lustfeindlichen Zeiten. Die Kirchenoberen werden nicht müde, nach dem Unterleib ihrer Schäfchen zu greifen, und Ernährungsexperten aller Art verbieten uns jetzt auch noch den Mund. Diätpäpste verkünden die neuen Ersatzreligionen und versprechen das ewige Leben in jugendlicher Schönheit – sofern man denn ihre Gebote befolgt. Sie missionieren gegen die Todsünden unserer Ernährung (»zu viel – zu süß – zu fett – zu salzig«) und warnen gebetsmühlenhaft vor dem nahenden Herztod durch das weichgekochte Ei wie weiland die Pfaffen vor Rückenmarksverlust durch Onanieren. Statt Ablaßbriefen für den wohlhabenden Sünder verkaufen die modernen Prediger Vitaminpillen gegen die Angst vor Impotenz und Alter, Formula-Diäten zum Design der Oberschenkel und Rotweinpillen für Banausen.
Das Trommelfeuer an Ernährungsge- und -verboten wirkt. In den USA plagen sich bereits Fünfjährige mit den ersten Diäten. Als Erwachsene zählen sie dann artig ihre Kalorien, prüfen täglich mit der Badezimmerwaage die Standhaftigkeit ihres Glaubens, handhaben die Kalorientabelle wie den Katechismus und beten jeden Blödsinn über kalorienarme Butter, vitalisierte Rohkost und die mehrfach ungesättigten Spekulationen der Experten für gesunde Ernährung nach.
Wären die Menschen aufgrund all der Ratschläge tatsächlich gesünder geworden, niemand würde etwas sagen. Aber nach 40 Jahren unermüdlicher Gehirnwäsche im Namen der Gesundheit lassen die Beweise für den Nutzen der Entsagung noch immer auf sich warten. Statt dessen wächst die Zahl der diätgeschädigten Dicken und der Eßgestörten. Bittere Ironie: Die einzigen, die es geschafft haben, sich mit dem Verstand gegen den Körper durchzusetzen, sind die Magersüchtigen. Sie kontrollieren jeden Happen und achten ständig aufs Gewicht. Sie kennen die Kalorientabellen auswendig, kauen jeden Bissen zwanzigmal und essen nicht mehr, als sie sich erlauben, egal, ob’s Pommes mit Mayo oder Mousse au chocolat gibt. Ihr Wille hat gesiegt – aber um welchen Preis.
Die Umerziehungsversuche auf dem Gebiet der Ernährung müssen scheitern. Zum einen ist der Appetit mit dem Verstand kaum steuerbar – auch wenn wir als wohlerzogene Deutsche lieber an mangelnde Selbstbeherrschung glauben als an einen Mangel an Genußfähigkeit. Essen ist ein Trieb. Die Nahrungsaufnahme, die Auswahl der Speisen, der Appetit sind entwicklungsgeschichtlich älter als die Sexualität. Sie sind im Instinkt verankert und dem Verstand, der Ratio, auf Dauer nicht zugänglich und von ihm langfristig auch nicht steuerbar. Das Sexualverhalten des Menschen erscheint dagegen noch vergleichsweise rational und beeinflußbar. Essen und Trinken sind überlebenswichtige Grundbedürfnisse. Dies hat die Biologie so festgelegt – ob es uns paßt oder nicht. Allein der Tatbestand, daß seit Jahrzehnten Ratschläge auf Ratschläge folgen, Theorien auf Theorien, Diäten auf Diäten, zeigt dem unbefangenen Beobachter, daß hier ein grundsätzlicher Denkfehler vorliegen muß.
Doch das Scheitern hat noch weitere Gründe. Am augenfälligsten ist der Versuch, die ganze Menschheit über einen Kamm scheren zu wollen. Weshalb sollen wir eigentlich alle dasselbe essen – obwohl wir uns nicht nur in Schuhgröße und Kragenweite unterscheiden, sondern ganz genauso in der Arbeitsweise unseres Darms und der Enzymausstattung der Leber? Die eine »gesunde Ernährung« für alle ist eine Illusion. Schließlich würde auch niemand auf die glorreiche Idee verfallen, allen Menschen das Einkürzen der Füße auf Schuhgröße 25 zu empfehlen, nur weil Füße dieser Größe im statistischen Mittel gesünder sind …
Statistische Korrelationen haben etwas Verführerisches. Sie erzeugen die Vorstellung eines ursächlichen Zusammenhangs, obwohl sie eigentlich nur ein gleichzeitiges Auftreten dokumentieren. In der Ernährungswissenschaft wurde und wird gerne mit Korrelationen gearbeitet und argumentiert. Nun steht die Ernährung stets in enger Beziehung mit dem Wohlstand. Dieser wirkt sich jedoch außerdem noch auf viele, viele andere Faktoren und Merkmale einer Gesellschaft aus, etwa den Umfang des Steuerrechts, die Anzahl der Verkehrsschilder, den Prozentsatz der Scheidungen oder die Ausgaben für den Psychotherapeuten – und die Krankheiten. Deshalb gibt es kaum ein Ernährungsmuster, das sich nicht mit irgendwelchen Krankheiten korrelieren ließe. Dasselbe wäre vermutlich auch mit Automarken, Überstunden oder Fitneßstudios möglich – nur sucht niemand nach diesen Zusammenhängen.
Heißt das etwa, daß alle wissenschaftlichen Daten unglaubwürdig sind? Trotz des alten Insiderwitzes »Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast« – ganz so düster ist das Bild nicht. Denn auch bei den Studien, mit denen Korrelationen ermittelt werden, gibt es gewaltige Unterschiede in der Aussagekraft – je nach Methode. Für dieses Buch hielten sich die Autoren an den »Goldstandard«, an Interventions- und prospektive Studien. Sie sind nicht nur beweiskräftiger, sondern noch dazu schwerer manipulierbar. Bei rückblickenden (retrospektiven) Untersuchungen trüben nicht nur Erinnerungslückender Befragten das Bild, auch lassen sich Datensätze austauschen und durch dasAusprobieren möglichst vieler Korrelationen stets ein paar signifikante Ergebnisse errechnen, die sich dann für neue Theorien eignen. Getreu dem Prinzip: Je öfter man würfelt, desto größer die Chance auf einen Sechser.
Für eine prospektive Studie müssen sich die Forscher zunächst auf eine Hypothese festlegen. Dann verfolgen sie das Verhalten der Teilnehmer über viele Jahre oder gar Jahrzehnte. Die Ergebnisse solcher Studien haben in den letzten Jahren für einige Aufregung unter den Experten gesorgt. Denn meistens erwiesen sich die gängigen Empfehlungen als völlig nutzlos. Ähnliches gilt für Interventionsstudien, bei denen der Erfolg einer Maßnahme gegen ein Scheinmedikament (Placebo) oder eine unbehandelte Kontrollgruppe getestet wird.
Vielleicht sind aber nicht nur die Aussagen der Ernährungsberatung fragwürdig, sondern das ganze Konzept? Ein Mensch, der jeden Bissen unter den Aspekten vermeintlich »gesunder Ernährung« zerkaut, befindet sich in der gleichen Situation wie einer, der Sexualität in erster Linie unter orthopädischen Gesichtspunkten sieht und vorsorglich seine Wirbelsäule entlasten möchte. Die ernährungsbewußte Küche aus den Elfenbeintürmen der Wissenschaft ist, um den australischen Psychophysiker Robert McBride zu zitieren, wie Sex ohne Orgasmus.
Aber woran kann man sich noch orientieren? werden Sie jetzt mit Recht fragen. Unsere Empfehlung: Achten Sie doch mal wieder auf die freundlichen Hinweise Ihres Appetits und benutzen Sie den gesunden Menschenverstand als Korrektiv bei allen Verlockungen und Verboten, gleich welcher Art. Den Autoren läge nichts ferner, als den Inhalt Ihres Kühlschranks zu kritisieren, und wir werden uns hüten, Ihnen etwas zu vermiesen, das Sie bisher mit Appetit genossen haben. Im Gegenteil. Lassen Sie sich vom »Lexikon der populären Ernährungsirrtümer« ruhig lange versagte Genüsse wieder schmackhaft machen: Es ist als reichhaltiges Büffet komponiert. Neben sättigenden Hauptgerichten, wie den Irrtümern rund ums Cholesterin, ums Salz oder den Vitaminbedarf, gibt’s allerlei leichte Speisen. Und natürlich dürfen die delikaten Appetithäppchen nicht fehlen: Fördern Trüffel die Potenz? Ist gegen den Kater wirklich kein Kraut gewachsen? Und frißt der Teufel die Fliegen nur in der Not? Nehmen Sie sich ein paar Schmankerln auf den Teller – und naschen Sie. Sie wissen ja: Der Appetit kommt spätestens beim Lesen.
Gemmingen/Darmstadt, im Sommer 2000
Udo Pollmer
Susanne Warmuth
»Es kann als gesichert angesehen werden, und dazu bedarf eskeiner Aufklärung: Ernährung ist tödlich! Denn jeder, der sich langegenug ernährt hat, ist bislang gestorben. Wer hingegen aufhörtsich zu ernähren, kann zumindest nicht an den Folgender Ernährung sterben.«
Professor Harald Förster, Universität Frankfurt
Abnehmen
Wer abnimmt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes
Gebetsmühlenhaft ermuntern, drängen, beschwören Ärzte und Ernährungsexperten mehr oder weniger dicke Zeitgenossen, ihrer Gesundheit zuliebe abzuspecken. Schließlich gilt Übergewicht als klassischer Risikofaktor für eine ganze Reihe gefürchteter Zivilisationsleiden. Das »Deutsche Ärzteblatt« offeriert eine lange Liste von Krankheiten, die mit Übergewicht korrelieren können: »Übergewicht und Adipositas [Fettsucht] begünstigen die Entstehung kardiovaskulärer [Herz-Kreislauf-] Risikofaktoren … Das gehäufte Auftreten kardiovaskulärer Risikofaktoren wie Hypertonie [Bluthochdruck], Hyperlipidämie [hohe Blutfettwerte] und Diabetes mellitus [Zuckerkrankheit] erklärt die erhöhte Inzidenz [das vermehrte Auftreten] arteriosklerotischer [auf Gefäßverengungen zurückzuführende] Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Außerdem ist Übergewicht mit anderen Krankheiten wie Gallensteinerkrankungen, Venenleiden, Herzinsuffizienz [Herzschwäche], degenerativen Gelenkerkrankungen [Abnutzung], Gicht und bestimmten Karzinomen [Krebs] assoziiert. Diese Begleit- und Folgeerkrankungen haben eine Verkürzung der Lebenserwartung in Abhängigkeit von Ausmaß und Dauer zur Folge.«[1]
Das klingt bedrohlich. Klar doch, daß jeder, der nicht krank werden oder gar sterben will, etwas gegen seinen im übrigen unästhetischen Bauch oder Reithosenspeck unternehmen sollte. Dabei wird eine ganz entscheidende Frage übersehen: Sind abgespeckte Dicke gesünder als dicke Dicke? Ganz abgesehen von den möglichen Nebenwirkungen einer Abmagerungskur. Das Ziel »Schlankheit« scheint so positiv besetzt zu sein, daß kritische Fragen außerhalb unserer Denkgewohnheiten liegen. Deshalb wollen wir sie hier stellen.
Die bekannteste Nebenwirkung des Abspeckens mit Diäten gleich welcher Art ist der Jo-Jo-Effekt, der mit schöner Regelmäßigkeit zu einem höheren Endgewicht führt. Immerhin hat sich dieser Effekt in der Gemeinde herumgesprochen. Weit seltener erfahren Diätwillige, welche schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen das Abnehmen für sie haben kann – unabhängig davon, ob sie das mühsam errungene niedrigere Gewicht auf Dauer halten oder nicht: Herzrhythmusstörungen bis hin zum Infarkt, Gallensteinbildung, Osteoporose und Knochenbrüche, erhöhter Harnsäurespiegel, Störungen der Leberfunktion, Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt, Verlust von Muskelmasse am ganzen Körper und auch am Herzen, Diabetes, Freßattacken und Eßstörungen.
Stellvertretend für viele andere wissenschaftliche Untersuchungen sei die amerikanische Iowa Women’s Health Study mit 35.000 Teilnehmerinnen genannt. Sie belegt, daß sowohl unfreiwilliges Abnehmen (aufgrund von bestehenden Krankheiten) als auch Diäten diverse andere Erkrankungen begünstigen. Menschen, die Diäten absolviert hatten – egal, ob mit oder ohne Erfolg –, erkrankten später vermehrt an Diabetes und erlitten häufiger Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Auch Oberschenkelhalsbrüche kamen in dieser Gruppe öfter vor. Der Ernährungswissenschaftler Nicolai Worm urteilt nach einer detaillierten Analyse aller bis 1998 vorliegenden Studien mit insgesamt Hunderttausenden von Teilnehmern, daß »keine einzige davon bisher belegen konnte, daß Abnehmen einheitlich mit einem klinisch relevanten gesundheitlichen Vorteil, das heißt verminderter Sterblichkeit, verbunden ist«.
Bis heute gibt es nicht einmal einen Beweis dafür, daß Übergewichtige durch Abnehmen wenigstens ihr Herz-Kreislauf-Risiko vermindern – weswegen man ihnen meistens zum Abspecken geraten hatte. Im Gegenteil: Häufig nimmt gerade die Sterblichkeit durch Herzinfarkt nach dem Gewichtsverlust zu. In manchen Studien sogar um 50 Prozent und mehr. Es ist dabei egal, ob das Abnehmen durch Crash-Diäten oder angebliche »Soft«- oder »Psycho«-Diäten erfolgte, ob die wohlfeilen Ratschläge von Frauenzeitschriften oder Ortskrankenkassen, von Psychologieprofessoren oder Schauspielern erteilt werden. Der Körper reagiert auf Nahrungsverknappung immer in der gleichen Weise – egal, welche Theorie dahintersteht.
Im »Kassenarzt« wurde angesichts der penetranten Abnehmpropaganda durch Organisationen, die es eigentlich besser wissen müßten, die provokante, aber durchaus ernstgemeinte Frage gestellt »Bringt die AOK die Dicken um?« »Mit ihrer Pfundskur«, so lesen wir weiter, »unterstützt und propagiert die ›Gesundheitskasse‹ äußerst fragwürdige Ernährungsdogmen, deren Befolgung Abspeckwilligen eher zum gesundheitlichen Schaden sein dürfte.« Je mehr Versicherte in die Diätfallen der Krankenkassen tappen, desto besser für deren Mitarbeiter. Denn wenn der Krankenstand steigt, sind wenigstens diese Arbeitsplätze sicher.
Angesichts der nicht ungefährlichen, zum Teil sogar lebensbedrohlichen Begleiterscheinungen von Diäten (von denen Kinder nicht ausgenommen sind) muß die Frage erlaubt sein, wem – außer den Organisationen und Einrichtungen, die damit ihre Brötchen verdienen – der entsagungsvolle Kampf um die Pfunde überhaupt etwas bringt? Vergleicht man die Gefahren von Diäten mit anderen risikoreichen Verhaltensweisen, so lassen sie sich durchaus mit denen des Rauchens vergleichen. Deshalb fordern böse Zungen bereits, daß wenigstens Frauenzeitschriften und Gesundheitssendungen stets mit dem Hinweis versehen werden sollten: »Abnehmen gefährdet Ihre Gesundheit!«
Fettarme
Diäten sind ideal zum Abnehmen
Schlanke
leben länger
Der Film
»Super Size Me«
beweist, daß Fast food dick und krank macht
Literatur:
L. Lissner, K. D. Brownell: Weight cycling, mortality, and cardiovascular disease: a review of epidemiologic findings. In: P. Björntorp, B. N. Brodoff (Eds): Obesity. New York 1992, S. 653
J. G. Wechsler et al.: Therapie der Adipositas. Deutsches Ärzteblatt 1996/93/S. B1751
S. A. French et al.: Relation of weight variability and intentionality of weight loss to disease history and health-related variables in a population-based sample of women aged 55–69 years. American Journal of Epidemiology 1995/142/S. 1306
M. W. Schwartz, J. D. Brunzell: Regulation of body adiposity and the problem of obesity. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 1997/17/S. 233
S. Syngal et al.: Long-term weight patterns and risk for cholecystectomy in women. Annals of Internal Medicine 1999/130/S. 471
H. J. Richter: Bringt die AOK die Dicken um? Kassenarzt 2003/H. 4/S. 14
Wer abnimmt, lebt länger
Ob sich durch Abspecken der aktuelle Gesundheitszustand verbessert, ist eine Sache, ob man deswegen auch tatsächlich länger lebt, eine andere. Doch jahrzehntelang hielt man es offenbar für überflüssig, dieser entscheidenden Frage nachzugehen. Dann endlich, Anfang der neunziger Jahre, überprüfte die amerikanische Gesundheitsbehörde, ob Übergewichtige für das Abnehmen mit mehr Lebensjahren belohnt werden. Dafür analysierte sie sechs Studien, die zwischen 1950 und 1990 durchgeführt worden waren. In der abschließenden Bewertung heißt es lapidar: »Zusammenfassend ergeben sich aus den sechs Studien keine Belege, daß sich durch Gewichtsreduktion die Lebenserwartung von Übergewichtigen verlängert.«
Bei der gleichen Gelegenheit untersuchten die Forscher auch, wie sich Gewichtszunahmen oder Gewichtsschwankungen, die auf den Jo-Jo-Effekt zurückzuführen sind, auf die Lebenserwartung auswirken. Dafür wurden 13 Langzeitstudien ausgewertet. Das Ergebnis war überraschend und schockierend zugleich: »Für das Abnehmen, auch wenn es nur mäßig oder wenig ausgeprägt ist, findet man eine erhöhte Sterblichkeit.« Am längsten leben erstaunlicherweise die, die im Laufe ihres Erwachsenenlebens langsam, aber stetig immer ein bißchen zunehmen.
Der Vorstellung, daß Abnehmen die Lebenserwartung erhöht, liegt ein Trugschluß zugrunde. Selbst wenn »Normalgewichtige« länger leben würden als »Wohlbeleibte«, wer sagt, daß Dicke nach dem Abnehmen tatsächlich die gleiche Lebenserwartung haben wie von Natur aus Schlanke? Ein Windhund wird beim Wettrennen einen Mops überholen, aber hat ein abgemagerter Mops bessere Chancen, den Windhund abzuhängen? Ein »abgemagerter Dicker« ist nun mal etwas anderes als ein schlanker Mensch.
Das bestätigt eine Studie aus Israel. Dort verfolgten die Ärzte fünf Jahre lang das Gewicht von über 9.000 Männern. Mehr als ein Viertel von ihnen hielt in dieser Zeit Diät, teils aus gesundheitlichen Gründen, teils einfach nur, um abzunehmen. In den folgenden 18 Jahren starb jeder Dritte. Ergebnis: Männer, die im Untersuchungszeitraum mehr als fünf Kilogramm abgenommen hatten, hatten ein 30 Prozent höheres Risiko zu sterben als Männer, deren Körpergewicht stabil geblieben war. Um auszuschließen, daß diese starken Gewichtsverluste durch eine Krankheit bedingt waren, rechneten die Autoren noch einmal, ließen aber dieses Mal die Todesfälle der ersten Untersuchungsjahre unberücksichtigt. Das Ergebnis blieb: Gewichtsabnahme – egal, aus welchen Gründen – erhöht die Sterblichkeit.
Das Überraschende: Ganz gleich, ob die Versuchsteilnehmer zu Beginn der Studie unter-, normal- oder übergewichtig waren, die niedrigste Sterblichkeit fanden die Forscher immer bei denjenigen, die im Laufe ihres Lebens ein wenig zugenommen hatten. Das galt auch für fette Menschen! Selbst wer sein Gewicht plus/minus ein Kilo hielt, war – im statistischen Mittel – etwas schlechter dran als diejenigen, die leicht zunahmen.
Gewichtsverluste erhöhen die Sterblichkeit. Geringfügige Gewichtszunahmen senken sie. Die Zahlen am Ende der Säule geben an, wie viele Personen aus einer Gruppe von 1000 (rein rechnerisch) pro Jahr sterben.
Im Jahr 2005 wagten sich schwedische Forscher auf dieses in der Öffentlichkeit gern beschwiegene Terrain. Sie publizierten die Daten der sogenannten Nord-Trøndelag Health Study. Dafür waren jeweils 20.000 gesunde Frauen und Männer zehn Jahre lang beobachtet worden. Zunächst: Eine Gewichtszunahme hatte entgegen der üblichen Propaganda keinerlei nachteilige Folgen für die Sterblichkeit, das heißt im Klartext: Menschen, die im Laufe ihres Lebens zunehmen, sterben nicht früher als andere. Statt dessen verkürzt eine erfolgreiche Gewichtsabnahme das Leben der Gesundheitsbewußten: »Menschen, die abgenommen haben, weisen eine höhere Gesamtsterblichkeit auf als solche mit stabilem Gewicht.« Und die Sterblichkeit war nicht nur ein bißchen, sondern massiv erhöht: Bei Männern stieg sie im Schnitt um 60 Prozent und bei Frauen sogar um 70 Prozent! Je größer der Diäterfolg, desto früher landeten die Teilnehmer auf dem Friedhof. Fast identische Ergebnisse wie aus Israel und Schweden liegen mittlerweile auch aus England und Finnland vor.
Angesichts solcher Folgen kann selbst die Zigarettenindustrie nur noch müde lächeln.
Dicke
müssen früher sterben
Mit dem Body-Mass-Index (
BMI
) werden »überflüssige« Pfunde erkannt
Ballaststoffe
haben keine Kalorien
Literatur:
D. F. Williamson, E. R. Pamuk: The association between weight loss and increased longevity: a review of the evidence. Annals of Internal Medicine 1993/119/S. 731
N. Worm: Diätlos glücklich – Abnehmen macht dick und krank. Bern 1998
Autorenkollektiv: Abnehmen, um gesund zu sterben. EU.L.E.nspiegel – Wissenschaftlicher Informationsdienst des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften e. V. 1999, Heft 1
S. Yaari, U. Goldbourt: Voluntary and involuntary weight loss: associations with long term mortality in 9228 middle-aged and elderly men. American Journal of Epidemiology 1998/148/S. 546
W. B. Drøyvold et al.: Weight change and mortality: the Nord-Trøndelag Health Study. Journal of Internal Medicine 2005/257/S. 338
T. I. A. Sørensen et al.: Intention to loose weight, weight changes, and 18-y mortality in overweight individuals without co-morbidities. PLoS Medicine 2005/2/e171
S. G. Wannamethee et al.: Weight change, weight fluctuation, and mortality. Archives of Internal Medicine 2002/162/S. 2575
Acrylamid
Acrylamid in Pommes fördert Krebs
Still ist es geworden um das »Krebsgift«. Kein Wunder: Der Stoff mit dem bedrohlichen Ypsilon wird in immer mehr Produkten entdeckt, und noch dazu in den »falschen«. Gerade hat es den günen Tee erwischt. Japanische Forscher vom »Bundesinstitut für Gemüse- und Teewissenschaften« haben herausgefunden, daß ihr Nationalgetränk »beachtliche Gehalte« jener Substanz aufweisen kann, die vor wenigen Jahren nur Kunststoffchemikern geläufig war. Acrylamid hin, Krebsangst her, niemand vermiest den Japanern ihren geliebten Tee. Auch Italiener, Griechen und Spanier reagierten mit Gelassenheit, als sie erfuhren, daß sogar Oliven reichlich mit Acrylamid gesegnet sein können.
Es sind also beileibe nicht nur Pommes, Chips und Pizza, die unsere Gesundheit mit dem Schlagwort »Krebsgift« bedrohen. Bemerkenswerte Gehalte findet man auch in Lebkuchen, Pflaumensaft oder gebratenen Zwiebeln. Zu den Spitzenreitern zählen Produkte wie Ersatzkaffee oder Diätspekulatius. Doch erstaunlicherweise findet das kaum Widerhall in den Medien. Mag sein, daß die meisten Menschen einen großen Bogen um diese Leckereien machen. Aber es gibt einen Personenkreis, insbesondere Kinder, die tagtäglich Getreidekaffee konsumieren. Nichts wäre einfacher, als den Muckefuck-Müttern einen ordentlichen Mokka zu empfehlen und ihrem Nachwuchs eine heiße Schokolade. Kaffee enthält zwar auch Acrylamid – aber weniger.
Wenn etwas für das Thema Acrylamid typisch ist, dann seine irrationale Behandlung durch Behörden, Verbraucherschützer und Medien. Erinnern Sie sich noch an die dramatischen Ereignisse Ende April 2002? Schwedische Experten hätten Acrylamid in Kartoffelchips und Pommes entdeckt, eine Erkenntnis, die bei den Journalisten auf lebhaftes Interesse stieß. Die zuständigen Behörden traf die Nachricht nach eigenen Worten wie »ein Blitz aus heiterem Himmel«. Doch der plötzliche einsetzende Aktionismus läßt sich nur schwer begründen. Denn all dies war längst bekannt: Genau dieselben schwedischen Forscher hatten ihre Entdeckung bereits zwei Jahre vorher publiziert. Zur Veröffentlichung eingereicht hatten sie ihre Studie bereits 1999. Darin konnte jeder nachlesen, daß beim Erhitzen von Lebensmitteln Acrylamid entsteht und diese Substanz im Blut der Bevölkerung nachgewiesen werden kann. Doch damals interessierte sich niemand dafür. Der »Skandal« brach erst Jahre später los, ohne daß wirklich neue Erkenntnisse vorgelegen hätten. Der Zeitpunkt war klug gewählt. Viele Politiker nutzten sogleich die Chance, um sich nach dem vergeigten BSE-Krisenmanagement wieder als Hort des Verbraucherschutzes darzustellen.
Zugleich war es Wasser auf die Mühlen all jener, die immer schon geahnt haben, daß Pommes »ungesund« sind, aber nicht wußten warum. Der Fettgehalt taugt dafür nicht. Bei Backofenpommes liegt er bei mageren fünf Prozent und selbst McDonalds-Fritten entsprechen mit 16 Prozent dem Fettgehalt einer Butterstulle. Dank Acrylamid konnten die Ernährungswarner endlich den Zeigefinger erheben und ihren Kindern ein ebenso bewährtes wie nahrhaftes Gemüse vermiesen. Hatten die Wissenden nicht seit Jahren gepredigt, es sei besser, Gesundes zu mümmeln wie Knäckebrot, Magerquark oder Radieschen?
Doch dann sickerte durch, daß ausgerechnet Sesamknäcke stark acrylamidbelastet ist. Aber statt nun vor Knäckebrot zu warnen, verstummten die Kassandrachöre, wohl weil das Flaggschiff einer verklemmt-gesunden Kost – Knäcke mit Magerquark und Radieschen –»gesund« bleiben mußte. Sie meldeten sich erst wieder zu Wort, als den Acrylamidfahndern Bratkartoffeln und Rösti ins Netz gegangen waren. Da konnten die Aufklärerinnen ihrer besseren Hälfte endlich mit neuen Drohungen statt nahrhafter Kartoffelgerichte angesäuerte Salatvariationen anempfehlen. Im Advent entpuppte sich dann noch Weihnachtsgebäck aller Art als acrylamidbelastet. Prompt gab das deutsche Verbraucherministerium »Entwarnung«. Schließlich stand das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Wollte man die amtliche Entwarnung wirklich ernst nehmen, so kann sie nur bedeuten, daß Acrylamid mit steigender Dosis harmloser wird.
Dabei ist Acrylamid in höherer Dosis tatsächlich ein Gift. Aus toxikologischer Sicht stehen drei Wirkungen im Vordergrund: Da sind zunächst die neurotoxischen Effekte, namentlich Taubheit in den Fingern, die in chemischen Fabriken an Acrylamidarbeitern beobachtet wurden. Sie waren glücklicherweise in den meisten Fällen reversibel. An zweiter Stelle steht eine typische Gewichtsabnahme. Schlank durch Pommes? Das hat uns gerade noch gefehlt! Was würde denn nun aus den schönen »Fast food macht dick und krank«-Kampagnen? Die Aufklärer verweisen angesichts dieser Datenlage lieber darauf, daß Acrylamid im Tierversuch Krebs auslöst. Dummerweise passiert dies erst in einer Dosis, die um Zehnerpotenzen über den Gehalten im Essen liegt.
Wie krebserregend ist Acrylamid in Pommes für den Menschen tatsächlich? Dazu liegen inzwischen mehrere epidemiologische Studien vor: Die älteste stammt aus Schweden und erschien bereits im Januar 2003. Die Fall-Kontroll-Studie kam anhand von 1000 Krebsfällen zu einem unerwarteten Ergebnis: Wer zeit seines Lebens reichlich Acrylamidhaltiges verzehrt hatte, erkrankte seltener an Darmkrebs als der, der sich solche Genüsse stets versagt hatte. Das Resultat ist signifikant, die Senkung der Krebsrate durch Acrylamid beträgt satte 40 Prozent.
Kurz darauf folgte die zweite Studie, diesmal bereits mit 10.000 Probanden. Getestet wurden gezielt erhitzte Kartoffelprodukte wie Chips, Bratkartoffeln oder Pommes. Gleichgültig, wie man die Statistiken auch drehte und wendete, es kam nichts Belastendes dabei heraus. Die Krebsrate blieb unverändert. Im Mai 2004 wurde die Bedeutungslosigkeit von Acrylamid für Nierenkrebs bestätigt. Im Mai 2005 folgte eine weitere Studie: Diesmal ging es um Brustkrebs. Auch diesmal das gleiche Resultat. Nummer fünf, wir sind bereits im Jahr 2006, befaßte sich – diesmal prospektiv und mit 60.000 Frauen – wieder mit Darmkrebs. Ergebnis: wieder nix.
Warum ist ein krebserregender Stoff auf einmal harmlos? Das hat zwei Ursachen. Erstens findet im menschlichen Körper praktisch keine Umwandlung in Glycidamid statt. Das ist jener Stoff, der im Tierversuch bei hoher Acrylamidzufuhr für die Schädlichkeit verantwortlich ist. Zweitens, weil beim Frittieren, Backen, Kochen eines Lebensmittels viel mehr passiert als nur die Bildung von Acrylamid. Unter den neugebildeten Substanzen sind nicht nur krebserregende, sondern gleichermaßen auch krebsschützende. Als im Rahmen der Acrylamidangst weitere Röstprodukte geprüft wurden, stellte sich heraus, daß zwei von drei untersuchten Stoffen vor Krebs schützten – und zwar schon in minimalen Konzentrationen. Der Schutz war um so ausgeprägter, je dunkler die Röstprodukte und damit je stärker sie erhitzt waren.
Das vorläufige Ende der Acrylamidhypothese läutete Ende 2005 das »Deutsche Ärzteblatt«ein. Darin stellen Ärzte und Biometriker der Medizinischen Hochschule Hannover nach umfangreichen Messungen den Einfluß der Ernährung auf den Acrylamidgehalt des Blutes infrage. Nüchternes Fazit: »Ein Zusammenhang zwischen der Acrylamidbelastung und dem Ernährungsverhalten konnte nicht festgestellt werden.« Die Autoren stellen dafür die hochnotpeinliche Frage, ob das Acrylamid nicht vielleicht vom Körper selbst gebildet wird. Das sei schließlich auch von anderen vergleichbaren Stoffen bekannt.
Bis heute sind für den Menschen keinerlei gesundheitliche Risiken durch tradierte acrylamidhaltige Speisen nachgewiesen oder auch nur wahrscheinlich gemacht worden. Im Gegenteil, wir müssen befürchten, daß die Maßnahmen zur Minimierung des Acrylamidgehalts die Krebsrate sogar erhöhen werden. Aber es kommt noch schlimmer für die Acrylamidaktionisten: Kartoffelprodukte haben in der Vergangenheit immer wieder zu Vergiftungen geführt – aber nicht per Friteuse, sondern aufgrund ihres Gehaltes an natürlichen Toxinen, namentlich an Solanin und vor allem an Chaconin. Meist waren überlagerte Kartoffeln bzw. die Mitverwendung von Schalen und Keimen die Ursache.
Dieselben Gestalten, die vor Acrylamid warnen, empfehlen völlig bedenkenlos den Verzehr von Kartoffeln mit Schale. Und unsere Lebensmittelindustrie bietet so etwas sogar noch extra als Fast food für Kinder an: »Naturchips«, »Wedges« und wie sie alle heißen. Hauptsache, es klingt »ökologisch«, »gesund« oder »vollwertig«. Wo bleibt hier der allseits beschworene »vorbeugende Gesundheitsschutz«, dem sich die Behörden beim Acrylamid so verpflichtet sahen? Warum schweigen die Verbraucherschützer? Hier, verehrte Kolleginnen und Kollegen bei Industrie, Staat und Sonstwas-Schützern, eröffnet sich ein weites und dankbares Betätigungsfeld. Denn hier gab es im Gegensatz zum Acrylamid bereits Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen. Aber offenbar ist der »natürliche Tod« durch ein »natürliches Gift« kein Grund zur Sorge.
Fast food ist
Junk food
Zimt
sterne fördern Krebs
Muckefuck
heißt soviel wie »falscher Mokka«
Literatur:
M. Bader et al.: Querschnittsstudie zur ernährungs- und tabakrauchbedingten Belastung mit Acrylamid. Deutsches Ärzteblatt 2005/102/S. 2640
L. A. Mucci et al.: Prospective study of dietary acrylamide and risk of colorectal cancer among women. International Journal of Cancer 2006/118/S. 169
L. A. Mucci et al.: Dietary acrylamide and risk of renal cell cancer. International Journal of Cancer 2004/109/S. 774
L. A. Mucci et al.: Dietary acrylamide and cancer of the large bowel, kidney, and bladder: Absence of an association in a population-based study in Sweden. British Journal of Cancer 2003/88/S. 84
C. Pelucchi et al.: Fried potatoes and human cancer. International Journal of Cancer 2003/105/S. 558
M. Habermeyer et al.: Einfluss von Maillard-Reaktionsprodukten auf das Wachstum humaner Tumorzellen. Lebensmittelchemie 2003/57/S. 111
K. M. Wilson et al.: Dietary acrylamide and cancer risk in humans: a review. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2006/1/S. 19
B. G. Gold, H. H. Schaumburg: Acrylamide. In: P. S. Spencer, H. H. Schaumburg: Experimental and Clinical Neurotoxicology. Oxford 2000, S. 124
M. McMillan, J. C. Thompson: An outbreak of suspected soloanine poisoning in schoolboys. Quaterly Journal of Medicine 1979/48/S. 227
K. Matsui et al.: Toxic dose of unripe potato glycoalkaloids in children and measures against the food poisoning. Shokuhin Eisei Kenkyu 2001/51/S. 99
Alkohol
Alkohol ist immer noch eines der größten Gesundheitsrisiken
Wenn Sie schon immer gern ein Schöppchen Wein getrunken oder mal ein lecker Pils gezischt haben, dürfen Sie jetzt erleichtert aufatmen und sich heute abend noch eins genehmigen. Nach jahrzehntelangem erbittertem Kampf gegen den Gesundheitsfeind Nr. 1, den Teufel Alkohol, müssen Ärzte und Ernährungsexperten nun zähneknirschend zugeben, daß sie sich in einem ganz wesentlichen Punkt geirrt haben: Alkohol erhöht nämlich entgegen allen Prognosen die Lebenserwartung.
Kaum ein vermutetes Gesundheitsrisiko wurde so intensiv untersucht wie der Alkohol. Über 100 wissenschaftliche Studien aus den vergangenen 40 Jahren belegen, daß Menschen, die regelmäßig in Maßen Alkohol trinken, durchschnittlich gesünder sind oder länger leben als diejenigen, die auf Alkohol verzichten. Berühmtestes Beispiel ist die Augsburger MONICA-Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. Bei den männlichen Teilnehmern fanden die Forscher die höchste Lebenserwartung, wenn diese täglich 20–40 Gramm Alkohol zu sich nahmen; damit lägen eine halbe Flasche Wein am Tag oder eine Maß Bier wieder völlig im Rahmen. Bei Frauen waren die förderlichen Mengen um die Hälfte niedriger.
Erst mit über 80 Gramm pro Tag erreichten »Trinker« dieselbe Sterblichkeit wie Abstinenzler – das entspricht immerhin einer Flasche Wein pro Tag. Verständlich, daß die Experten bei solchen Ergebnissen erschüttert waren und (ausnahmsweise) an sich selbst zweifelten. Natürlich wollte sich niemand vorwerfen lassen, dem Alkoholismus Vorschub zu leisten. Zumal die Menge an Alkohol, die sich in den Studien als die gesundheitsförderndste herauskristallisiert hatte, bei vielen Fachleuten für Suchterkrankungen schon als sicheres Zeichen einer Abhängigkeit gewertet wird.
Aber die Erkenntnisse zur positiven Wirkung des Alkohols dürfen als gesichert angesehen werden. Viele der Studien waren prospektiv angelegt, das heißt, die Teilnehmer wurden über Jahre hinweg wissenschaftlich begleitet und nicht etwa einmal rückblickend (retrospektiv) zum Konsumverhalten vergangener Jahre befragt, was eine erhebliche Unsicherheitsquelle darstellt. Auch die Zunahme von Lebererkrankungen bei steigender Alkoholzufuhr ändert nichts am Trend. Denn gleichzeitig nehmen andere, häufige Krankheiten – vor allem Herzinfarkt und Schlaganfall – ab, und das in viel größerem Ausmaß. Die positiven Wirkungen des regelmäßigen Alkoholkonsums überwiegen in aller Regel seine negativen Begleiterscheinungen.
Daß diese Ergebnisse auf Unverständnis stoßen, hängt wohl auch damit zusammen, daß sich viele Experten einfach nicht vorstellen können, wie der Alkohol seine nützlichen Effekte ausübt. Schließlich hat sich die Forschung der letzten Jahrzehnte darauf beschränkt, ausschließlich mögliche Schadwirkungen zu verfolgen. Doch paradoxerweise ist die Naturheilmedizin ohne ihn fast undenkbar. Mit Alkohol werden die Wirkstoffe aus den Heilpflanzen gelöst und dem Organismus zur Verfügung gestellt. In nicht wenigen »rein pflanzlichen« Präparaten (auch homöopathischen) ist Alkohol in deutlich höherer Konzentration enthalten als in üblichen Spirituosen. Was, wenn der Wein zum oder der Schnaps nach dem Essen genau denselben Zweck erfüllt, nämlich dem Körper die hochgelobten pflanzlichen Inhaltsstoffe aus Radi oder Ruccola verfügbar macht? Dann wäre das Obst im Rumtopf besser aufgehoben als in der Salatschüssel.
Vielleicht ist der Wirkungsmechanismus aber noch viel einfacher: Alkohol wird entweder zum Essen, abends nach der Arbeit oder vor dem Einschlafen konsumiert. In allen drei Fällen dient er der Entspannung. Er soll vor allem abends helfen, den Streß des Tages zu lösen, den Ärger verdampfen zu lassen, er soll dem vom Alltag Geplagten helfen, wieder ein ausgeglichener Mensch zu werden. Diese Funktion bedeutet biochemisch betrachtet nichts anderes als eine Senkung des Cortisolspiegels. Dadurch beugen alkoholische Erzeugnisse dem metabolischen Syndrom vor. Es mag jeder selbst entscheiden, ob er Psychopharmaka (Vorsicht: Leberschäden und Suchtgefahr!) einnehmen oder lieber eine Flasche Bier trinken will.
Jetzt werden die Abstinenz-Ideologen und Moralapostel aufspringen und einwerfen, man dürfe den Alkoholmißbrauch doch nicht bagatellisieren und schon gar nicht mit gesundheitlichen Vorteilen »bewerben«. Halt! Mit der gleichen Logik könnte man auch verlangen, daß Apotheker ihren Kunden etwas über Medikamentenmißbrauch und Arzneimittelschäden erzählen – ob die es hören wollen oder nicht. Und warum verpflichtet man nicht die Autoverkäufer, über die scheußlichen Unfälle zu sprechen, die tagtäglich auf unseren Straßen passieren? Auch könnte man jedem Küchenmesser eine aufklärerische Warnschrift mit scheußlichsten Fotos beilegen, daß derlei Geräte leider gelegentlich als Mordwaffen verwendet würden. Damit beim Griff zum Brotmesser auch wirklich jeder daran denkt: Nicht die Gattin – nur das Brot! Ach, übrigens: Abstinenzler haben mehr krankheitsbedingte Fehlzeiten im Job als Menschen, die pro Woche bis zu einer Flasche Whisky leeren. In dieser Studie handelte es sich bei den Abstinenzlern nicht etwa um »trockene« Alkoholiker, sondern um Menschen, die sich ganz bewußt gegen den Alkohol entschieden hatten.
Warum lässt sich hierzulande keine öffentliche Diskussion auf Grundlage sauberer, wissenschaftlicher Daten führen? In den prohibitionsgeprüften, puritanischen USA scheint das inzwischen eher möglich zu sein. Da lesen wir in den »Dietary Guidelines for Americans«: »Bei mäßigem Konsum kann Alkohol positive Wirkung haben. Die niedrigste Gesamtsterblichkeit wurde bei einem bis zwei Drinks pro Tag beobachtet.« An anderer Stelle heißt es »Wer Tätigkeiten ausübt, die Aufmerksamkeit, Präzision und/oder Koordination erfordern, sollte auf Alkohol verzichten« und »Es ist auf keinen Fall empfehlenswert, aus gesundheitlichen Überlegungen mit dem Trinken von Alkohol zu beginnen«. Ein Gläschen in Ehren … aus Freude und Genuß ja – aber bitte nicht wegen der erhofften Gesundheit!
Nur
Wein
ist gut fürs Herz
Die mediterrane Küche ist das Vorbild für die
Mittelmeerdiät
Literatur:
US Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans 2005
J. Vahtera et al.: Alcohol intake and sickness absence: a curvilinear relation. American Journal of Epidemiology 2002/156/S. 969
J. Kauhanen et al.: Beer binging and mortality: results from Kuopio ischaemic heart disease risk factor study, a prospective population based study. British Medical Journal 1997/315/S. 846
E. B. Rimm et al.: Moderate alcohol intake and lower risk of coronary heart disease: meta-analysis of effects on lipids and haemostatic factors. British Medical Journal 1999/319/S. 1523
K. Nanchahal et al.: Alcohol consumption, metabolic cardiovascular risk factors and hypertension in women. International Journal of Epidemiology 2000/29/S. 57
R. L. Sacco et al.: The protective effect of moderate alcohol consumption on ischemic stroke. Journal of the American Medical Association 1999/281/S. 53
Autorenkollektiv: Wein auf Rezept. EU.L.E.nspiegel – Wissenschaftlicher Informationsdienst des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften e. V. 1997, Heft 3
H. Brenner et al.: The association between alcohol consumption and all-cause mortality in a cohort of male employees in the German construction industry. International Journal of Epidemiology 1997/26/S. 85
C. Power et al.: U-shaped relation for alcohol consumption and health in early adulthood and implications for mortality. Lancet 1988/352/S. 877
M. Bobak et al.: Effect of beer drinking on risk of myocardial infarction: population based case-control study. British Medical Journal 2000/320/S. 1378
Antioxidanzien
Antioxidanzien fangen Radikale
Im Prinzip stimmt die Aussage, denn die Lebensmittelindustrie macht es seit Jahrzehnten vor. Antioxidanzien sind dort bewährte Zusatzstoffe, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern, sie schützen vor dem Ranzigwerden, vor Farbverlusten oder Geschmacksveränderungen. Allerdings bedarf es dazu besonderer Vorkehrungen. Die wichtigste ist, daß Antioxidanzien nur in geringer Dosis »Radikale fangen«. Sie reagieren schneller mit den Radikalen als die gefährdeten Lebensmittelinhaltsstoffe. Dabei werden sie selbst zum Radikal. Deshalb wirken Antioxidanzien nur in einem engen und niedrigen Konzentrationsbereich. In höherer Dosis schlägt ihre Wirkung ins Gegenteil um: Sie werden zu Prooxidanzien und beschleunigen den Verderb.
Um die Gefahr der Prooxidation einzudämmen, werden zusätzlich sogenannte Synergisten zugesetzt. Synergisten wie Zitronensäure binden kleinste Spuren von Eisen und Kupfer, die die Wirksamkeit von Antioxidanzien aufheben und diese sogar in Prooxidanzien verwandeln können. Zugleich muß der Säuregrad (pH-Wert) stimmen und das Antioxidans gleichmäßig im Lebensmittel verteilt sein. Und natürlich muß man wissen, welche Radikale man »fangen« will, um das passende Antioxidans nehmen zu können. Nur unter diesen Bedingungen gelingt es, radikalische Reaktionen zu verzögern.
Kein Lebensmittelhersteller wird auf die Idee verfallen, zur Verhinderung der Oxidation Megadosen beliebiger Antioxidanzien zuzusetzen. Ein Vorgehen nach dem Motto »viel hilft viel« würde seine Produkte ruinieren. Deshalb sind die Gehalte an Antioxidanzien in Fertigprodukten fast immer optimal. Wer Vitaminpillen schluckt, hat jedoch keine Möglichkeit, zu kontrollieren, was in seinem Körper tatsächlich passiert. Bereits das im Blut enthaltene Eisen vereitelt die erhoffte antioxidative Wirkung.
Beta-Carotin
schützt Raucher vor Lungenkrebs
Antioxidative Vitamine schützen vor
Krebs
Literatur:
E. Lück, P. Kuhnert: Lexikon Lebensmittelzusatzstoffe. Hamburg 1998
H. G. Classen et al.: Toxikologisch-hygienische Beurteilung von Lebensmittelinhalts- und -zusatzstoffen sowie bedenklicher Verunreinigungen. Berlin 1987
V. Herbert et al.: Vitamin C-driven free radical generation from iron. Journal of Nutrition 1996/126/S. 1213S
Die Welt der Radikale, Pro- und Antioxidanzien
Nach einer der vielen Hypothesen zur Krebsentstehung soll »oxidativer Streß« daran schuld sein, daß die Zellen zu wuchern beginnen. Den Streß »machen« sogenannte freie Radikale, die unter anderem die Zellmembranen und die Erbsubstanz schädigen. Ja, in unserem Körper tobt ein ständiger Kampf: die Guten gegen die Bösen, wie im Kino. Die Schurken sind in diesem Fall die Radikale. Sie sind überall und außerdem an allem schuld – am Altern, an der Arterienverkalkung und natürlich am Krebs. Auf der anderen Seite stehen die Antioxidanzien – dazu zählen vor allem die Vitamine C und E sowie das Beta-Carotin – als brave Körperpolizei, die sich nach Kräften bemüht, die aggressiven Radikale unschädlich zu machen.
Im Film käme jetzt eine Rückblende: Wer sind diese Radikale überhaupt, und weshalb sind sie so aggressiv? Sie kennen die Streifen, in denen jemand der Mafia einen Koffer mit Geld entwendet oder per Zufall in den zweifelhaften Genuß der Millionen kommt? Auf einmal sind alle hinter dem Geldkoffer her, und einer entreißt ihn dem anderen. Dabei nehmen nicht selten ein paar Mitspieler, Autos und Einrichtungsgegenstände Schaden. So ähnlich ist es mit Molekülen und ihren Elektronen. Radikale sind gewöhnliche Moleküle, häufig Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron »geklaut« wurde. Dieses Elektron wollen sie nun partout wiederhaben. (Anders als bei der Geschichte mit dem Geldkoffer muß es aber nicht dasselbe Elektron sein.) Und wie die Gangster entfalten sie beachtliche Energie, um dieses Ziel zu erreichen.
Für den Körper sind Radikale nicht grundsätzlich von Schaden. Im Gegenteil, sie sind für ihn sogar so wichtig wie für uns das Geld. Es sollte nur nicht in falsche Hände geraten, sondern vernünftig eingesetzt werden. Radikale sind in so lebenswichtige Prozesse wie die Energiegewinnung und die Abwehr von eingedrungenen Krankheitserregern eingebunden. Dort wird ihr »energisches Temperament« allerdings in Bahnen gelenkt. Die Weitergabe der Elektronen erfolgt »unter Aufsicht« und wie beim Staffellauf von einer Station an die nächste. Sobald ein Radikal entsteht, gibt ein »Hilfsmolekül« ein Elektron ab und sorgt für den nötigen Ausgleich. Diese chemische Reaktion heißt Oxidation, und weil das »Hilfsmolekül« durch sein Eingreifen verhindert, daß andere Moleküle oxidiert werden, nennt man diese Art von Hilfspolizisten »Antioxidanzien« oder »Radikalfänger«.
So wie im richtigen Leben immer wieder mal Geld abhanden kommt, entwischen dem Körper gelegentlich ein paar Gesuchte. Diese »freien« Radikale können dann für Zellmembranen, Proteine oder die Erbsubstanz DNA zur Gefahr werden, wenn sie dort auf »Elektronenklau« gehen. Sie können aus den unterschiedlichsten Quellen stammen. Radikale entstehen bei Verbrennungen (Tabakrauch), durch das Einatmen des Luftsauerstoffs oder durch die Sonnenstrahlen, die unsere Haut erreichen. Deshalb gehören für unseren Körper freie Radikale zum Alltag. Und aus eben diesem Grund verfügt der Körper über zahlreiche Werkstätten, deren Aufgabe darin besteht, alle Zellen und Zellbestandteile zu inspizieren und sie bei Bedarf zu reparieren.
Zurück zur Haupthandlung. Viele Beobachter glaubten, daß der Körper überfordert sein könnte und deshalb Hilfe von außen bräuchte. Deshalb empfahlen sie die Zufuhr antioxidativer Substanzen, wie zum Beispiel von Vitaminen, zur Verstärkung der Körperpolizei und um die Werkstätten zu entlasten. Hätten sie mit ihrer Annahme recht, sollte die Einnahme von Antioxidanzien die Krebsentstehung zumindest verringern. Doch diese Versuche gingen bisher gründlich schief. In manchen Studien starben nicht weniger, sondern mehr Raucher an Lungenkrebs, wenn sie das Antioxidans Beta-Carotin einnahmen. Auch die anderen antioxidativ wirkenden Vitamine hatten keinerlei Nutzen.
Fiasko auf der ganzen Linie. Wie kann das sein? Wo liegt der Denkfehler? In unserem Körper herrscht ein sehr empfindliches Gleichgewicht zwischen oxidierenden und oxidierten Substanzen, und viele können von der einen Form in die andere wechseln und wieder zurück. Wie sie sich im Einzelfall verhalten, hängt von den Reaktionspartnern, vom Milieu (ja, das gibt’s in der Chemie auch), vom Sauerstoffgehalt und nicht zuletzt von ihrer Konzentration ab. Gibt man einen Reaktionspartner, zum Beispiel ein antioxidativ wirkendes Vitamin, im Übermaß zu, gerät das Gleichgewicht aus den Fugen. Der Stoff, der eigentlich den oxidativen Streß verhindern sollte, wird dann selbst zum Streßfaktor: weil sich Radikalfänger beim Fangen von Radikalen selbst in »freie Radikale« verwandeln und dann zu all den Schandtaten in der Lage sind, die vorher dem »oxidativen Streß« angelastet wurden.
Es ist wie im wirklichen Leben: Die Bösen sind manchmal doch nicht so übel, und selbst die Helden tragen ein dunkles Hemd unter ihrer weißen Weste. Auf die Umstände kommt es an. Alles andere ist Kino.
Literatur:
E. F. Elstner: Sauerstoffabhängige Erkrankungen und Therapien. Mannheim 1993
P. Sykes: Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie. Weinheim 1976
Autorenkollektiv: Antioxidantien-Update: Radikalfänger auf Kundenfang. EU.L.E.nspiegel – Wissenschaftlicher Informationsdienst des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften e. V. 1999, Heft 9
V. Herbert: The antioxidant supplement myth. American Journal of Clinical Nutrition 1994/60/S. 157
I. D. Podmore et al.: Vitamin C exhibits pro-oxidant properties. Nature 1998/392/S. 559
O. I. Aruoma: Nutrition and health aspects of free radicals and antioxidants. Food and Chemical Toxicology 1994/32/S. 671
Anon.: Vitamine A, C, E und Betakarotin: Wie nützlich sind Antioxidantien? arznei-telegramm 2003/H. 11/S. 100 & H. 12/S. 111
S. Heyden: Das Ende der Supplementierung mit antioxidativen Vitaminen. Aktuelle Ernährungsmedizin 2003/28/S. 113
G. Bjelakovic, C. Gluud: Surviving antioxidant supplements. Journal of the National Cancer Institute 2007/99/S. 742
Wir sollten uns immer reichlich mit Antioxidanzien versorgen
Wenn »Radikalfänger« so wichtig sind, wie die Werbung suggeriert, warum empfiehlt sie dann nicht wirksamere Antioxidanzien als Vitamin C oder E? Viel potenter sind beispielsweise die Zusatzstoffe E 320 (Butylhydroxyanisol) und E 231 (Butylhydroxytoluol). Davon profitieren alle Genießer von Kaugummis, Pommes und Pralinen. Sicher, die E-Nummer nährt den Verdacht, daß es sich um künstliche Antioxidanzien handelt. Richtig. Wenn überhaupt, dann wollen Sie lieber natürliche Stoffe für Ihre Gesundheit? Kein Problem!
Da gäbe es zum Beispiel die zahlreichen phenolischen Verbindungen in Obst, Gemüse und Rotwein, die angeblich das Herz vor Infarkt und den Rest des Körpers vor Krebs schützen. Wenn diese Verbindungen so vorteilhaft sind, dann müßten die Ernährungsexperten zum Konsum jenes Lebensmittels raten, das nach bisheriger Kenntnis am reichhaltigsten damit gesegnet ist: Kakao. Täglich einen Pausenriegel statt einer großen Schüssel Kopfsalat. Die Natur hat aber noch Wirksameres zu bieten: Der stärkste bekannte natürliche »Radikalfänger« ist das krebserregende Kondensat der Zigarette. Es verhindert wie kein anderer Naturstoff die Oxidation des Cholesterins – sogar in Gegenwart so gefährlicher Prooxidanzien wie Kupfer. Mit der gleichen biochemischen Logik, mit der Vitamine verkauft werden, ließen sich auch besonders teerhaltige Zigaretten vermarkten.
Daß ein Stoff antioxidativ wirkt, will also nicht viel heißen. Die chemische Industrie verfügt über eine breite Palette an Antioxidanzien, um damit Autobenzin und Düsentreibstoffe vor Verharzung zu schützen, Trafoöle vor der Schlammbildung oder Plastik vor der Alterung. Allein für Lebensmittel werden über 30 antioxidative Zusatzstoffe verwendet. Die Idee, daß eine antioxidative Wirkung für den Körper stets von Vorteil ist, wird spätestens dann eine riskante Farce, wenn man bedenkt, daß manche Antioxidanzien sogar als Pestizide (zum Beispiel Dithiocarbamate) eingesetzt werden. Andere sind bewährte Arzneimittel, unter anderem Antibiotika (Tetracycline, Penicillin G, Rifampicin und Streptomycin) oder Medikamente gegen die Parkinson-Krankheit (Selegeline) und Epilepsie (Barbiturate). Selbst manche giftigen Naturstoffe besitzen antioxidative Eigenschaften, etwa das Mykotoxin Citrinin, ein starkes Nierengift. Es ist als Antioxidans genauso wirksam wie Vitamin E.
Die Frage, ob eine Substanz ein Antioxidans ist, mag aus technischer Sicht wichtig sein, aus biologischer Sicht erlaubt sie keine Vorhersage der Wirkung im Organismus. Dabei spielt auch keine Rolle, ob ein Stoff natürlichen Ursprungs ist wie Citrinin, naturidentisch wie Vitamin-C-Präparate oder künstlich wie viele Pflanzenschutzmittel.
Freie
Radikale
haben im Körper nichts verloren
Literatur:
E. F. Elstner: Der Sauerstoff. Biochemie, Biologie, Medizin. Mannheim 1990
F. Shahidi, M. Naczk: Food phenolics: sources, chemistry, effects, applications. Lancaster 1995
S. L. Wilkinson: Take two cups of coffee and call me tomorrow. Chemical Engineering News 12.4.1999/S. 47
J. A. Vinson et al.: Phenol antioxidant quantity and quality in foods: cocoa, dark chocolate, and milk chocolate. Journal of Agricultural and Food Chemistry 1999/47/S. 4821
C. Chen, G. Loo: Cigarette smoke extract inhibits oxidative modification of low density lipoprotein. Atherosclerosis 1995/112/S. 177
Apfelsaft
Naturtrüber Apfelsaft ist von Natur aus trüb
Soviel wissen auch die Großstadtkinder: »Echter« Apfelsaft ist trüb, denn er kommt ungefiltert direkt aus der Presse in die Flasche. Was sie meist nicht mehr wissen, ist, daß sich die Trübstoffe bei solchen »echten« Säften nach einiger Zeit am Boden der Flasche absetzen. Aber das finden viele Menschen nun wieder eklig. Was tut also der Safthersteller, der seinen Kunden statt der unmodern gewordenen klaren die »natürlichen« trüben Säfte – aber ohne Bodensatz – verkaufen will? Er gibt sich Mühe und verlängert den Produktionsprozeß um ein paar Schritte.
Die Grundlage der allermeisten Säfte ist das Konzentrat. Konzentrat spart Transportkosten, weil es ja überall Wasser zum Verdünnen gibt. Die Herstellung läuft meist gleich ab. Erst werden die gewaschenen Äpfel zerkleinert und zu Mus gemacht. Enzymzusätze sorgen dafür, daß sich die Zellwände des Fruchtfleisches auflösen und selbst zu Saft werden. Das erhöht die Ausbeute. Mit verschiedenen Filtern und in mehreren Stufen trennt man erst die gröberen Fruchtfleischfetzchen, dann den Feintrub und schließlich einen Teil des Wassers vom Saft ab. Die klare und aufkonzentrierte Flüssigkeit wird nun in sogenannten Verdampfern zum Konzentrat eingedickt. Weil dabei auch die Aromastoffe mitverdampfen, müssen diese eigens abgetrennt oder zurückgewonnen werden.
Das aromafreie Konzentrat liefert den Grundstoff für unseren »Apfelsaft«. Durch Zumischen von Aroma und Verdünnen mit Wasser kann jede Firma ihren »eigenen« Markensaft mixen. Er ist allerdings wasserklar und kein bißchen »naturtrüb«. Das Problem läßt sich jedoch mit speziellen Trübungsmitteln lösen, die keinen nennenswerten Bodensatz bilden. Sie erhält man, wenn man beispielsweise die Filterrückstände vermahlt und homogenisiert. Das spart die Entsorgung und erfüllt den Kundenwunsch: Weil sie kleiner und damit leichter sind als die »echten« Trübstoffe, bleiben sie länger in der Schwebe und setzen sich kaum in der Flasche ab. Wenn das noch nicht reicht, helfen mäßige Zusätze an Natriumcarboxymethylcellulose und Propylenglykolalginat, die allerdings in Deutschland verboten sind.
Das wohl pfiffigste Verfahren, um im Naturtrüben zu fischen, steuerte eine deutsche Saftfabrik bei. So wird’s gemacht: Äpfel mahlen, mit Ascorbinsäure versetzen und durch ein Sieb passieren. Das Mus mit der gleichen Menge Wasser versetzen, im Vakuum entgasen und erhitzen. Schließlich wird der Brei homogenisiert und der Anteil entfernt, der sich absetzen könnte. Das, was übrigbleibt, macht klare Säfte naturtrüb, und zwar so, daß sie ohne weiteres ein Jahr im Regal stehenbleiben können, ohne unappetitlich zu wirken.
Natürlich ist es auch heute noch möglich, naturtrübe Säfte ohne Trübungsmittel herzustellen, allerdings mit dem Nachteil, daß sie den oft unerwünschten Bodensatz bilden. Wer auf Nummer Sicher gehen will, muß seinen Saft entweder selbst pressen, eine Kelterei auf dem Lande auftun und dabei zusehen, wie die Äpfel in die Flasche kommen, oder einen sogenannten Direktsaft kaufen. Aber auch der wandert nicht immer direkt in die Flasche: Inzwischen gibt es einen lebhaften Handel mit Saft, der tiefgefroren in großen Fässern nach Deutschland geschafft, aufgetaut und abgefüllt wird.
»Fünf am Tag«
schützt vor Krebs und anderen chronischen Erkrankungen
Trinken
: Man soll trinken, bevor man Durst hat
Literatur:
U. Schobinger: Handbuch der Lebensmitteltechnologie: Frucht- und Gemüsesäfte. Stuttgart 1987
Eckes Aktiengesellschaft: Verfahren zur Herstellung von trubstabilen, naturtrüben Fruchtgetränken sowie danach hergestelltes Fruchtgetränk. Europäische Patentschrift 642 744 vom 22.10.1997
Aromen
Natürliche Aromen stammen aus der Frucht, nach der sie schmecken
Daß Kirschjoghurt aus dem Supermarkt nach Kirschen schmeckt, wird niemand ernsthaft behaupten, der jemals frische Kirschen gekostet hat. Wie sieht es mit anderen Geschmacksrichtungen aus, zum Beispiel Pfirsich, Kokos oder Nuß? Besser? Haben Sie schon mal versucht, selbstgemachten Joghurt mit zerkleinerten Haselnüssen anzureichern? Also, auf diesem Weg kann weder Nuß- noch sonstiger Fruchtgeschmack in ein Milchprodukt gelangt sein. Der achtel Pfirsich, die paar Kirschen oder Nüsse, die in einem handelsüblichen 150-Gramm-Becher Platz hätten, könnten sich nie und nimmer gegen den Eigengeschmack von Joghurt durchsetzen. Nein, es ist klar und steht ja auch auf den Etiketten: Hier wird mit »natürlichem Aroma« nachgeholfen. Na ja, wenigstens ein natürliches und kein künstliches Aroma!
Doch es irrt, wer glaubt, Pfirsicharoma werde aus Pfirsichen und Nußaroma aus Nüssen gewonnen. Nach dem deutschen Lebensmittelrecht muß ein natürliches Aroma lediglich in der Natur vorkommen, das heißt, es kann auch von ganz anderen Organismen erzeugt werden als von denen, deren Namen es trägt. Und wie überall, wo es auf den Preis ankommt, gehen die Technologen den billigeren Weg: Statt mühsam das Originalaroma aus Früchten zu extrahieren (das wäre ja teurer, als tatsächlich Früchte in den Fruchtjoghurt zu tun!), lassen sie lieber ähnlich schmeckende Substanzen von Bakterien und Pilzen in speziellen Tanks, sogenannten Fermentern, herstellen. Auf diese Weise konnte der Preis für ein Kilogramm Pfirsichgeschmack von 20.000 auf 1.200 US-Dollar gesenkt und die Geschmacksintensität erhöht werden; Produzent des Pfirsicharomas ist der hefeähnliche Pilz Sporobolomyces odorus. Der Bodenpilz Trichoderma viride macht auf Kokosnuß, der Baumpilz Trametes odorata sorgt für Anis- und Honigduft, die Mikroben Bacillus subtilis und Corynebacterium glutamicum liefern das gewöhnliche Nußaroma.
Die Leute von der Aromenwirtschaft verstehen bis heute nicht, warum die Menschen lieber natürliche Aromen essen als naturidentische. Können Sie das verstehen?
Zimt
sterne fördern Krebs
Zuckerkulör
ist ein natürlicher Farbstoff
Vanillearoma
kommt aus der Vanilleschote
Literatur:
G. Matheis: Natürliche Aromen und ihre Rohstoffe. Dragoco Bericht 1989, Heft 2, S. 43
G. Feron et al.: Prospects for the microbial production of food flavors. Trends in Food Science and Technology 1996/7/S. 285
Aromenverordnung vom 15.05.2006 (BGBl I S. 1127)
U. Pollmer, M. Niehaus: Food-Design: Panschen erlaubt. Stuttgart 2006
Naturidentische Aromen sind identisch mit ihren Vorbildern in der Natur
Der gute alte Orwell hätte seine Freude gehabt an den Definitionen und Sprachregelungen der Lebensmitteljuristen. Während der naive Verbraucher glaubt, »identisch« sei »genau gleich«, darf man in dieser Branche auch »identisch« nennen, was etwas ganz anderes ist – und vielleicht nur so schmeckt »als ob«.
Jedes Aroma – egal, ob Erdbeer, Vanille, Hering oder Schinken – besteht aus vielen Einzelkomponenten, von denen einige stärker hervortreten, sozusagen die charakteristische »Kopfnote« bilden, andere mehr zur Abrundung beitragen, ganz ähnlich wie bei einem Parfüm. Kein Wunder, denn alles, was wir außer den Grundqualitäten süß, sauer, bitter und salzig schmecken, sind Sinneseindrücke, die uns über die Nase, also über den Geruchssinn, erreichen. Typisch auch, daß wir nur ein Gesamtbild wahrnehmen und einen Geschmack, den wir als »Toffee« oder »Waldbeeren« identifizieren, nicht in die Einzelteile auflösen können, aus denen er sich zusammensetzt.
Zunächst heißt »naturidentisch« schlicht »synthetisch«. Als »synthetisch« bezeichnet man alle Stoffe, die zwar in der Natur vorkommen, die aber im Labor auf chemischem Wege nachgebaut wurden. Im Falle von Aromastoffen ist es allerdings gar nicht so einfach, die natürlichen Vorbilder nachzuahmen. Es gibt nämlich Moleküle, die sich zueinander verhalten wie linke und rechte Hand bzw. Bild und Spiegelbild. Das an sich wäre ja nicht schlimm, nur riechen sie auch verschieden! Zum Beispiel das eine nach Orange und das andere nach Terpentin oder nach Flieder bzw. kalter Pfeife oder nach Minze bzw. Kümmel. Mutter Natur schafft es, in den Pflanzen schwerpunktmäßig nur die eine Sorte zu verfertigen – im Gegensatz zur chemischen Synthese, bei der zu gleichen Teilen »Bild« und »Spiegelbild« entstehen. Zwar wäre es möglich, sie aufzutrennen, aber dann wären die »naturidentischen« Aromen ziemlich teuer. Also steckt man das Minze-Kümmel-Aroma beispielsweise in einen Kräuterquark, denn das paßt ja. Und wenn die Kombination mal nicht genehm ist, sucht man nach weiteren Substanzen, die den unerwünschten Beigeschmack kaschieren.
So weit, so gut. Doch »naturidentisch« erlaubt weitere Abweichungen von der »Natur«. Ein Aroma besteht, wie gesagt, aus zahlreichen Aromastoffen. Erst durch die Kombination unterschiedlichster Komponenten entsteht ein Aroma, das typisch nach »Kaffee« oder nach »Erdbeere« duftet. So finden sich im echten Bohnenkaffee Duftstoffe, die für sich allein nach Raubtierurin, Bratfisch oder Suppenwürze riechen. Das erweitert wiederum die Möglichkeiten der Food-Designer beträchtlich. Denn synthetisch hergestellt, bieten diese Stoffe eine Basis für ein naturidentisches Bratfisch- oder Suppenaroma – unabhängig davon, aus welchen Substanzen Bratfisch- oder Suppenaroma tatsächlich bestehen.
Fassen wir zusammen: Für ein naturidentisches Aroma werden oftmals Aromastoffe synthetisiert, die in dem Aroma, das nachgeahmt werden soll, gar nicht vorkommen. Voraussetzung für die Einordnung als »naturidentisch« ist nur, daß die Stoffe, die man recht und schlecht nachahmt, irgendwo in der Natur ein Vorbild haben. Egal, ob im Kaffee, Bratfisch oder Raubtierurin.
Alle
Zusatzstoffe
sind gesundheitlich unbedenklich
Literatur:
G. Reineccius: Source Book of Flavors. New York 1994
P. Werkhoff et al.: Chirospecific analysis in essential oils, fragrance and flavor research. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung 1993/196/S. 307
K. J. Burdach: Geschmack und Geruch. Gustatorische, olfaktorische und trigeminale Wahrnehmung. Bern 1988
Aromenverordnung vom 15.05.2006 (BGBl I S. 1127)
Anon.: Natürlich oder naturidentisch? In: Campus Niederursel. Forschergruppen am Biozentrum. (Broschüre der Johann Wolfgang Goethe-Universität) Frankfurt a. M., 1994, S. 20
Backfisch
Der Backfisch hat nichts mit Backen zu tun
Der
Bismarckhering
hat nichts mit dem Reichskanzler Bismarck zu tun
Muckefuck
heißt soviel wie »falscher Mokka«
Literatur:
A. J. Storfer: Wörter und ihre Schicksale. Gütersloh, ohne Jahr
W. Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin 1993
J. Grimm, W. Grimm: Der digitale Grimm: deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm
Grimm. Elektronische Bearbeitung der Erstausgabe. Zweitausendeins, Frankfurt a. M. 2004
Ballaststoffe
Ballaststoffe sind unschädliche Abführmittel
Unter »Ballast« versteht man laut Wörterbuch eine »wertlose Fracht zum Ausgleich des Gewichts oder (bei Schiffen) des Tiefgangs; unnützes Beiwerk, Bürde, Last, Belastung«. Und so werden die Ballaststoffe in der Regel auch empfunden – seien sie in der Nahrung enthalten oder in Form von Weizenkleie, Pektin oder Leinsamen zugesetzt. Ein notwendiges Übel, eine Masse, die unverändert durchläuft und außer einer Vergrößerung der Stuhlmenge nichts bewirkt.
Damit tut man ihnen bitter Unrecht. Denn die Ballaststoffe sind beileibe kein Einheitsbrei, sondern höchst unterschiedliche Substanzen – mit ebenso unterschiedlichen Wirkungen. Viel wichtiger: Ganz nebenbei bringen sie, gleichsam huckepack, häufig noch pflanzliche Abwehrstoffe, Phytoöstrogene und andere sekundäre Pflanzenstoffe, aber auch Rückstände von Pestiziden oder Schimmelgiften mit. Und das sind je nach Pflanze, aus der sie stammen, ganz unterschiedliche Substanzen. Dasselbe gilt auch für ihre Wirkungen. Das Bild vom reaktionslosen Ballaststoffklumpen kann ebensowenig aufrechterhalten werden wie die pauschale Idee vom wundertätigen »Faserstoff«.
Der Darm ist ein ähnlich mißverstandenes »Wesen« wie die Ballaststoffe. Keinesfalls ein tumber Kanal, der mit hartem Faserbesen ausgekehrt werden muß, wie viele Naturheilkundler glauben, wenn sie ihren Patienten ballaststoffreiche Kost empfehlen, um deren Darm »mechanisch zu reinigen«. Im Gegenteil, der Darm ist ein mit einer feinen Schleimhaut ausgekleidetes, hochsensibles Organ, bei dem ein solches Ansinnen nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Er beherbergt zusätzlich zahlreiche Untermieter, die Darmflora, mit der er arbeitsteilig in lebenslanger Symbiose lebt. Gegen Kost und Logis unterstützen die Mikroben den Darm nicht nur beim Verdauen, sondern sie stehen auch an vorderster Front bei der Abwehr von Krankheitserregern und liefern ihrem Vermieter, dem Menschen, darüber hinaus auch ein paar wichtige Nährstoffe.
Wenn es um die Ballaststoffe geht, hängt alles an diesen Untermietern, denn die Verdauungssäfte des Menschen vermögen den robusten Pflanzenbestandteilen nichts anzuhaben. Die Bakterien hingegen sind in der Lage, einen Teil der Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren abzubauen. Kommen jedoch zu große Ballaststoffmengen auf einmal an, ist auch eine gesunde Darmflora bald überfordert. Statt einer geregelten Verdauung entstehen nicht nur unerwünschte, weil »sozial unverträgliche« Darmgase, sondern auch giftige Gärungsalkohole, die auf Dauer die Darmschleimhaut und das Immunsystem schädigen.
Bis vor wenigen Jahren glaubte man, daß sich der Reizdarm (irritables Kolon) durch eine ballaststoffreiche Ernährung therapieren ließe. Inzwischen wurde man eines Besseren belehrt. Beispielsweise kam es in einer Studie mit 100 Patienten nur bei zehn durch Weizenkleie zu einer Verbesserung ihrer Symptome, während 55 über eine Verschlimmerung klagten. Der Verzehr von Müsli nützte niemandem, aber schadete fast einem Drittel der Patienten. Nicht viel anders bei Obst, vor allem Zitrusfrüchten. Mittlerweile stehen Ballaststoffpräparate im Verdacht, eine Ursache des Reizkolons zu sein. Aus biologischer Sicht kommt diese Erkenntnis alles andere als überraschend: Ballaststoffe enthalten reichlich pflanzliche Abwehrstoffe. Diese reizen den Darm und können Entzündungen verursachen.
Ballaststoffe stehen auch im Verdacht, Osteoporose zu fördern. Bei Frauen, die im Rahmen einer Abmagerungskur täglich 28 Gramm Ballaststoffe (das ist immer noch weniger, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als Minimum für den Erwachsenen empfiehlt) zu sich nahmen, wurde nach mehrmonatigem Gebrauch eine deutliche Verminderung der Knochendichte beobachtet. Ob dies nur eine Folge des Gewichtsverlustes ist oder mit den Ballaststoffen zusammenhängt, ist noch nicht geklärt. Gesichert ist aber, daß manche Ballaststoffe durch die Bindung von Mineralstoffen den Mineralstoffhaushalt des Körpers nachteilig beeinflussen können. Davon betroffen sind vor allem Calcium, Magnesium, Zink und Eisen.
Menschen, die ihrer Verstopfung mit Ballaststoffen zu Leibe rücken, müssen zudem mit einem Gewöhnungseffekt rechnen, wie bei anderen Abführmitteln auch. Das heißt, immer größere Mengen werden nötig, um die gleiche Wirkung zu erzielen. In extremen Fällen kann es dazu kommen, daß der Darm nicht mehr zu reagieren vermag und die aufquellenden Ballaststoffe große Klumpen (sogenannte Bezoare) bilden oder gar einen Darmverschluß verursachen. Gefährdet sind vor allem Menschen, die schon andere Abführmittel im Übermaß benutzt haben oder bei denen aufgrund von Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes) oder Medikamenten (zum Beispiel Psychopharmaka) die Darmbeweglichkeit herabgesetzt ist.
Vollwerternährung
ist ein modernes Ernährungskonzept für jedermann
Beim Brot sollte man auf jeden Fall
Vollkorn
kaufen
Literatur:
G. A. Spiller: CRC Handbook of dietary fiber in human nutrition. Boca Raton 1993
H. Freisleben: Kritische Bemerkungen des Mediziners zur sogenannten ballastreichen Kost. Ernährung/Nutrition 1985/9/S. 858
J. K. Kang, W. F. Doe: Unprocessed bran causing intestinal obstruction. British Medical Journal 1979/1/S. 1249
I. T. Johnson, D. A. T. Southgate: Dietary fiber and related substances. London 1994
U. Rabast, M. L. Götz: Negative Ballaststoffeffekte. Medizinische Klinik 1982/77/S. 257
M. Hardt, W. Geisthövel: Schwerer Obstruktionsileus durch Leinsamenbezoar. Medizinische Klinik 1986/81/S. 541
A. Avenell et al.: Bone loss associated with a high fibre weight reduction diet in postmenopausal women. European Journal of Clinical Nutrition 1994/48/S. 561
K. Pirlet: Zur Problematik der Vollwerternährung. Erfahrungsheilkunde 1992, Heft 5, S. 345
C. Y. Francis, P. J. Whorwell: Bran and irritable bowel syndrome: time for reappraisal. Lancet 1994/344/S. 39