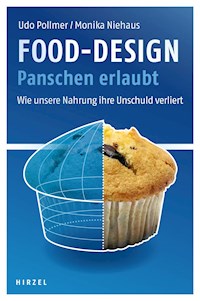7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Skandal im Nährbezirk BSE, Acrylamid, Dioxin, EHEC: In immer kürzeren Abständen wird Skandalalarm gegeben, wird uns Angst gemacht vor Megaseuchen. Nur: Viele der angeblichen Skandale sind gar keine, sondern Meinungsmache von Medien, Verbraucherschützern, Wissenschaftlern, Behörden oder Politikern. Und die Frage, was man heute noch essen könne, vor die wir ständig gestellt werden, muss längst ganz anders lauten: Wem können wir heute noch glauben? Dieses Buch räumt gründlich auf mit der Vorstellung, dass bei der kritischen Beschäftigung mit unseren Lebensmitteln vor allem der Verbraucherschutz im Vordergrund steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
Udo Pollmer • Andrea Fock • Monika Niehaus • Jutta Muth
Wer hat das Rind zur Sau gemacht?
Wie Lebensmittelskandale erfunden und benutzt werden
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Vorwort: Lebensmittelskandale à la carte
Vor rund 30 Jahren, Anfang der 1980er Jahre, veröffentlichte einer der Autoren dieses Buches, Udo Pollmer, sein Debüt «Iß und stirb – Chemie in unserer Nahrung». Es machte Furore und wurde zum Bestseller, weil es eines der ersten war, die akribisch die skandalösen Praktiken von Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie aufdeckten, Skandale, die meistenteils systematisch von den Medien vertuscht wurden. Damals war es dringend nötig, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dafür zu wecken.
Die Umweltbewegung hat im Laufe der Jahre so ziemlich alle darin enthaltenen Aussagen übernommen. Auch dann, wenn das Problem bereits gelöst war. Die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen vergeht kein Jahr, ohne dass einer oder mehrere Lebensmittelskandale von Verbraucherschützern oder Medien angeprangert werden. Die Verunsicherung der Öffentlichkeit scheint oberste Medienpflicht geworden zu sein. So mancher fragt sich längst, was man überhaupt noch mit gutem Gewissen essen oder trinken darf.
Ist das ein Zufall? Und wie kommt es eigentlich, dass man von so manchem Skandal, der den Medien zufolge fast schon Armageddon-Potenzial hat, später nichts mehr hört, wenn er schließlich über uns hinweggezogen ist, ohne größeren Schaden anzurichten? Wir haben eine ganze Reihe der wohl «bedeutendsten» Skandale der vergangenen Jahre einer genaueren Betrachtung unterzogen, haben uns gefragt, wem dieser unentwegte Alarmismus, der in diesem Land spätestens seit der BSE-Krise endemisch geworden ist, eigentlich nützt. Cui bono? ist die Standardfrage jedes Kriminalisten. Dabei wechseln die Nutznießer von Fall zu Fall: Mal sind es die Tierschützer und andere Spendensammler, mal die Pharmaindustrie und ein andermal jene Gouvernanten, die unsere freiheitliche Grundordnung am liebsten durch einen Nannystaat ersetzen würden. Die Verlierer stehen hingegen fest: Es sind die Verbraucher, und leider auch ehrliche Erzeuger und Verarbeiter.
Für die Campaigner, also jene Berufsgruppe, die sich ihre Brötchen mit dem Betreiben von Skandalen verdient, empfiehlt sich eine Dramaturgie, wie wir sie schon aus anderen Märchen kennen: Man nehme eine schon lange existente, aber bislang medial noch nicht ausgeschöpfte Bedrohung, ganz gleich, ob sie tatsächlich existiert (wie Räuber im finstren Tann oder BSE im Rinderhirn) oder nur eine Chimäre ist (wie feuerspeiende Drachen oder krebserregendes Acrylamid). Man garniere die Story mit emotionsgeladenen Bildern von halbnackten Hühnern oder Patienten mit Creutzfeldt-Jakob-Symptomen oder einer verzweifelten Mutter, die nach der Lektüre einer Zeitung von Angst erfüllt ist. Nun präsentiere man einen Schuldigen und empöre sich moralisch. Für die Rolle von Räuber und Drache eignen sich profitgierige Großkonzerne oder Landwirte, die sich «an der Natur versündigen». Nun betritt der edle Ritter die Bühne, meist der Dienstherr bzw. Auftraggeber der Campaigner, der mit furchtlosen Worten dem Lindwurm entgegentritt und die «Gerechtigkeitslücken» oder die «noch unbekannten Gefahren» anprangert. Zum Schutz der unschuldigen Maid – der erschrockenen Öffentlichkeit – fordert er nun neue Verbote und die Bestrafung der Sünder.
Vor 30 Jahren mangelte es nicht an krassen Missbräuchen in der Lebensmittelbranche – doch die Medien lehnten damals Berichte darüber meist mit dem Hinweis ab, man dürfe «den Verbraucher nicht verunsichern». War es früher vor allem die Industrie, die den Medien über ihre Anzeigenmacht den Rahmen der Berichterstattung vorgab, so sind es heute der Zeitgeist und dank wachsendem Wohlstand vor allem ideologische Weltbilder, die unter dem Stichwort «Gesundheit», «Ökologie» und «Tierschutz» propagiert werden – ohne jedoch diesen Zielen in der Praxis unbedingt einen Dienst zu erweisen. Es sind oft nur die Fassaden von Geschäftemachern und Spendensammlern, frei nach dem Motto «Vorne hui – hinten pfui».
Heute kommt es für den Bürger darauf an, die Spreu vom Weizen zu trennen und herauszufinden, wo wirklich Gefahren drohen oder wo sie nur herbeigeredet werden, um aus der resultierenden Angst Vorteile zu ziehen. «Es ist gefährlicher, zu heiraten, als Rindfleisch zu essen», spottete der Medienforscher Hans M. Kepperling auf dem Höhepunkt der BSE-Krise, denn die Gefahr sei effektiv größer, vom eigenen Lebenspartner ins Jenseits befördert zu werden, als durch den Genuss von Rindfleisch ums Leben zu kommen.
Bei jedem Lebensmittelskandal gibt es einige publizistische Meinungsführer, zahllose Mitläufer und wenige Skeptiker, die zudem in den Massenmedien kein Forum finden – außer, um als «gefährliche Irrmeinung» widerlegt zu werden. Wir möchten Ihnen in diesem Buch anhand der Skandale aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, welche nicht thematisierten Miss- und Notstände und welche kühl kalkulierten Machenschaften hinter so manchem Lebensmittelskandal stehen. Denn meist droht die Gefahr nicht so sehr von den ins Gerede gekommenen Lebensmitteln als von den verbreiteten Fehlinformationen.
Dieses Buch soll Ihnen nicht zuletzt helfen, Risiken im Lebensmittelbereich für sich persönlich besser einzuschätzen. Wer diese Spiele, die medialen Parallelwelten, nicht durchschaut, wird sich über kurz oder lang von diffusen Ernährungsängsten gelähmt fühlen. Dass bald die nächste Sau durchs Internet-Dorf getrieben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In den folgenden Kapiteln möchten wir Ihnen ein paar Instrumente an die Hand geben, echte Wildsäue von virtuellen Schweinereien zu unterscheiden.
1 Schlank durch Pommes – Acrylamid: Viel Rauch um nichts
Erinnern Sie sich noch an die allgegenwärtigen Warnungen vor dem bösen Acrylamid? Im April 2002 hatten schwedische Experten den Gefahrstoff in Kartoffelchips und Pommes frites aufgespürt und diese Entdeckung in einer vielbeachteten Pressekonferenz der Weltöffentlichkeit präsentiert. Eilends griffen die Behörden der deutschsprachigen Länder das Thema auf und überschlugen sich mit Warnungen vor dem «Pommesgift». Auch die Medien waren von der Chemikalie mit dem kurzen Namen angetan, den jeder Fernsehmoderator unfallfrei aussprechen konnte, noch dazu mit einem giftig klingenden Ypsilon in der Mitte. Die Verbraucherschützer nutzten die Gunst der Stunde und forderten, «die Industrie», diese alte Giftmischerin, solle den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln gefälligst drastisch senken, denn das Zeug sei schließlich krebserregend.
Seltsam nur, dass eines in den Medien unerwähnt blieb: Die schwedischen Forscher hatten ihre angeblich nagelneue Entdeckung längst in der Fachpresse publiziert. Bereits im Jahr 1999 hatten sie ihr Manuskript bei der Redaktion des Fachblatts Chemical Research in Toxicology eingereicht, wo es später unter dem Titel: «Acrylamide: a cooking carcinogen?» erschien.55 Dort stand zu lesen, dass beim Erhitzen von Lebensmitteln Acrylamid entstehen kann und diese Substanz im Blut der Bevölkerung nachweisbar ist. Es interessierte sich aber niemand so recht dafür, denn damals dominierte der Rinderwahnsinn die Schlagzeilen. Zum Skandal taugte dieser Befund erst Jahre später. Damit bot sich den Politikern die Chance, sich nach dem vergeigten Krisenmanagement bei BSE als rührige Verbraucherschützer zu profilieren.
Zudem war das Acrylamid gleichsam Wasser auf die Mühlen aller, die immer schon wussten, dass Pommes «ungesund» sind, aber keinen stichhaltigen Grund dafür angeben konnten. Der Fettgehalt gibt leider nichts her; schließlich stecken in Backofenpommes nur magere fünf Prozent, und selbst bei McDonald’s-Fritten entspricht er mit 16 Prozent gerade einmal dem einer Butterstulle. Dank Acrylamid konnten die notorischen Bedenkenträger endlich die Zeigefinger heben und den Kindern eine ihrer Lieblingsspeisen vermiesen. Hatten die «Wissenden» nicht schon seit Jahren gepredigt, statt traditioneller Grundnahrungsmittel wie Bratkartoffeln mit Buletten – vulgo Pommes mit Hamburger – lieber ballaststoffhaltige Magenfüller zu mümmeln, wie Knäckebrot an Halbfettmargarine?
Als später durchsickerte, dass Sesamknäcke indessen deutlich stärker mit Acrylamid belastet ist als Chips oder Fritten, herrschte bei Ernährungsberatern, in den Verbraucherzentralen und den Medien Funkstille. So wurde jedenfalls das Flaggschiff der Gesundkost, Knäckebrot mit Magerquark und Radieschen, vor dem Absaufen bewahrt. Mit «Krebs durch Acrylamid» wurde erst wieder gedroht, als es auch Bratkartoffeln und Röstis erwischt hatte. Prompt konnten die AufklärerInnen beliebte und nahrhafte Kartoffelgerichte wieder durch angesäuerte Salatvariationen ersetzen.
Pommesgift im Muckefuck
Inzwischen nahte die Adventszeit, und die Weihnachtsbäckerei ließ nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Bis das Bundesinstitut für Risikoforschung (BfR) die unfrohe Botschaft verkündete: In Vanillekipferln und braunen Lebkuchen steckt weitaus mehr Acrylamid als in Chips. Da drehte das Verbraucherministerium in Anbetracht des Lebkuchenstandorts Deutschland kurz entschlossen eine 180-Grad-Pirouette und mühte sich redlich, bei den verunsicherten Bürgern alle Befürchtungen zu zerstreuen, an deren Entstehen es zuvor tatkräftig mitgewirkt hatte: Es gab «Entwarnung».
Spätestens jetzt musste aufmerksamen Verbrauchern klarwerden, dass die ganze Aufregung ums Acrylamid so künstlich war wie dritte Zähne und so glaubwürdig wie Politikersprüche à la «Die Rente ist sicher!». Mittlerweile war die Fahndung nach dem «Pommesgift» in den Labors aber schon in vollem Gange, und so entdeckten die Analytiker den Stoff in immer mehr Lebensmitteln.9,53 Nach dem Gebäck traf es die Frühstückscerealien, dann folgten Schokolade, Kaffee und Pflaumensaft.59 Dass auch Oliven reichlich Acrylamid enthalten, beunruhigte jedoch weder Italiener noch Griechen oder Spanier, und genauso gelassen reagierten die Japaner, als heimische Forscher vom «Bundesinstitut für Gemüse- und Teewissenschaften» «beachtliche Gehalte» in ihrem Nationalgetränk fanden, dem grünen Tee.33
Die deutschen Aufklärer unterdessen ließen sich von solchen Fakten nicht beeindrucken und hackten unbeirrt weiter auf Chips und Fritten herum. Sie hätten Grund genug gehabt, ihren Blick ein wenig weiter schweifen zu lassen, denn die höchsten Acrylamidgehalte überhaupt wurden in einem typisch deutschen Produkt ermittelt: im Kaffee-Ersatz.4 Wer andere Menschen verunsichern will, um Macht über sie auszuüben oder Spenden zu schnorren, braucht aber ein politisch korrektes, heiles Weltbild als ideologische Tapete. Deshalb warnte die Gesundkost- und Surrogatefraktion eben nicht vor Muckefuck, sondern unverdrossen vor Chipstüten und Pommesbuden.
Dabei wird Getreidekaffee täglich von einem «besonders empfindlichen» Personenkreis konsumiert, nämlich von Kindern. Nichts wäre einfacher, als ihren Müttern einen ordentlichen Mokka zu empfehlen und ihrem Nachwuchs heiße Schokolade. Kaffee enthält zwar auch Acrylamid, aber weit weniger. Den Röststoffwarnern war dies ebenso gleichgültig wie die Tatsache, dass sich selbst bei Kindern, die keinen Muckefuck trinken, nicht etwa Pommes, sondern vor allem Brot, Backwaren und Kekse als wichtigste Acrylamidquelle erwiesen haben – insbesondere in der «gesunden» Vollkornvariante.2
Das Erfinden von tödlichen Risiken gehört zum Verbraucherschutz wie der schwarze Anzug zum Bestatter: Acrylamid ist «100-mal gefährlicher als das Schimmelgift Aflatoxin und 1000-mal schlimmer als Benzo(a)pyren» sowie «für Tausende von Krebstoten verantwortlich», schrieb die Ökopresse.23 Damit der Leser nicht schon übermorgen die Kartoffeln von unten begucken muss, bekam er einige praktische Tipps mit auf den Weg: «Beim Braten und Frittieren runter mit den Temperaturen.» Wer keine bleichen Pfannengerichte mag, solle einfach «eine Messerspitze Margarine hinzugeben», denn «durch den Wasseranteil wird die Temperatur gesenkt». Da bieten sich auch ein paar Eiswürfel fürs Backblech oder die Denkerstirn an.
Und das Acrylamid im Knäckebrot? Sollen wir das etwa mit einem Flöckchen Halbfettbutter bestreichen – wegen des höheren Wassergehaltes? Nicht nötig, hier wird anders entgiftet, nämlich durch «wertvolle Antioxidantien», die in der Brotkruste enthalten sind. Woher soll der geneigte Leser auch wissen, dass diese bei sämtlichen Bräunungsreaktionen entstehen? Statt Vollkornbrötchen könnte er also genauso gut eine Tüte Chips futtern, sofern der Hersteller die Temperatur seiner Fritteuse nicht auf Druck der Verbraucherzentralen oder von Foodwatch gesenkt hat.
Angesichts des Ratschlags «Kochen in Wasser ist gefahrlos» empfehlen wir, politisch korrekte Ratgeber in sprudelndes Wasser zu geben, sparsam zu salzen und kurz garziehen zu lassen. Und ja nicht die Messerspitze Margarine vergessen!
Der Test macht das Gift
Wie giftig ist dieser Stoff wirklich, der bis dato eigentlich nur aus der Kunststoffindustrie zur Herstellung von Polyacryl bekannt war? Experimente an Labornagern bescheinigen Acrylamid ein erbgutveränderndes bis krebsförderndes Potenzial. Deshalb wurde die Substanz von Toxikologen durchaus kritisch gesehen. Dafür sprachen zudem die Erfahrungen aus der Kunststoffverarbeitung: Einige Arbeiter, die in chemischen Fabriken mit Acrylamid hantierten, entwickelten vor allem neurotoxische Symptome, die glücklicherweise meist reversibel waren, also nach der Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz wieder verschwanden.
Im Tierversuch führt die Zufuhr erhöhter Mengen gewöhnlich zu Gewichtsverlust, der Toxikologen stets als Warnsignal gilt. Auf die naheliegende Schlagzeile «Schlank durch Pommes» haben die Medien dann aber doch verzichtet. Lieber verwiesen sie darauf, dass Acrylamid im Tierversuch auch Krebs auslösen kann. Das stimmt zwar, aber wohlweislich wurde verschwiegen, dass die erforderliche Dosis um Zehnerpotenzen höher liegt als die Acrylamidmengen, die man mit dem Essen zu sich nimmt.10,15,57
Es stimmt natürlich auch, dass für echte Kanzerogene kein unbedenklicher Schwellenwert existiert. Andererseits werden vier von zehn getesteten Stoffen in irgendeinem Testsystem immer als kanzerogen eingestuft, weil In-vitro-Tests nun mal sehr ungenau sind. Dabei ist es sogar egal, ob man Chemikalien testet oder Naturstoffe, wie sie in Äpfeln und Karotten vorkommen. Selbst Tierversuche sind weniger eindeutig, als man meinen sollte: Der amerikanische Krebsforscher Bruce Ames, Erfinder des weltweit angewandten Ames-Tests zur Mutagenitätsprüfung, kam zu dem Ergebnis, dass von 392 an Nagern geprüften Substanzen jeweils 96 entweder nur bei der Maus oder nur bei der Ratte kanzerogen wirkten. Allein bei Nagern fand Ames Empfindlichkeitsunterschiede, die bis zu einem Faktor von 107 reichten, das heißt, eine Art reagiert zehn Millionen Mal empfindlicher als andere.1 Mit ein paar simplen Tests und Tierversuchen lässt sich daher nicht nur jedes Rösti, sondern auch jedes Radieschen dämonisieren, wenn man nur den richtigen Stoff herausgreift und am passenden Versuchstier testet.
Wie krebserregend ist Acrylamid in Lebensmitteln für den Menschen? Heute braucht niemand mehr auf Tierversuche zurückzugreifen, da hier inzwischen zahlreiche epidemiologische Studien vorliegen. Die allererste, eine schwedische Fall-Kontroll-Studie, erschien bereits im Januar 2003 und kam anhand von 1000 Krebsfällen zu einem überraschenden Ergebnis: Menschen, die zeit ihres Lebens reichlich Acrylamidhaltiges verzehrt hatten, erkrankten seltener an Darmkrebs als diejenigen, die sich solche Genüsse lieber versagt hatten. Das Resultat war signifikant, die Krebsrate sank durch acrylamidhaltige Speisen um satte 40 Prozent. Auf andere Krebsarten des Verdauungstraktes hatte der Stoff keinen Einfluss.37
Kurz darauf folgte eine Studie mit 10000 Probanden. Diesmal wurden gezielt erhitzte Kartoffelprodukte wie Chips, Bratkartoffeln, Rösti und Pommes getestet. Doch wie man die Statistiken auch drehte und wendete: Die Krebsrate blieb unverändert.42 Im Mai 2004 wurde die Bedeutungslosigkeit von Acrylamid für Nierenkrebs erneut bestätigt.38 Eine weitere Studie aus dem Jahr 2005 fand zudem auch keinen Zusammenhang mit Brustkrebs.36 Nummer fünf befasste sich wieder mit Darmkrebs, diesmal prospektiv und mit 60000 Frauen. Ergebnis: wieder kein negativer Einfluss.39 Und so ging es Jahr für Jahr weiter.29,30,21,22 Zwischenzeitlich musste auch die Hauspostille des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit eingestehen: «Die bislang vorliegenden epidemiologischen Studien zur Aufnahme von Acrylamid mit der Nahrung und dem Krebsrisiko fanden bei den Personen mit höherem Verzehr keine signifikant erhöhten Risiken für die untersuchten Krebsarten.»59
Und im Deutschen Ärzteblatt berichteten 2005 Ärzte und Biometriker der Medizinischen Hochschule Hannover von umfangreichen Messungen, um den Einfluss der Ernährung auf den Acrylamidgehalt des Blutes zu ergründen. Nüchternes Fazit: «Ein Zusammenhang zwischen der Acrylamidbelastung und dem Ernährungsverhalten konnte nicht festgestellt werden.» Die Autoren werfen stattdessen die höchst peinliche Frage auf, ob das Acrylamid nicht vielleicht vom Körper selbst gebildet wird. Dies sei schließlich auch von anderen vergleichbaren Stoffen bekannt, und die körpereigene Produktion von Acrylamid wurde jüngst auch bei Mäusen bestätigt.3,56 Merke: Acrylamid ist überall.
Mit der Fritteuse dem Krebs vorbeugen?
Warum aber ist ein Stoff, der für Ratten krebserregend ist, für Menschen auf einmal harmlos? Weil im menschlichen Körper praktisch keine Umwandlung in Glycidamid stattfindet, also in jenen Metaboliten, der im Tierversuch für die Kanzerogenität verantwortlich ist. Glycidamid reagiert bis zu tausendmal bereitwilliger mit der DNA als Acrylamid.13,46 Dies wird durch Beobachtungen an Arbeitern bestätigt, die vermehrt mit Acrylamid in Kontakt kamen. Auch bei ihnen war keine Zunahme von Chromosomenbrüchen zu verzeichnen.25
Der Mensch ist für Stoffe, die durch Erhitzen von Nahrungsmitteln entstehen – egal, ob durch Backen, Braten, Kochen oder Frittieren –, grundsätzlich unempfindlicher als die üblichen Versuchstiere. Schließlich haben sich die Vorfahren der Menschheit im Lauf ihrer Evolution das Feuer zunutze gemacht, insbesondere, um Nahrung zuzubereiten. Damit konnte, ja, musste sich unser Stoffwechsel im Laufe von Hunderttausenden Jahren an Röststoffe anpassen. Wer damit nicht zurechtkam, wurde über kurz oder lang aus unserer Ahnengalerie «herausgemendelt». Ganz anders sieht es bei Mäusen, Ratten und Kaninchen aus, die ja eher selten zündeln. Röststoffe in Kaffee, Pommes oder Brot sind für unsereins daher wesentlich harmloser als für Labornager, und darum sind Tierversuche, mit denen ihr krebserregendes Potenzial ermittelt werden soll, wenig aussagekräftig.
Die Tatsache, dass die Menschheit Röststoffe über alles liebt, spricht dafür, dass damit auch ein Nutzen verbunden sein dürfte. Schließlich entstehen beim Frittieren, Backen oder Kochen zahllose Substanzen und nicht etwa nur Acrylamid. Als im Zuge der aufgeflammten Acrylamidangst weitere Röstprodukte geprüft wurden, stellte sich heraus, dass einige von ihnen sogar vor Krebs schützen, und zwar schon in minimalen Konzentrationen. Dieser Effekt war umso stärker, je dunkler die Produkte ausfielen, je stärker sie also erhitzt worden waren.18
Damit besteht Grund zu der Befürchtung, dass die Maßnahmen zur Senkung des Acrylamidgehalts – «Vergolden statt Verkohlen» lautete die Parole der damaligen Verbraucherschutzministerin – in Wirklichkeit zu einer Erhöhung des Krebsrisikos beitragen könnten. Denn die Branche hat auf Druck von Foodwatch und Co. ihre Frittiertemperaturen gesenkt.
Natürlich giftig: die Kartoffel
Aber in Sachen «Pommesgift» gestaltet sich die Situation noch viel abstruser. Denn die Anti-Acrylamid-Aktionisten haben das Wichtigste schlicht übersehen: Kartoffeln haben immer wieder zu Vergiftungen geführt. Aber nicht etwa wegen ihrer Zubereitung in der Fritteuse, sondern wegen ihres natürlichen Gehalts an Toxinen. Meist waren überlagerte Knollen bzw. der Verzehr von Schalen und Keimen die Ursache. Immerhin ist die Kartoffel (Solanum tuberosum) ein Nachtschattengewächs, und diese Pflanzenfamilie (Solanaceae) zeichnet sich durch eine Vielzahl wirksamer Gifte aus; man denke nur an die Tollkirsche oder das halluzinogene Bilsenkraut. Auch Kartoffeln enthalten in ihren grünen Teilen erkleckliche Mengen dieser natürlichen Toxine, namentlich die hochgiftigen Alkaloide Solanin und Chaconin.28,32,49 Und darum verschmäht man das Kraut.
Was in den Blättern steckt, findet sich auch in den unterirdischen Knollen, glücklicherweise in geringerer Menge. Bei den Alkaloiden handelt es sich um Schutzstoffe, pflanzeneigene, sogenannte primäre Pestizide (siehe Kapitel: Gebundene Rückstände), die die Pflanze vor Schädlingsfraß bewahren sollen. Darum konzentrieren sie sich vor allem in und dicht unter der Schale. Wenn so ein Erdapfel keimt oder dem Licht ausgesetzt wird, steigt sein Giftgehalt rapide an. Deshalb werden Kartoffeln ja traditionell geschält, die «Augen» entfernt und grüne Stellen weggeschnitten. Schon Heinrich Böll verewigte dies in seiner Kurzgeschichte «Die Waage der Baleks», in der die Kinder einer bettelarmen Familie stets die dünnen Kartoffelschalen vorzeigen mussten, um ihre Eltern davon zu überzeugen, dass nichts verschwendet wurde. Mit Pellkartoffeln hätte es zwar noch weniger Abfall gegeben, aber selbst die ärmsten Schlucker wollten in puncto Kartoffelgifte offenbar auf Nummer sicher gehen.
Nun senkt das Schälen das Vergiftungsrisiko zwar deutlich, aber ein bisschen Solanin und Chaconin ist auch im essbaren Knollenfleisch enthalten. Im ungünstigsten Fall kann dies immer noch zu Vergiftungen führen.19,32 Wie viel Gift in Fleisch und Schale steckt, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise von der Sorte, also, ob man Bamberger Hörnchen, Linda oder Sieglinde auf den Tisch bringt. Die Züchter konnten die Alkaloidgehalte moderner Sorten gegenüber den Wildkartoffeln zwar deutlich verringern, im Gegenzug verloren diese Kartoffelsorten aber ihre Widerstandskraft gegen Schädlinge. Da Pflanzenschutzmittel mittlerweile kritisch betrachtet werden, kreuzte man neben älteren Sorten auch wilde Kartoffelarten in die gängigen Kultivare ein, um resistente Pflanzen zu erhalten.27,28,43 Dadurch stieg die Menge an Gift wieder an. Da der Biolandbau auf resistente Sorten angewiesen ist (siehe Kapitel: Biologische Landwirtschaft), enthalten Bioknollen oft mehr Solanin als Kartoffeln aus konventionellem Anbau.6,27
Die jeweilige Giftmenge hängt aber auch davon ab, ob die Erdäpfel von Schädlingen oder Krankheiten heimgesucht worden sind. Denn bei Stress bilden die Knollen natürlich vermehrt Abwehrstoffe.35 Auf dem Acker sorgen daher Pilz- oder Bakterieninfektionen für stark erhöhte Alkaloidgehalte. Auch bei der Ernte oder Lagerung lässt sich vieles falsch machen. In beschädigten Knollen steigt die Toxinmenge an, ebenso bei hoher Luftfeuchtigkeit und zu hoher oder zu niedriger Temperatur.7,32 Besonders riskant ist das Lagern der Kartoffeln im Supermarkt unter weißem Neonlicht.17,20 Das wäre leicht zu vermeiden, würde man wieder lichtundurchlässige Verpackungen verwenden, wie es früher üblich war.7
Gefährlich wie Strychnin
Die Giftigkeit von Solanin ist lange bekannt. Bereits 1924 wurde für Kartoffelalkaloide eine vorläufige Höchstgrenze von 20 Milligramm pro 100 Gramm Frischgewicht vorgeschlagen.5,7,26,51 Dieser Richtwert war im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschmacksfrage: Die meisten Menschen nehmen ab dieser Konzentration den bitteren und kratzenden Geschmack von Solanin und Chaconin wahr.43,51,61 Obwohl sich viele Länder an diesem Wert orientieren, ist er rechtlich unverbindlich geblieben.17,52 Heute halten sowohl die Welternährungsorganisation FAO als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO noch nicht einmal die Hälfte davon für unbedenklich.24 Aus toxikologischer Sicht sind höchstens sechs bis sieben Milligramm dieser Glycoalkaloide vertretbar.8,47
Die Giftigkeit von Solanin ist durchaus mit Strychnin oder Arsen vergleichbar, denn es ist nun mal ein natürliches Pestizid, das nicht nur Insekten und Pilze, sondern auch Säugetiere wie Menschen abhalten soll.34 Dennoch gibt es für Solanin bis heute weder ein NOEL (No Observed Effect Level; kein beobachteter Effekt) noch ein ADI (Acceptable Daily Intake; zulässige tägliche Aufnahme), Grenzwerte, wie sie für wesentlich harmlosere Stoffe im Essen selbstverständlich sind.32,51 Dasselbe gilt für Chaconin, das inzwischen sogar als noch toxischer eingestuft wird als Solanin.
Nach dem Verzehr von Kartoffeln mit höheren Alkaloidkonzentrationen kommt es zu Durchfall, Erbrechen und Krämpfen, Atemnot und Koma. Ab welcher Menge sich die ersten Symptome einstellen, ist individuell verschieden, doch 2 bis 5 mg Glycoalkaloid/kg Körpergewicht gelten allgemein als toxische Dosis, 3 bis 6 mg/kg Körpergewicht als tödlich.24,34,51,60Homo sapiens reagiert damit empfindlicher auf die Kartoffelalkaloide als Affen, bei denen erst 40 bzw. 50 Milligramm pro Kilo zum Tode führen.34,51 Dieses Beispiel zeigt wieder einmal, wie vorsichtig man Daten zur Toxizität interpretieren muss. Umgekehrt steckt der Mensch von Acrylamid und anderen Röststoffen ja erheblich höhere Dosen problemlos weg als Labornager.
Da Solanin und Chaconin fettlöslich sind, können sie sich im Organismus ebenso anreichern wie chlororganische Pestizide à la DDT oder Lindan.16,32,44 Insofern erscheint selbst der Grenzwert von 20 Milligramm Alkaloiden pro 100 Gramm Kartoffeln als problematisch. Er liegt damit um Zehnerpotenzen über den Grenzwerten für die meisten Pestizide. Zur Orientierung: Unsachgemäß gelagerte und so ergrünte Knollen können es locker auf 1 Gramm Alkaloide pro Kilo bringen. Legt man aktuelle Berechnungen zugrunde, genügt bei einem 20 Kilo schweren Kind schon eine Schalenkartoffel (ca. 100 Gramm) mit dem zulässigen Höchstgehalt, um eine mutmaßlich toxische Konzentration von 1 mg/kg Körpergewicht zu erreichen.11
Außerdem gibt es große individuelle Unterschiede in der Empfindlichkeit.32,51 Da die unverbindlichen Grenzwerte oft überschritten werden,32,51,52 sind Vergiftungen bei Kindern nach dem Verzehr von Kartoffeln nichts Ungewöhnliches. Dabei ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen, weil die Beschwerden häufig als Magen-Darm-Infekt fehldiagnostiziert werden.24,31 Wie oft wohl werden statt des Kartoffelsalats die Würstchen verdächtigt, die ja aus der Massentierhaltung stammen und gefährliche Bazillen enthalten?
Schale Schalen
Dessen ungeachtet empfehlen dieselben Verbraucherschützer und Ernährungsberaterinnen, die vor Acrylamid warnen, Kartoffeln mitsamt ihrer Schale zu verzehren. Dabei sollten sie wissen, dass die Korkschicht ernährungsphysiologisch nicht nur völlig wertlos ist, sondern vor allem bei älteren Knollen oft beachtliche Mengen dieser giftigen Alkaloide aufweist. Solche «Ernährungstipps» sind dennoch mittlerweile Legion: Sie finden sich auf Websites von Frauenzeitschriften, und ein Internetportal für werdende Eltern gibt sogar ein Rezept für knusprige Kartoffelschalen zum Besten. Wahrscheinlich wird auch bald die Kartoffelschalensuppe, mit der man einst die Insassen von Gefangenenlagern abspeiste12, ihr kalorienarmes Comeback feiern.
Werdende Mütter sind durch Empfehlungen dieser Art besonders gefährdet: Wurden Kartoffelalkaloide an Hamster, Ratten und Mäuse, aber auch an Hühner, Frösche und Fische verfüttert, traten Missbildungen bei der Nachkommenschaft auf.14,40,43,58 Bei Affen unterdrückten die Gifte die Schwangerschaft oder erhöhten die Sterblichkeit der Föten.54 Dazu genügte bereits eine einmalige erhöhte Dosis.34 Schon seit langem wird beim Menschen ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Gaumenspalten bzw. Spina bifida und dem Verzehr angegammelter Kartoffeln angenommen.45 Daher warnen die Toxikologen Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch grundsätzlich vor dem unbekümmerten Verzehr angegrünter und beschädigter Knollen.
Wenn in Unkenntnis einfachster biologischer Zusammenhänge «vitaminreiche» Kartoffelschalen zum Verzehr empfohlen werden, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis in Internetforen auch Kartoffelkeime als biologisch vollwertige Sprossenkost gehandelt werden. Würden sich die Anhänger einer «naturbelassenen» Nahrung ein klein wenig mehr mit Ökologie befassen, so dämmerte ihnen, was Kartoffelkäfer schon immer wussten: Die sowohl unverdauliche als auch giftige und alles andere als vitaminhaltige Korkpelle soll die nahrhaften Erdäpfel nicht nur vor dem Austrocknen schützen, sondern auch vor naschhaften Mäulern, seien es die von Kakerlaken, Kellerasseln oder Rohköstlern.
Verschärft wird das Problem durch den verständlichen Wunsch der Verbraucher nach dünnschaligen Kartoffeln, denn sie waren früher ein Hinweis auf frisch geerntete Ware und damit auch auf niedrige Solaningehalte. Den Züchtern gelang es, diesen Kundenwunsch zu erfüllen, allerdings mussten sie dafür ausgerechnet die Gehalte an Alkaloiden erhöhen. Nur so ließ sich der fehlende Schutz der Knolle durch die ehemals dickwandige Schale ausgleichen. Außerdem gibt es einen Trend zu immer kleineren Kartöffelchen – einerseits, weil sie auf dem Teller hübscher und kalorienärmer wirken, andererseits, weil sie schneller gar sind. Dadurch steigt die Alkaloidzufuhr erneut, da kleine Kartoffeln bei gleicher Menge mehr Oberfläche aufweisen und damit mehr Gift liefern. Wer auf Nummer sicher gehen will, bevorzugt heute größere Erdäpfel mit dicker Schale.
Leider sind die Kartoffelalkaloide sehr stabil und werden durch Kochen nicht zerstört. In Pellkartoffeln bleiben sie weitgehend erhalten. Weshalb man für diese Zubereitungsart junge, frische Kartoffeln nutzt. Während der Lagerung steigen die Giftgehalte, deshalb werden sie geschält und als Salzkartoffeln serviert. Das Kochen kann den Alkaloiden nichts anhaben, allerdings laugt man damit einen Teil der Giftstoffe aus. Sie verschwinden mit dem Kochwasser im Ausguss. Für Kinder, die auf die Alkaloide empfindlicher reagieren als Erwachsene, eignen sich Pommes am besten, da Solanin und Co. beim Frittieren größtenteils entfernt werden. Da die Gifte aber ins Frittierfett übertreten und sich dort ansammeln, muss es rechtzeitig gewechselt werden.41,43,48,50
Und wie reagiert die Lebensmittelindustrie? Sie bietet Kartoffeln mit Schale für Kinder an! Ob «Naturchips» oder «Country Wedges», Hauptsache, es klingt ökologisch, gesund oder vollwertig. Sie handelt damit genauso skrupellos wie die «Experten» der Verbraucherzentralen oder die Redakteure der Frauenzeitschriften. Solche «naturbelassenen» Produkte haben es nämlich in sich: Chips mit Schale wiesen bis zu 72 Milligramm Alkaloide pro 100 Gramm auf.50 Angesichts solcher Giftgehalte wirken Diskussionen über Höchstmengenüberschreitungen von Pestiziden geradezu lächerlich.
Wo bleibt da die vielbeschworene Verantwortung der Hersteller? Was wurde aus dem «vorbeugenden Gesundheitsschutz», dem sich die Behörden verpflichtet sehen? Und warum schweigt Foodwatch? Statt ihre bizarren Spiegelfechtereien gegen das Acrylamid fortzusetzen, täten Industrie, Staat und Verbraucherorganisationen gut daran, Produkte mit hohen Gehalten an gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen nicht als Gesundkost zu bewerben, sondern sie aus dem Verkehr zu ziehen. So, wie es das Gesetz vorschreibt.
lassen Sie sich nicht die Freude an wohlschmeckenden, traditionellen Gerichten nehmen. Solange diese in bewährter Weise hergestellt sind, sind sie auch für die allermeisten Menschen unseres Kulturkreises sicher. Die Erfahrung im Umgang mit unseren Lebensmitteln bietet weitaus mehr Sicherheit als Tests mit Zellkulturen oder biochemische Spekulationen. Die Nutzung des Feuers, das Erhitzen von Nahrung, unterscheidet den Menschen vom Tier. Wir sind an menschliche Nahrung angepasst und nicht an das Futter von Labornagern.
2 Dioxin im Ei: Ultraschwindel mit Ultragift
Beim Dioxin-Skandal 2011 mangelte es nicht an Absonderlichkeiten. Zur Erinnerung: Das war der Skandal mit den «verseuchten Eiern». Am sonderbarsten war, dass er quasi über Nacht in der Versenkung verschwand, zumindest vorläufig. Denn zufällig war ein bisher unbeachtetes Detail bekannt geworden: In den Fall war auch ein ehemaliger Umweltminister verwickelt. Die breite Öffentlichkeit erfuhr davon allerdings nichts.
Aber schön der Reihe nach: Bekanntlich war das Dioxin über sogenannte Mischfettsäuren ins Futter geraten. Mischfettsäuren sind ein Abfallprodukt der Biodieselproduktion. Zur Gewinnung von «Diesel» werden die Fette in sogenannte Methylester umgewandelt, die nach einer Destillation in reiner Form vorliegen. Der versiffte Destillationsrückstand heißt «Mischfettsäuren». Um den Hunger unserer Biodieselanlagen zu stillen, verwendet man nicht nur heimisches Rapsöl, sondern auch Palmöl. Für den Ölpalmenanbau werden Wälder und Torfmoorgebiete in Südostasien brandgerodet. Dort herrscht an Dioxinquellen kein Mangel: Das Gift steckt in den Rauchschwaden, die über die Palmenplantagen ziehen, und in der Asche auf den Böden, es entsteht bei der Verbrennung des europäischen Plastikmülls (der sinnigerweise dorthin exportiert wird), und es verteilt sich über die Abgase der Motoren. Da Dioxine fettlöslich sind, sammeln sie sich im Öl an.
Die Verlockung, Mischfettsäuren an Nutztiere zu verfüttern, ist übrigens eine Spätfolge des BSE-Wahnsinns. Früher nahm man dafür tierische Fette, gewonnen aus Vieh, das nicht für die menschliche Ernährung geeignet war. Dank der BSE-Angst werden heute aber nicht nur die kranken Tiere ausgemustert, sondern auch etwa die Hälfte eines jeden gesunden Schlachtkörpers wird nicht mehr verwertet, sondern verbrannt. Wertvolles Eiweiß und nahrhaftes Fett lösen sich in Rauch auf, geopfert auf dem Altar des Verbraucherschutzes. Nach geltendem Recht sind Leber, Niere oder Knochen als Lebensmittel zwar für den Verbraucher und seine Haustiere in der Wohnung geeignet – nicht aber für Schweine, Geflügel oder Rinder im Stall. An unsere Nutztiere verfüttern wir jetzt Pflanzenfettreste und lassen Brasiliens Urwälder roden, um das fehlende tierische Eiweiß durch Soja zu ersetzen.
Es ist schon bizarr: Mit unseren Steuergeldern wird Speiseöl auf dem Weltmarkt eingekauft, aufwendig raffiniert und von Schadstoffen befreit – und anschließend verdieselt. Das hochwertige, verzehrfertige Speiseöl kommt in die Zapfsäule, und der belastete Rückstand aus der Raffination gelangt dann übers Hintertürchen in die Nahrungskette statt wie geplant in die Chemieindustrie. So wollen wir die Welt vor dem Klimakollaps retten! Ganz nebenbei treibt diese Praxis die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel in die Höhe, was in Gesellschaften mit geringen Einkommen verheerende Folgen hat. Zu den lachenden Dritten gehören auch unsere Landwirte, sie erhalten endlich den geforderten «gerechteren Lohn». Denn die Subventionen für Biodiesel landen über die steigenden Preise für Raps- oder Sonnenblumenöl auch in den Taschen der Bauern.
Natürlich gibt es noch weitere Quellen für Mischfettsäuren. In NRW arbeitet ein Recyclingunternehmen jährlich 100000 Tonnen Schmiere aus den Fettabscheidern von Großküchen, Dönerbuden oder Zerlegebetrieben zu 20000 Tonnen Mischfettsäuren auf. Selbst Spülwasser ist ein lohnender Rohstoff – daraus entstehen dann ebenso wie aus den Rückständen der Biodieselproduktion Schmierfette für Maschinen oder wohlriechende Schönheitscremes für Möchtegernmodels.1 In den Kläranlagen fallen ebenfalls Fette an. Diese haben bereits reichlich Dioxine aus dem Regenwasser bzw. dem Abwasser aufgesogen – denn im Straßenstaub und Abwasser steckt besonders viel Dioxin.2,11,26 Selbstverständlich lässt sich die eklige Brühe für «saubere Energie» recyceln, vor allem, weil man auf diese Weise den aufwendigen Abbau des Fettschlamms in den Faultürmen der Kläranlage vermeiden kann. Nach einer etwaigen Verwertung des noch brauchbaren Fettanteils bleiben reichlich «Mischfettsäuren» übrig.
Minister in der Recycling-Falle
Dieselben Probleme bereitet der dioxinhaltige Kalk, der beim Entschwefeln der Industrieschlote anfällt. Wer ihn nutzbringend verwenden kann, ist ein gemachter Mann. Schon bei einem großen Dioxineier-Skandal im Jahr 1999 lag es auf der Hand, dass belasteter Kalk aus der Rauchgasentschwefelung ins Legemehl für die Hühner gemischt wurde.22 Als sich zehn Jahre später auffällig hohe Dioxinrückstände in Milch und Butter fanden, entpuppten sich gekalkte Zitrusschalen aus der brasilianischen Orangensaftkonzentrat-Herstellung als Ursache.17 Diese für den Menschen ungenießbaren Reste sind ein wertvoller Bestandteil unseres Rinderfutters – sofern sie frei von Entschwefelungskalk sind.
Der kritische Punkt ist seit jeher die Müllentsorgung, die Recyclingbranche.21 Nicht, weil diese Branche eine höhere kriminelle Neigung hätte als andere, sondern weil die Verlockung wächst, Nebenprodukte des Recyclings nicht zu vernichten, sondern wieder in die Stoffkreisläufe einzuschleusen. Und das ist ganz einfach: Die Abfälle werden beim Verkauf noch korrekt deklariert, aber dann geht die Ware auf dem Papier an einen Kollegen in China. Der verkauft sie weiter an eine belgische Firma und die wiederum an ein deutsches Futtermittelwerk. Jetzt kommt der Spediteur und fährt die Ware von A-Dorf nach B-Dorf. Inzwischen hat sich die Auslobung der Ware durch einen kleinen Übersetzungsfehler der in China ausgefertigten Papiere – zumindest auf dem Lieferschein – ein wenig verbessert.
Zurück zu den Mischfettsäuren und der Sache mit dem Minister: Deren Belastung mit Dioxinen ist der Fachwelt seit langem bekannt. So war es höchst verdienstvoll, dass an der Universität Oldenburg ein Verfahren entwickelt wurde, um Dioxine per Aktivkohle abzutrennen und dann zu Kochsalz und Wasser abzubauen.13 Die Erfinder wandten sich an den damaligen Umweltminister Jürgen Trittin, um für ihre Technik zu werben, stießen jedoch auf Ablehnung. Der grüne Politiker vermochte sich nicht für die rückstandsfreie Entsorgung des «Ultragiftes» zu erwärmen7 – über seine Gründe kann nur gerätselt werden: Ob ihm eine öffentliche Diskussion darüber, dass bei der Erzeugung «grüner Energie» Dioxine anfallen, zu heiß war? Wir wissen es nicht. Aber als seine Mitverantwortung für die Ablehnung des Oldenburger Verfahrens erkennbar wurde, verloren die Medien jedenfalls schlagartig ihr Interesse an dem brisanten Thema. Wer wollte schon statt eines Futtermittelwerks einen grünen Verbraucherschützer an den Pranger stellen?
Das ist sehr bedauerlich, denn mit der fraglichen Technik hätten sich nicht nur Dioxine elegant aus Recyclingabfällen entfernen lassen, sondern auch zahlreiche andere Schadstoffe.14 Damit wäre eine neu entstandene Lücke im Verbraucherschutz wirksam geschlossen worden. Bisher waren die Maßnahmen zur Minimierung der Dioxinbelastung ja recht effektiv. Nimmt man den Dioxingehalt im Körperfett als Maßstab für die Belastung des Menschen, darf sogar entwarnt werden: Er ist in den letzten zwanzig Jahren um mehr als die Hälfte gesunken. Insofern waren wir auf einem guten Weg.3,24
Feuer und Flamme für einen Schlankmacher
So erfreulich die Gesamtentwicklung ist, so diffus ist das Bild, das sich im Detail zeigt. Da Dioxine bei Verbrennungsprozessen jeglicher Art entstehen, gibt es unzählige Quellen, die für Eintrag in die Umwelt sorgen. Denn irgendwo brennt immer etwas – seien es Zigaretten, Heizungen, Krematorien, Wälder, Dieselmotoren, Vulkane oder Müll. Eine der vielfältigen Quellen von Dioxinbelastungen wurde 1991 auf Sport- und Spielplätzen ausgemacht: Das als Belag verwendete «Kieselrot» – insgesamt 800000 Tonnen Schlacken aus den Kupferhütten – war randvoll mit Dioxinen; es enthielt das Millionenfache dessen, was in den «dioxinverseuchten» Eiern unserer Tage steckt.20
Neben Verbrennungsprozessen gibt’s auch allerlei chemische Reaktionen zwischen Phenolen und Chlor, die Dioxine erzeugen. Eine davon ist die früher übliche Chlorbleiche von Papier. Wir wollen lieber nicht wissen, was der Mensch über Recyclingpapier an Dioxinen aufgenommen hat – vor allem dort, wo Ökokarton als Lebensmittelverpackung verwendet wurde. Die wohl kurioseste Dioxinquelle ist ein beliebtes Desinfektionsmittel, das Triclosan. Es ist ein typischer Bestandteil besserer Reinigungsmittel von der Sorte «nicht sauber, sondern hygienisch rein». Gelangt Triclosan in die Kanalisation und von dort in die Umwelt, verwandelt es sich bei Sonnenschein im Wasser in ein Dioxin.19