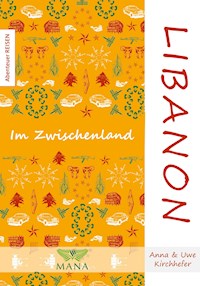
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MANA-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Abenteuer REISEN
- Sprache: Deutsch
Was für ein Land! Zwischen Israel und Syrien öffnet sich von den Bergen bis ans Meer – verborgen zwischen Kriegsnarben und Beton – ein märchenhaftes Schatzkästchen voll wilder Naturschönheit, kulturhistorischer Entdeckungen und ungehörter Geschichten. Anna und Uwe Kirchhefer tauchen ein in das Land der Zedern und Hyänen, Tempelbauer und Händler, Mönche und Märtyrer, Einsiedler und Emire. Unterhaltsam und mit Tiefgang erzählen sie von einem mutigen, humanistisch geprägten Libanon mit offenherzigen Menschen, der täglich aufs Neue seine Bestimmung und den Frieden sucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna und Uwe Kirchhefer
Libanon
Im Zwischenland
Inhalt
Prolog
DAS ALTE BEIRUT – da, wo alles begann
Laufen lernen
Frischlinge auf historischem Streifzug
Souks gesucht
Wenn Paläste zu Hütten werden
WEST-BEIRUT – da, wo die Sonne untergeht
Rot ist mein Name
Ouzai – der Märtyrer trägt heute bunt
Shatila – im innersten Kreis der Hölle
Spy City
Der Krieg
AN DER RIVIERA – Am Strand unter Mariens Augen Limo trinken
Eier statt Strom
Maria ist für alle da
#bkerke
Camping aus Liebe
Es war einmal… Strandurlaub in den golden sixties
Das Geheimnis der Zitronenlimonade
Ein krankes Herz
Griechenland trifft Phönizien
Our Lady of the wind
TRIPOLI (liegt nicht in Libyen)
Ende einer Fahrt mit qualmenden Reifen
1881: »Zuckerschloss öffne Dich«
Oscars Ufofriedhof
Die Strippenzieher des Forty-Six
Was sonst? Die Chinesen sind schon da
Der Kessel ist schon lange kalt
Auf der Mauer auf der Lauer
Der Dolch im Rücken
Der Pilgerberg
Ali rennt
Handwerk hat(te) goldenen Boden
Libanese, Retter in der Not
Die Flucht
QADISHA – Der Grand Canyon der Klöster
Die himmlische Garage
Der Libanon liegt in Brasilien
Geheimnis gelüftet: Wo Karl May wirklich war
Die Zedern des Herrn
MITTE BEIRUT – Kämpfer und Leuchttürme an der Damaskus Street
Ich hupe, also bin ich
Ein fremdes Leben
Die andere grüne Grenze
Vergessenes Leuchten im geheimen Garten
Das große Erbe
Die Liebe
BEKAA – das letzte Tal Europas
Ein Grand Hotel ohne Gäste
Das Licht des Tages bringt die Wahrheit
Der goldene Wein
Die Saubermänner von Zahle
Grenzland
Baalbek – wo Kaiser zelten
Die Duftmarken der Hisbollah
Die Saat geht auf
Hochzeit à l‘Aladdine
BYBLOS
Willkommen in der »ältesten Stadt der Welt«!
Wo Hollywood seinen Hering aß
Wie die Bibel zu ihrem Namen kam
Ein Platz an der Sonne
Der gelehrige König lernt das Schreiben
Das Geschenk
IM LAND DER KREUZE
Mar Charbel Superstar
Hinter Steinmauern unter Maulbeerbäumen Frieden finden
Auf dem Weg zur Quelle des Lebens mit Hyänen tanzen
Von Flug-Dinos träumen und versteinerte Fische finden
Summer in the mountains
SIDON – Stadt der Fische
Das Tor zur Welt
Vom Handel und Wandel
Diese Stadt gehört uns
Wie die Schnecke zum Kaiser kam
Der Fang des Tages
Die Sehnsucht
TYROS – die gefallene Stadt
Unter wachsamen Augen wachsen die Orangen
Von den Sternen in den Staub
Ich war hier Jesus von Nazareth
OST-BEIRUT – da, wo die Sonne aufgeht
Mar Mikhael – hip, hipper, Hipster
Beirut – die Europäische?
Die feine Gesellschaft
Flagge zeigen in Bourj Hammoud
Der Abschied
DRUSENLAND – Das Schatzkästchen hinter sieben Bergen
Von alten und neuen Emiren
Im Volkspalast von Beiteddine
Die Liebenden von Deir el-Qamar
Strangers in paradise
Als der Faden riss
Klein, aber geheim
Epilog
Chronik
Literatur
Danksagung
Bildteil
Unseren Kindern,
denen wir die mutigen Herzen wünschen, die es braucht,
die Welt und andere Menschen
zu entdecken und zu lieben
Die Herrlichkeit des Libanon soll an Dich kommen.
Jesaja 60, 13
On these ancient shores of the Near East, there lay a brave little country, which throughout its storied existence and timeless history, had always been, entirely, in deeds and as a matter of principle, a committed practitioner and a true hero of humanism. This small country is Lebanon.
(Charles Corm)
Prolog
»Er ist ein Insider. Er kann euch dorthin führen.«
Der Mann befüllt weiter seine Kanister mit Quellwasser, ohne den Blick zu heben. Trotz der Hitze eines hochsommerlichen Tages trägt er eine weite schwarze Pluderhose, in die ein ebenso schwarzes langärmeliges Hemd gesteckt ist. Ein weißes, gestricktes Scheitelkäppchen bedeckt den kahlgeschorenen Schädel. Er dreht sich zu uns um. Auf seiner Stirn glänzen einzelne Schweißperlen, die von großen buschigen Augenbrauen aufgefangen werden. Ein über die Mundwinkel gezogener Schnurrbart gibt ihm ein väterliches Aussehen. Er wendet sich an Akram, unseren Fahrer. »Bring sie hin!« Wir schauen uns an und sehen das innerliche Beben des anderen. Sollte sich hier und heute unsere Sehnsucht erfüllen, einen der letzten Geheimplätze der Welt aufzuspüren? Wir steigen ins Auto und vertrauen uns Akram an. Er gehört dazu. Im Libanon ist alles eine Frage der Zugehörigkeit. Wo kommst du her, was glaubst du, wen kennst du? Von Galiläa bis Syrien, von den Bergen bis ans Meer, zu jedem Zeitpunkt unserer Reise – selbst hier im unwegsamen Gebirgsland des Chouf – wird klar: Es liegt in Deiner Wiege oder nicht.
Wir fahren weiter durch Barouk, den letzten bewohnten Ort des südlichen Libanongebirges, von dessen Gipfeln sich die immer enger werdende Straße durch die Hochebene der Bekaa bis ins nahe Syrien schlängelt. Doch unser Ziel liegt in diesen Bergen, deren Kämme sich wie staubige Elefantenrücken türmen. Hier leben sie noch genauso wie vor tausend Jahren versteckt und zurückgezogen. Nur die jahrhundertealten Zedern des Chouf, mit ihren dunklen, breiten Kronen, wissen um die Geheimnisse ihres Kultes, der nur dem eigenen Blut offenbart wird. Akram beschleunigt den Wagen. Bilderstaccato: Ein Flussbett im nahen Tal; eine ältere Frau mit weißem Schleier; Kinder mit Kisten voller Äpfel; ein alter Mercedes im Rost der Jahre; das Gelb der Sandsteinhäuser des Dorfes nimmt uns auf. Dann halten wir urplötzlich und werden zu einer Tür geführt. In ihrem grünen, eisernen Gitter sind vier Sterne eingegossen. »Folgt mir«, sagt Akram.
DAS ALTE BEIRUT – da, wo alles begann
Laufen lernen
Wir werden von den Turmglocken der nahe gelegenen Klosterkirche St. Anthony im Stadtteil Monot geweckt. Das Loft, das uns eine junge Fotografin für ein paar Tage überlassen hat, liegt noch im Halbdunkel der Blendläden an der Balkontür. Draußen pulsiert – schon wieder oder noch – das Leben. Unentwegt dringt das Hupen der eiligen Autofahrer zu uns in den dritten Stock hinauf. Doch der Lärm ist nichts gegen die Bilder der gestrigen Fahrt vom Flughafen hierher. Panzerkolonnen, Straßensperren, Soldaten – Fremdkörper für europäische Augen. Dazu orientalisches Verkehrschaos, aber das hatten wir erwartet. Welche Bedenken sind nicht – genährt von Tagesnachrichten – zuhause gegen unsere Reiseplanung ins Feld geführt worden! Syrienkrieg, Clanstrukturen, Korruption, Flüchtlingsströme, Unruhen, Militärpräsenz. Jetzt sind wir trotzdem im Libanon, aber die Warnungen und Ängste sind auch mitgereist. Die Nacht zwischen Gemälden, Bücherregalen und IKEA-Lampen im schmucken Apartment hat uns Sicherheit und Vertrauen wiedergegeben. Zeit fürs Frühstück. Aber das Wasser für den Tee bleibt auch nach einer Viertelstunde auf dem E-Herd kalt. Wir testen Stecker und Anschlüsse aller verfügbaren elektrischen Haushaltsgeräte, doch nichts tut sich und wir schauen uns schulterzuckend an. Unsere erste Begegnung mit einer libanesischen Krankheit, die Land und Menschen im Griff hat: Stromausfall. Aber, wer braucht schon ein Heißgetränk am Morgen, zumal das Thermometer bereits auf fast dreißig Grad steht. Wie in Studentenzeiten schieben wir die Gedanken an eine erste Mahlzeit des Tages erst einmal gänzlich von uns und wagen uns hinaus auf die Straßen Beiruts!
Was soll man tun am ersten Tag einer langen Reise? Lässt sich hier an der Geburtsstätte des modernen Libanon, im Zentrum Beiruts, die Spur für ein ganzes Land aufnehmen? Durch die Stadt zu unseren Füßen weht nicht der leichte Wind der libanesischen Riviera und auch die klare Bergluft des Libanon- und des Chouf-Gebirges ist fern. Hier gilt es Schicht um Schicht einer gewachsenen, verletzten und nun wieder heilenden Stadt abzutragen. Schwere Kost für den ersten Tag, doch daran führt kaum ein Weg vorbei, also weiter auf der Damascus Street Richtung Zentrum. Auf dieser alten Demarkationslinie des Bürgerkrieges stehen sie noch: zerschossene Häuser wie tote Kulissen einer vergangenen Zeit. Hinter einer donnernden Hochstraße starrt uns ein verwüstetes Betonmonstrum an. Die Beiruter nennen es liebevoll »das geköpfte Ei«. Offene Wunden. Dann ein kleines Café. Hier, wo sich noch vor dreißig Jahren die Scharfschützen anvisierten, gibt es heute guten Cappuccino vom erprobten Barista und Pain au Chocolat. Das Design ist skandinavisch, die Zeitungen in französischer Sprache. Dass wir nicht in London oder Paris, sondern mitten in Beirut sitzen, verrät nur die kleine Speisekarte auf Schiefertafeln, die unter den Frühstücksvarianten Manakish, eine Art Pizza mit Thymian-Sesampaste, bereithält. Wer hierher kommt, ist nur mit ipad & Co bewaffnet. Die meisten jungen Leute sitzen allein und haben offensichtlich zu arbeiten oder zu kommunizieren, während sie sich nach einer langen Partynacht für den Tag stärken. Von dem kleinen Holztisch aus schauen wir versonnen durch das Fenster auf den »Place des Martyrs«. Nach einer Weile blickt der junge Mann neben uns von seinem ipad auf, tritt an unseren Tisch und lächelt uns an. Anscheinend hat er unser Gespräch mitangehört, in dem wir über die seltsame Namensschöpfung spekuliert haben. »Märtyrer«, das Wort ist für uns verbunden mit dem Opfertod von Heiligen oder Dschihadisten. Mikhael stellt sich in nahezu akzentfreiem Deutsch vor. Einfach so, ohne Umschweife und mit umwerfender Herzlichkeit. Er hat in Deutschland Geschichte studiert und erklärt uns mit einem Schmunzeln die Bedeutung des Namens.
»Der Platz hat eine wandelvolle Geschichte erlebt und wurde Zeuge der Um- und Aufbrüche Beiruts im vorigen Jahrhundert. Bevor er seinen heutigen Namen ›Platz der Märtyrer‹ erhielt, wurde er auch mal nach einem osmanischen Sultan und schließlich, nach der Machtübernahme der Jungtürken 1908, ›Freiheitsplatz‹ benannt.«
»Jungtürken?«
»Die Jungtürken waren eine politische Bewegung gegen Ende des osmanischen Reiches. Sie versuchten durch liberale Reformen und eine Verfassung den drohenden Zerfall des Reiches aufzuhalten. Am 6. Mai 1916 hängten die osmanischen Statthalter Intellektuelle und libanesische Nationalisten, egal welcher Konfession.«
»Warum wurden sie gehängt?«, hakt Anna nach.
»Gegen Ende des ersten Weltkrieges fing das osmanische Reich, das vom Balkan bis zum Persischen Golf reichte und zu dem auch das Gebiet des heutigen Libanon gehörte, an zu zerfallen. Der Libanon aber stand weiterhin unter der Militärverwaltung der Osmanen. Sie war den Leuten verhasst. Im Zuge der aufkeimenden libanesischen Nationalbewegung kam es zu blutigen Unruhen. Die Nationalbewegung richtete sich gegen die osmanische Fremdherrschaft und wollte Selbstbestimmung. Die Stimmung gegen das Militär war aufgeheizt, denn es brauchte Unmengen Lebensmittel für die Kriegsführung und plünderte das Land aus. Hinzu kamen verheerende Hungersnöte und Seuchen als Resultat der Seeblockade der alliierten Mächte um Frankreich und England. Da das osmanische Reich auf Seiten des verfeindeten Deutschlands stand, schnitten die Alliierten jegliche Versorgung über den Seeweg ab. Zehntausende fanden so den Tod.«
»Gab es keine Hilfe für die Menschen?«
»Die Menschen hier mussten sich schon immer selbst helfen. Wer konnte, emigrierte. Die hier blieben und gegen diese Herrschaft und die unsäglichen Lebensumstände aufstanden und gehängt wurden, sind die Märtyrer, nach denen der Platz dann nach dem Ende des ersten Weltkrieges unter französischem Mandat benannt wurde. In den Folgejahren nach der Umbenennung gab der Platz seine ursprüngliche Bestimmung als Beiruts administratives und kulturelles Zentrum an den durch die französische Mandatsverwaltung errichteten Place d’Etoile ab. Es blieben aber Kinos, Kaffeehäuser und neue Hotels; hier traf man sich, um zu sehen und gesehen zu werden. Vielleicht findet ihr mal ein altes Foto. Es sah hier wirklich schön aus und es ging mondän zu.« Er lächelt wieder. »Jetzt höre ich aber auf zu dozieren, sonst flieht ihr gleich vor der orientalischen Geschichtsstunde, zu schade um den leckeren Cappuccino.« Wir lachen mit, bedanken uns artig für die vielen Informationen und leeren unseren Kaffee. Uns rauchen die Köpfe. In der Geschichte der Levante sind wir noch Novizen.
Draußen sehen wir, dass eine 1960 aufgestellte Bronzestatue des italienischen Bildhauers Mazzacurati an die Opfer erinnert. Die Einschusslöcher der im Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990 versehrten Statue legen noch heute von der gewalttätigen Kraft des Krieges Zeugnis ab und geben den Himmel Beiruts im Hintergrund frei. Die Tragik der Geschichte der Kriegsjahre liegt darin, dass dieser Platz, auf dem die Bürger beider großen Religionen, Sunniten und Christen, 1916 gemeinsam für einen befreiten Libanon in den Tod gingen, Teil der Demarkationslinie zwischen muslimischem Westen und christlichem Osten war. Mit Blick auf die langweilige postmoderne Häuserfront der gegenüberliegenden Straßenseite, die eine Donuts verkaufende Restaurantkette beherbergt, wird schnell klar: Dieser Flecken Stadt muss seine Rolle im Beirut des 21. Jahrhunderts erst noch finden.
Frischlinge auf historischem Streifzug
Direkt neben dem Platz liegt ein römisches Ausgrabungsareal, ehemals der Cardo Maximus, heute ein Müllbecken. Mittendrin eine einsame traurige Palme. Drumherum drei Gotteshäuser. Zwei Kirchen und eine Moschee. Religionen im Wettlauf. Die griechisch-orthodoxe Kirche St. Georg ist das älteste noch bestehende Kirchengebäude Beiruts. Die klassizistisch erbaute maronitische Kathedrale St. Georg war das höchste Gotteshaus des Landes, bis die moderne sunnitische Al-Amin-Moschee, initiiert durch den 2005 ermordeten Premierminister Rafiq Hariri, gebaut wurde. Der Prestigebau bemüht sich um die Erhabenheit der Blauen Moschee, bleibt jedoch nur eine schale Kopie. Hier finden sich auch keine Menschenmassen, die zum Eingang streben, sondern nur drei ältere Männer mit sonnengegerbten Gesichtern und eine verloren wirkende, blasse westliche Touristin mit Khakihosen und Hut. Am Nachmittag hallt der elektrisch verstärkte Ruf des Muezzins der Al-Amin-Moschee zeitgleich mit den Kirchenglocken von St. Georg durch das Stadtzentrum. Nebeneinander, miteinander oder gegeneinander? Die Frage hat hier im Land der achtzehn staatlich anerkannten Konfessionen allgegenwärtig ihre Berechtigung.
Die Sonne scheint sehr warm und anstatt den Gebetsstätten einen Besuch abzustatten, entscheiden wir uns, die Rue Maraad entlang zu wandeln. Wem alte Postkarten oder Fotos vom Vorkriegsbeirut in die Hände fallen, der kann sicher sein, dass immer auch eine Aufnahme der eleganten Straße mit ihren Cafés und Geschäften unter Rundbögen darunter ist, die der Rue de Rivoli in Paris nachempfunden war, aber in ihrer orientalischen Lässigkeit mehr Charme besaß. Mit den alten Postkarten vor Augen bewundern wir heute eine nach dem Krieg aufwändig restaurierte Straße, deren Gebäude von einer goldenen Zeit zeugen, in denen heute aber Mieter, Geschäfte, Cafés und Besucher fehlen. Wo sind sie nur, die 1,5 Millionen Einwohner Beiruts? Nicht hier, im Zentrum, wo uns das Gefühl beschleicht, durch eine menschenleere Filmkulisse zu spazieren. Schöne Steine bringen das Flair der alten Rue Maraad nicht zurück.
Die Straße führt uns direkt auf den Place d’Etoile, den Sternenplatz, von dem aus Straßen in alle Richtungen abgehen. Am Rand des Platzes füttert ein mit Maschinengewehr bewaffneter Soldat hunderte Tauben. Einige setzen sich auf seine Schultern. Ein Mann, dem Friedensflügel wachsen, während er die Sicherheit des Landes hütet. Die Nationalversammlung, wie das libanesische Parlament genannt wird, ist nur ein paar Schritte entfernt in einem neuen Sandsteingebäude untergebracht, das im Stil des Historismus osmanische Elemente aufweist. Hier sitzen aufgrund des Prinzips der konfessionellen Parität Vertreter aller Bekenntnisse. Von armenisch-orthodox bis schiitisch. Von maronitisch bis drusisch. Denn jede religiöse Gemeinschaft hat proportional zu ihrem Anteil an der libanesischen Gesamtbevölkerung eine festgelegte Anzahl Sitze im Parlament. Selbst der schiitisch geprägte politische Arm der Terrororganisation Hisbollah hält 13 Sitze im Parlament. Vergebens halten wir Ausschau nach einem Besuchereingang; das Gebäude ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Schade, selbst das House of Lords und die Knesset kann man besichtigen. Stattdessen betreten wir einen kleinen christlichen Buchladen in der Hoffnung auf interessante Bücher oder eine Landkarte. Als einer, der östlich des Eisernen Vorhangs in einer sächsischen Kleinstadt aufgewachsen ist, sehnte sich Uwe als Kind vor den aufgeschlagenen Atlanten aus der Plattenbauwohnung in die weite Welt. Wir haben uns nicht um ein Handy mit libanesischem Tarif gekümmert und sind nun ohne Internet und Navigation unterwegs. Tatsächlich verkauft die Dame im Lädchen neben Bibeln und anderer christlicher Erbauungsliteratur Landkarten. Es gibt sie nur in der Version der »militärischen Karte«. Darauf ist der Libanon mit allen befestigten Straßen und seinen Grenzen zu Syrien und – nein, nicht Israel – sondern »Palästina« eingezeichnet. Anna muss unweigerlich an sonntägliche Kirchenbesuche denken, in denen die im Nahen Osten engagierte Pfarrerin in Fürbitten ausdrücklich die Menschen aus Israel und Palästina einschloss. So versöhnlich sind die Militärs hier nicht.
Wir treten aus dem Dunkel und halten voller Stolz unseren kleinen Schatz ins gleißende Tageslicht. Die Karte zeigt nicht nur die exakte Topographie des Libanon im kleinen Maßstab, sondern auch die zentralen Stadtteile Beiruts mit allen Straßennamen und Sehenswürdigkeiten. Da in deutschen Buchhandlungen weder Reiseführer noch Literatur zum Land angeboten werden und das einzige aktuelle englischsprachige Bändchen vom Footprint-Verlag Beirut und seine Umgebung nur sehr rudimentär darstellt, ist unser Kauf ein echter Glücksgriff. Die Karte nimmt sofort ihren Dienst auf und führt uns geradewegs zur Weygand Street, einer der Ost-West-Magistralen. Ab und zu ein Auto, keine Fußgänger. Wir blicken auf das im neo-orientalischen Stil errichtete Rathaus. Sein Bauherr hinterließ über dem Eingang ein Vermächtnis auf Arabisch: »Das sind unsere Spuren, die auf uns hinweisen. Schau fortan auf unsere Spuren.« Gerade haben wir uns den überheblichen Ausspruch mühevoll übersetzt, da öffnet sich die Tür und ein fluchender junger Mann kommt uns entgegen. In seiner Wut übersieht er Anna, die zu Boden stürzt. Er ist erschrocken und entschuldigt sich vielmals.
»Es tut mir sehr leid. Ich war gerade so aufgebracht, dass diese Idioten meinen Antrag immer noch nicht bearbeitet haben. In diesem Land ist man ein lästiger Bittsteller, der dem korrupten Staatsapparat und seiner Willkür ausgeliefert ist.« Sein Handy klingelt und er eilt davon. Außen schön, innen morsch. Die Bürger Beiruts lassen sich von Fassaden nicht täuschen und irgendwann auch mit Versprechen auf Besserung nicht mehr beschwichtigen.
Unsere Aufmerksamkeit wird von den beiden Minaretten der schräg über der Straße liegenden Al-Omari-Moschee angezogen, die bis zur Fertigstellung von Al-Amin die Freitagsmoschee Beiruts war. Die Moschee entstand nach dem Sieg der Mameluken 1291 über die Kreuzfahrer durch die Umwidmung einer damals bereits seit 150 Jahren bestehenden romanischen Kirche, die Johannes dem Täufer geweiht war. Wir biegen in die Verlängerung der Maarad Street ein und laufen unter einem in französischer Mandatszeit errichteten Portikus her. Jetzt stellt sich zum ersten Mal das Gefühl ein, im Orient zu sein. Durch das Hauptportal gelangen wir über den Innenhof in die Moschee. In der Gebetsnische an der Südmauer betet ein Mann. Wir schlurfen in der dreischiffigen Basilika über die muffig riechenden Teppiche. Anders als zu Kreuzfahrerzeiten, als man hier die Hand des heiligen Johannes als Reliquie verehrte, soll in muslimischer Zeit einst eine Locke des Propheten Mohammed aufbewahrt worden sein. Von den Zerstörungen durch die Kampfhandlungen des Bürgerkrieges ist nach umfangreichen Renovierungsarbeiten mittels Geldern eines ansässigen christlichen Bankiers sowie eines kuwaitischen Scheichs nichts mehr zu erahnen. Jeder finanziert ein Stück seines kulturellen Erbes; Recycling auf libanesisch.
Souks gesucht
Nicht weit von hier in nördlicher Richtung sollen die Geschäftsgassen der Beirut-Souks liegen. Auf dem Weg dorthin wird es noch leerer, obwohl wir ganz in der Nähe der Souks sein müssen. Auf der Karte eines alten Baedeker-Reiseführers aus dem Jahre 1912, den wir in der Heimat antiquarisch erstanden hatten, ist in diesem Stadtteil ein bunter Teppich verschiedener Läden und Gewerke verzeichnet. In der Mitte des 19. Jahrhunderts baute die osmanische Stadtverwaltung den gesamten Bezirk entlang einer geraden Achse zu einem Einkaufsbezirk um. So entstand 1874 der Souk al-Tawileh, der Lange, der auf die Herstellung von Kleidung spezialisiert war. Der Souk al-Jamil, der Schöne, diente dagegen nach seiner Fertigstellung 1895 hauptsächlich dem Verkauf teurer importierter Güter. Allein neun verschiedene Souks bezeichnet die alte Karte. Doch damit nicht genug. Hier in der Nähe des Zollbereichs am Hafen entstand auch das erste große Kaufhaus der Stadt, das seine Gäste mit einem eingebauten Lift in die Etagen lockte. Das Gewimmel in den Gassen muss unbeschreiblich gewesen sein. Wo sind die Menschenmassen geblieben? Wir laufen an einem Leerstand nach dem anderen vorbei und suchen nach etwas, das wie ein Eingang zu einer anderen Welt aussehen könnte. Vergebens. Entgegen unseren Erwartungen gibt es hier kein Gewirr von alten, versteckten Gassen und aneinandergereihten Läden, sondern vielmehr ein modernes Einkaufszentrum aus Glas und Beton. Zwar ist alles orientalisch angehaucht, doch die Buntglaslampen, die Wandmuster, die Durchgänge mit Lichtschächten und die Springbrunnen können das aufkommende Dubai-Gefühl nicht wettmachen. Hier gibt es Haute Couture, Kleiderketten und Schnellimbisse. Das ganze Ensemble wirkt seltsam entfremdet vom Geist der restlichen Stadt. Aber vielleicht gefällt ja den Beirutern ihre neue Shoppingmall, und wir sollten unseren romantisierten Blick auf den Orient überdenken. Uns kommt die gerade erstandene Stadtkarte wieder in den Sinn. Ein Griff in den Rucksack und wir sind mit einem Mal eines Besseren belehrt. Dort steht nur »Beirut-Souks« und eine Vielzahl von modernen Labeln und Firmen ist eingezeichnet. Wie naiv von uns zu glauben, der Krieg hätte die vormalige Substanz unverändert gelassen. Ein älterer Herr, der seinen Enkel an der Hand hält, muss unser Erstaunen bemerkt haben. Er kommt auf uns zu und spricht auf Französisch mit arabischem Akzent.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, wir vermissen die historischen Souks an diesem Ort«, kramt Anna ihr Schulfranzösisch hervor.
»Die wurden leider während des Krieges geplündert und brannten dann bis zu den Grundmauern ab. Wir haben durch die Kämpfe so viel an Bausubstanz verloren.«
»Was ist nach dem Krieg geschehen?«
»Solidere, eine Beiruter Stadtentwicklungsgesellschaft, hat die Souks wiederaufgebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ein Spanier die architektonischen Ideen dazu. Man soll sich teilweise an den Verlauf der alten Gassen gehalten haben.«
»Fühlen Sie sich denn wohl in diesem modernen Einkaufszentrum?«, will Anna noch von ihm erfahren. Er zuckt mit den Schultern, als würde er den Sinn unserer Frage nicht verstehen.
»Was will man machen, wenn alles zerstört ist. Nach dem Krieg wollten alle alles neu haben. Die letzten Reste osmanischer Baukunst konnten nur mit Mühe vor den gierigen Händen einiger Investoren gerettet werden und verfallen jetzt doch Stück um Stück. Wenn ihr Zeit habt, so schaut Euch mal den Heneine-Palast in der Nähe des Serails an. Dort könnt ihr sehen, wie Beirut einmal aussah. Und wenn Ihr ursprüngliche Souks im Libanon sehen wollt, die mehrere hundert Jahre alt sind, dann macht Euch auf den Weg nach Tripoli.«
Wir bedanken uns für seinen Tipp und entlassen ihn zum Wasserspiel mit dem kleinen Jungen, der seinen Großvater immer ungeduldiger zum Planschen auffordert. Der Herr hat unser Innerstes erkannt. Unsere Sehnsucht auf dieser Reise ist vor allem auf die verschwindenden Kulturgüter gerichtet. Aber wonach sehnen sich die, die den Libanon ihre Heimat nennen?
Wir pendeln zurück auf die andere Seite der Weygand Street, um Ziel auf den Grand Serail, den aktuellen Sitz des Premierministers, zu nehmen. Der Weg um die römisch-katholische St. Louis-Kathedrale steigt langsam an. Ein Jeep, vollbesetzt mit Soldaten in Tarnanzügen braust vorbei. Die sich anschließende, leicht erhöhte Capuchin Street formt ein einmaliges Amphitheater, dessen Bühne die Ruinen der öffentlichen römischen Bäder aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. sind. Hierher haben sich nur eine Handvoll Spaziergänger verirrt. Eine Mutter mit Kleinkind im Kinderwagen, ein junger Mann in Anzug und mit Lunchpaket, ein alter Mann im Qualm seiner Zigarette. Wir fühlen uns kurz wie in einer verschlafenen apulischen Kleinstadt. Es geht treppauf und treppab zwischen Mauern, Gewölben und Mosaiken. Dann, ein überdimensionales Schachbrett mit Figuren? Nein, nur ein quadratisches Feld mit Säulenresten, zwischen denen vormals heiße Luft zur Erwärmung der darüber liegenden Räume strömte. Die Geburt der Fußbodenheizung. Die Araber – auch sie kulturelle Erben der Römer – erkannten die Nützlichkeit der Körperpflege und die soziale Funktion der Bäder. Im Hammam gelten die gleichen Rituale wie einst zu römischer Zeit: Ausziehen, Eintauchen, Entspannen und Plaudern. Wie gern würden wir den Tag so ausklingen lassen, aber einen alten Hammam sucht man in ganz Beirut vergebens – Kriegsopfer. In einem kleinen Park unterhalb des Serails rasten wir hungrig, um unsere vertrockneten, aus Deutschland mitgebrachten Butterbrote mit frisch abgefülltem Wasser hinunterzuspülen. Das tut gut. Die Flasche schon fast leer getrunken, schauen wir uns angstvoll fragend an. Wie steht’s um das Brunnenwasser im Libanon? Wir werden es spätestens morgen wissen.
Die Pause im Schatten der Rückseite hoher Bankgebäude setzt jedenfalls frische Kräfte frei. Auf der oberhalb gelegenen Capuchin Street kommen wir nicht mehr weit, denn das laute »Stop! No entry!« eines vor dem Serail postierten Soldaten lässt uns erstarren. Seine Geste erlaubt keinen Widerspruch. Wir können ob des Bollwerkes aus Wachhäuschen, Schranke, Betonquadern und Panzersperren eins und eins zusammenzählen. Hier sollen der Premierminister und die Regierung geschützt werden. Zusätzlich ist um den Grand Serail überall Stacheldraht auf die Zäune gepflanzt. Kein Durchkommen. Uns bleibt nur der Blick nach oben auf den Kantari-Hügel, auf dem in hellenistischer Zeit die Akropolis stand. Den strategischen Wert des Hügels erkannten auch die Osmanen, die die unter Muhammed Ali Pascha, dem mächtigen Gouverneur der osmanischen Provinz Ägypten, erbaute Burg abtrugen und ab 1853 ein neues massives Gebäude im Karreebau errichteten, das ursprünglich als Kaserne diente. Der Gouverneur wechselte seinen Sitz vom alten Serail, der bis 1950 am Ende des heutigen Platzes der Märtyrer lag, ins neue Domizil. Der erste Weltkrieg brachte Invaliden und Versehrte hervor. Der Serail wurde ein Militärhospital. Der 1897 davor errichtete Uhrenturm wurde zu Ehren des 25. Jahrestages der Inthronisation von Abdulhamid II., dem vorletzten, später durch die jungtürkische Revolution zur Abdankung gezwungenen Sultan, errichtet. Überall im Land wurden derartige Türme zu diesem Gedenktag erbaut. Später auf unserer Reise werden wir den Clocktower in Tripoli noch besser kennenlernen als uns lieb ist. Seine letzte Neubestimmung erhielt der Serail nach dem Bürgerkrieg durch eine aufwändige Restauration. Der damalige Premierminister Rafiq Hariri überwachte die Arbeiten am Grand Serail persönlich. Leider bleibt uns der Zutritt verwehrt. Das ist umso trauriger, weil dadurch der Blick in den schönen Innenhof nur auf Fotos zu bewundern ist. Fotos von den Checkpoints rund um das Gebäude sind dagegen strengstens verboten. Also, keine Fotos mit Soldaten. Daher halten wir es wie die Libanesen: Selfies, Selfies, Selfies. Inzwischen spüren wir nach langem Marsch auf heißem städtischem Pflaster unsere schmerzenden Füße. Wir sind hungrig und kehren zu libanesischem Wein und Mezze ein. In tiefen Sesseln vor orientalischen Keramiktischen kehrt Teller um Teller Ruhe ein. Anna erinnert sich an die ersten Mezze ihres Lebens:
»Wusstest Du schon, wo ich das erste Mal beim »Libanesen« gewesen bin? Das war während des Masterstudiums in Bristol. Damals habe ich in einem Callcenter gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Ein Freund, der ebenfalls dort jobbte, um die Schulden bei seinen Eltern zu begleichen, die er durch zwei Jahre Nahostreisen angehäuft hatte, hat mich mitgenommen.«
»Gab es denn in Hattingen keinen Libanesen, bei dem Du in Deiner Kindheit oder Jugend mal gewesen wärst?«
»Ob es ein libanesisches Restaurant gab, weiß ich gar nicht. Aber unsere Familie ging – wie viele andere auch – für Feierlichkeiten am liebsten zum Chinesen oder Griechen. Der Besuch im »Sands« war daher für mich nach Peking-Ente süß-sauer und Gyros mit Tzatziki eine Geschmacksrevolution und die Geschichten des Freundes aus dem Nahen und Mittleren Osten haben mich fernsüchtig gemacht.«
»Da mussten wohl fast fünfzehn Jahre vergehen und wir uns ineinander verlieben«, lacht Uwe.
»Ich weiß noch, wie Du bei unserem ersten gemeinsamen Mezze-Essen im »Les Cedres« in Münster einen Flug nach Beirut vorschlugst. Da habe ich noch gelacht. Aber als Du zwei Tage später die Tickets aufs Bett gelegt hast, da wusste ich, dass ich mich genau in den richtigen spontanen Spinner verliebt hatte.«
»Spontan schon, aber wir beide waren durch die Erzählungen des Kellners über Saida und seinem Heimatdorf im Chouf infiziert und ermutigt.«
Shisha-Duft zieht zu uns herüber. Die Mädchen am Nachbartisch fangen an zu rauchen. Es wird laut gescherzt. Handybilder werden herumgereicht und gestenreich kommentiert.
Plötzlich fühlt sich diese Stadt trotz aller Narben nur noch lebendig und voller Versprechen an und die mitgebrachten Bedenken aus der Heimat verflüchtigen sich mit dem Rauch der Shishas in den Beiruter Nachthimmel.
Wenn Paläste zu Hütten werden
Für den nächsten Tag haben wir einen Spaziergang quer durch das im Westen Beiruts außerhalb Downtowns gelegene Hamra geplant. Vor 100 Jahren stand dort nichts. Die Empfehlung des älteren Herrn aus den Souks ist uns nicht aus dem Kopf gegangen. Wir nehmen deshalb einen kleinen Umweg über den Heneine-Palast. Dieser liegt an der Straßenkreuzung Fachreddine Avenue – Spears Street, die von einem hinter Sandsäcken verschanzten Armeeposten kontrolliert wird. Kurz bevor wir den militärischen Stützpunkt erreichen, donnert plötzlich vom Kantari-Hügel ein gepanzerter Wagen in Tarnfarben an uns vorbei, um unmittelbar vor einer Gruppe von Soldaten am Kontrollposten zu halten. Eine Luke auf dem Dach öffnet sich und ein Uniformierter taucht hinter dem montierten Maschinengewehr hervor. Es werden ein paar Grußformeln auf Arabisch ausgetauscht, bevor der Panzerwagen in Richtung Norden ins Hotelviertel weiterfährt. Alltag im Libanon – uns klopft das Herz.
Wir stehen am Fuße des monolithischen Murr Towers, der während der Jahre des Bürgerkrieges wegen seiner Höhe ein Nest für Scharfschützen darstellte. Es geht das Gerücht, dass die jeweiligen Besatzer des Turmes ihre Opfer lebendig nach unten stießen. Wer den Murr Tower hielt, kontrollierte das Kampfgebiet entlang der »Green Line« während des Hotelkampfes. Keiner konnte beim Beginn des Baus 1974 ahnen, welches Schicksal den Turm bereits ein Jahr später ereilen sollte. Ursprünglich war für den unvollendeten Turm die Einrichtung von Wohnungen, Geschäftsräumen und Shops, eines unterirdischen Kinos, und eines Restaurants auf der Dachterrasse geplant gewesen. Die Bauherren, die Murr-Brüder, mussten sich nicht um eine architektonische Anbindung an die unmittelbare Umgebung kümmern. Liberalismus pur. Nach dem Krieg wurde der Rohbau an Solidere verkauft und einem Architekturwettbewerb zur Neugestaltung zugeführt. Die ist bis zum heutigen Tag leider ausgeblieben. Wir schauen immer noch auf die grauen zerschossenen Betonwände der 40 Stockwerke nach oben auf die leeren dunklen Fensterlöcher. In diesen, wie Schießscharten wirkenden Aussparungen, flattern zu unserer Überraschung bunte Markisen, die nach einer Idee des jungen Straßenkünstlers Jad al-Khoury angebracht wurden. Er verwendet dafür gestreifte und bunte Stoffe, wie sie überall auf den Balkonen der ärmeren Stadtteile Beiruts und des gesamten Libanon zu sehen sind. Sie flattern geräuschvoll im Wind, als wollten sie die schlechten und traurigen Gedanken an den Krieg fortwehen. Vergangenheitsbewältigung kann unterschiedliche Gesichter haben. Die Bestie ist immer noch in den Köpfen vieler. Aber Resignieren gilt nicht. Die jungen Menschen im Land haben ihre eigene Stimme und ihre eigenen Methoden dafür.
Direkt gegenüber der Bauruine des Murr Towers steht, wie aus der Zeit gerissen, der Heneine-Palast. Jetzt am Morgen liegt die Frontseite im Schatten und lässt Einschusslöcher, bröckelnden Putz und kaputtes Mauerwerk als das erscheinen, was es ist: Das nicht mehr aufzuhaltende Ende eines ehemaligen osmanischen Prachtbaus. Ein Palast, was hat der Herr damit gemeint? Enttäuschung macht sich bei uns so breit wie das große Loch in der Fassade. Es soll bei Kranarbeiten am benachbarten Hochhaus entstanden sein. Aktivisten, die das architektonische Erbe der Stadt erhalten wollen, vermuten, dass dieser »Unfall« nur der erste Schritt zur Gewinnung von Baugrund für ein weiteres Hochhaus war. Todesmutig sprinten wir über die hier breite Avenue, um uns den ehemaligen Palast genauer anzusehen. Er wurde von einem russischen Adligen im ausgehenden 19. Jahrhundert erbaut. Zu jener Zeit war der Palast wie viele andere Herrenhäuser in Zokak el-Blat von Obsthainen und Gärten umgeben. Der bourgeoise Stadtteil war besonders attraktiv für die gehobenen Schichten, denn er befand sich in der Nähe des Zentrums von Beirut unmittelbar hinter der alten Stadtmauer. Viele ausländische Botschaften hatten hier ihr Domizil. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wohnten hier Christen, Sunniten, Drusen und Armenier Tür an Tür. Es bestand ein Gleichgewicht konfessioneller und sozioökonomischer Kräfte. Doch dann kam der Krieg, der alles veränderte.
Wir stehen inzwischen vor dem Gebäude, beschauen uns in der Querstraße die Fassade mit ihrer Ornamentik in den großen Fensterbögen, um schließlich wieder auf die nördliche Frontseite mit dem großen Loch zu gelangen. Irgendetwas muss von dem alten Glanz doch noch erhalten sein. Wir wollen hier rein! Kurze Blicke nach rechts und links. Alles ist frei. Wir bauen eine Räuberleiter und sind im Haus schneller als gedacht. Unsere Erfahrungen beim Überklettern von Mauern haben wir zusammen am Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin gemacht. Mittlerweile sind wir ein eingeschworenes Duo. Was wir dann im Palast sehen, reißt uns von den Beinen. Der russische Aristokrat setzte hier, mitten in Beirut, seine orientalische Fantasie einer Alhambra um. Reich verzierte Arkaden, eine schwebende Treppe, dekorierte Wandpaneele und ein Deckenhimmel mit Tausendundeinem Stern. Dazu gibt es einen phantastischen Ausblick in Richtung der Fachreddine Avenue. Für uns tut sich eine andere Welt auf. Hier findet unsere Sehnsucht ihr Ziel, wenn auch nur als Ruine. Wie müssen sich die Mitarbeiter des US-Konsulats, das hier seit dem Beginn des ersten Weltkrieges für die nächsten 22 Jahre beheimatet war, gefühlt haben? Wie Emire? Die schrecklichen Ereignisse des Jahres 1983, als pro-iranische Dschihadisten die neue amerikanische Botschaft mit einer Autobombe zersprengten, lagen noch fern. Uwe kann sich noch gut an die Eilmeldungen im »RIAS« aus Westberlin und die aufgeregten Diskussionen mit seinem Freund Volker auf dem Schulhof erinnern.
Die Besitzung wechselte schließlich zur Heneine-Familie, dann verliert sich die Spur mit dem Bürgerkrieg. Der letzte gesicherte Untermieter soll Dr. Dahesh, ein Künstler, Hypnotiseur und selbstbezeichneter Prophet gewesen sein. »Hoffentlich ist sein Geist mit seinem Tod auch aus diesem Haus gegangen.«, lacht Uwe. »Lass uns das Weite suchen.« Kichernd stehen wir wieder in der Querstraße, als eine Frau von Mitte 20 unseren Weg streift. Möglicherweise sieht sie in unseren Gesichtern die Freude und den Schweiß unseres bestandenen Abenteuers, denn sie bleibt vor uns stehen. Sie stellt sich als Carole vor, ist Studentin und wohnt seit drei Jahren im Viertel.
»Wenn Ihr nächstes Jahr kommt, ist das alte osmanische Haus bestimmt nicht mehr da«, sagt sie traurig.
»Gibt es denn keinen Plan, es zu erhalten?«
»Doch schon, es wurde 2015 sogar in die Beobachtungsliste des World Monument Funds, einer privaten Non-profit-Organisation, aufgenommen. Aber seinen weiteren Verfall hat das auch nicht aufgehalten. Nur alte Steine zu lieben, ist zu wenig. Es müsste mehr getan werden.«
»Kümmern sich nicht Stellen der Regierung um das kulturelle Erbe?«
»Ach, die Regierung«, sagt sie und macht dabei eine wütende Geste, »die Regierung ist durch und durch korrupt. Sie verdienen bei aktuellen Preisen von 4.000 US$ pro Quadratmeter mit am neu geschaffenen Wohnraum von Luxusapartments in Zokak el-Blat. Zusätzlich kollidieren die Interessen von Solidere mit dem Schutz der historischen Bausubstanz. Stellt Euch das mal vor: Mitte der 90er Jahre waren noch knapp über 1.000 Gebäude auf der Inventarliste der erhaltungswürdigen Gebäude in Beirut, rund 100 davon hier im Quartier. Kaum fünf Jahre später blieb nur noch ein Viertel übrig. Es ist ein aussichtsloser Kampf gegen die Zeit, und wir werden ihn verlieren.« Sie klingt desillusioniert.
»Wen meinst Du mit wir?«, setzt Uwe nach.
»Wir alle, die Libanesen, denn mit jedem abgerissenen Haus stirbt auch unsere Identität. Schaut Euch ruhig mal hier um, und Ihr werdet verstehen, was ich meine.«
Carole erklärt uns, zu ihrer Vorlesung an der AUB, der American University of Beirut, eilen zu müssen, sie ist schon spät dran. »Vielleicht sehen wir uns ja später auf dem Campus«, schicken wir ihr mit auf den Weg, denn wer wie wir durch Hamra muss, kommt dort vorbei.
Wir lassen uns auf Caroles Vorschlag ein und dehnen unsere Tour durch Zokak el-Blat noch ein wenig aus. Versteckt und verfallen stehen sie einzeln zwischen den hohen neuen Wohnblocks: Osmanische Häuser, bestehend aus Mittelhalle, frontalem Drillingsfenster und Zeltdach mit roten Ziegeln. Sie bezaubern immer noch trotz oder gerade wegen ihrer Morbidität und verdienen eine Chance.
WEST-BEIRUT – da, wo die Sonne untergeht
Rot ist mein Name
Die Michel Chiha Street führt parallel zur Spears Street direkt bis ins Viertel Hamra, das schlicht »Rot« bedeutet und das aufgrund der hier ansässigen American University und der zahlreichen Cafés entlang der Hamra Street in den sechziger und siebziger Jahren der Treff der intellektuellen und linken Szene war. Ein Stück Beirut, in dem Identitätsideen kontrovers diskutiert wurden. Die (Er)Findung einer nationalen libanesischen Identität als Jahrhundertaufgabe von Menschen achtzehn verschiedener, von der Verfassung anerkannter Konfessionen. Michel Chiha, nach dem die ins Herz von Hamra führende Straße benannt ist, war einer der bedeutendsten Politiker und Denker in den Jahren des französischen Mandats. Ihm schwebte ein Libanon als eine »Riviera« mit Beirut als intellektuellem und kulturellem Zentrum des gesamten orientalischen Raums vor. Chiha gehörte den christlichen, frankophonen Kreisen der haute bourgeoisie an und fühlte sich vermutlich, außer in Beirut, eher in Paris zuhause als in irgendeiner Stadt des Nahen Ostens. Seine Idee einer libanesischen Identität, die hauptsächlich von Christen, zumeist Maroniten, unterstützt wurde, fand Niederschlag im Nationalpakt von 1943, einer Übereinkunft über die nationalen Identitäten: »Der Libanon nimmt all das Vorteilhafte und Nützliche westlicher Zivilisationen auf.« An anderer Stelle des Nationalpaktes, die auf der Initiative städtischer Sunniten wie der Familie al-Hariri aus Sidon beruht, wird der Libanon als ein Land »mit arabischem Gesicht« gesehen. Nur die verarmten, bildungsfernen Schiiten fanden kein Gehör. Ihr über die Jahre immer weiter radikalisiertes Bild eines schiitischen Staates ohne Duldung der Existenz Israels resultierte in der Bekämpfung aller anderen Vorstellungen libanesischer Identität. Deshalb stürzte das Land der vielen Gesichter, aber ohne einheitliche Identität, in den Bürgerkrieg, in dessen Verlauf sich verschiedene Gruppierungen im Libanon in wechselnden Koalitionen bekämpften und es darüber hinaus zu mehreren Interventionen durch Staaten wie Syrien, Israel und die USA kam.
Während wir uns durch hupenden Verkehr an den Schaufenstern vieler westlicher Ketten, Hotels, Apartmenthäuser und Cafés vorbeikämpfen, können wir uns inmitten dieser dichten, charmelosen Bebauung nur schwerlich vorstellen, wie hier kluge Köpfe bei Zigaretten und Kaffee zusammengesessen haben sollen. Vom Konsumdschungel, der uns hier umgibt, knurrt uns jedenfalls der Magen. Nichts wäre leichter, als an einem der zahlreichen Fastfoodstände zuzuschlagen, aber wir entscheiden uns für den Einkauf in einem innerstädtischen Supermarkt. Vorher wollen wir in der 100 Meter entfernten Baalbek Street noch am Hotel Commodore vorbei, dem legendären Journalistenhotel der Bürgerkriegsjahre, das eines der wenigen funktionierenden Faxgeräte in dieser Zeit gehabt haben soll. Heute liegt es als renoviertes 4-Sterne-Hotel im Herzen von Hamra, aber vor über dreißig Jahren war es nach den Berichten von Thomas Friedman, einem amerikanischen Journalisten, ein irrer Ort inmitten des tobenden Bürgerkrieges. Er erzählt vom Papagei in der Hotellobby, der perfekt das Pfeifen einer heranfliegenden Artilleriegranate imitieren konnte; von dem Empfangsherrn, der die ankommenden Gäste danach fragte, ob ihnen ein Zimmer zur Granatenseite des Hotels, der Seite nach Ost-Beirut, oder der friedlichen Seite, zum Meer hin, genehm sei; von der konspirativen Kraft der Hotelangestellten, die die am Abend großzügig ausgeschenkten Spirituosen als »Dry Cleaning« auf die Rechnung für die Arbeitgeber der Reporter setzten. Von den Geschichten der Kameradschaft unter Kriegsreportern, von arrangierten Informationstreffen zwischen Kämpfern und Journalisten, von Explosionen, Verbrüderung bei Whiskey auf Eis und dem Informationsfluss der Kriegsgeschehnisse in die weite Welt über das eine Telefonkabel ist heute nichts mehr zu erahnen. Geblieben ist ein arabisch ausstaffiertes Allerweltshotel, das seinen Gästen die spannenden Geschichten seines früheren Lebens vorenthält. Wie schade. Nach dem kurzen Blick in die langweilige Lobby hat sich der Hunger spürbar zu einem Magengrollen aufgebaut. Uns kommen Menschen mit vollgepackten Plastiktüten entgegen. Cornflakes-Packungen und Salatköpfe ragen heraus. Wir können nicht mehr weit von einem Supermarkt entfernt sein. Zu Recht lieben unsere Kinder auf Urlaubsreisen die Besuche solcher Läden. In der Auswahl der Produkte, der Art der Darbietung und dem Einkaufserlebnis kann sich einiges offenbaren. Der Coop libanaise jedenfalls enttäuscht uns nicht. Es gibt eine große Obst- und Gemüseabteilung und eine gut bestückte Käse- und Fleischtheke. Die übrigen Produkte, die bei uns in Deutschland Reihe für Reihe ausmachen, reduzieren sich hier auf ein Regal mit Fladenbroten, Tee, ein paar Kekssorten und Getränken. Für Fertigpizzen, Asiasnacks & Co ist hier kein Platz vorgesehen. Nach einer Hand- und Fußverständigung an der Käsetheke, die die auf beiden Seiten des Verkaufstresens Stehenden zum Lachen bringt, verlassen wir den Supermarkt mit Fladenbrot, Oliven, Salami, Gürkchen und Schafskäse. In nördlicher Richtung erstreckt sich das ausgedehnte Gelände der American University of Beirut. Wir durchschreiten das Portal, an dem der Name auf Englisch und Arabisch angebracht ist. Darunter das Gründungsjahr 1866. Wir überqueren den Campus bis zum Hauptgebäude und lassen uns zum Picknick auf dem Rasen nieder. Das wunderschöne Sandsteingebäude mit den osmanischen Torbögen im Eingangsbereich wird von Palmen und Zypressen gesäumt. Der ganze Campus ist lieblich und grün – eine Oase des Lernens. Der Lärm der Straßen ist hier verbannt, das Rauchen auf dem Gelände abgeschafft, vom Meer weht eine sanfte Brise und die Sonne taucht das Areal in ein warmes Licht, das vom Sandstein reflektiert wird. Wie soll man in einer solchen Umgebung nur lernen? In unserem deutschen Studentenleben in Hamburg und Münster waren sommerliche Zwanglosigkeit und Heiterkeit jedenfalls seltener als graue, regenverhangene Tage: viel Zeit zum Lernen!
Eine junge Frau gesellt sich zu uns.
»Wo kommt Ihr her? Aus Deutschland? Habt Ihr schon die Ausstellung gesehen?«
»Ja, aus Deutschland und Nein«, gibt Anna etwas schüchtern zu, »wir wussten gar nicht, dass es hier im Moment eine Ausstellung gibt, wir sind hier einfach mal durchgeschlendert, um die Universität zu sehen.«
»Wenn Ihr Lust und Zeit habt, geht gleich mal zur West Hall rüber. Meine Fakultät hat ein interessantes Projekt initiiert, als Zwischenergebnis ist nun eine kleine Präsentation zu sehen.«
»Was ist das denn für ein Projekt«, fragt Uwe.
»Wisst Ihr über den Bürgerkrieg Bescheid?«
»Nun ja, schon, was man so lesen und hören kann. Und wir haben natürlich schon ein paar Häuser mit Einschusslöchern gesehen.« Sie nickt aufmunternd.
»Seht Ihr, nach dem Bürgerkrieg haben wir Libanesen eine Kultur des Verdrängens und Vergessens gepflegt. Wir dachten, wenn wir nicht über das Grauen sprechen, vergeht es irgendwann. Heute wissen wir, dass das nicht funktioniert. Der Bürgerkrieg ist noch immer in den Köpfen und Herzen der Menschen, die die Gräueltaten miterlebt haben. Die Erinnerung an diese Zeit hat zwar einen allseitigen Wunsch nach Frieden ausgelöst, aber im Inneren hat sie die Gesellschaft eigentlich tief gespalten. Diese Spaltung setzt sich fort. Daher wurde das Projekt »From Local History to a wider understanding of the past« ins Leben gerufen.
»Welches Ziel hat denn das Projekt?«
»Unser Ansatz ist es, Lehrer auszubilden, die ihre Schüler dazu ermutigen, das Schweigen zu brechen. Mit ihren Eltern und Großeltern über die Kriegsjahre zu sprechen, die ganz persönliche Geschichte der Familie oder des Ortes zu hören. Wir nennen das »oral history«. Es geht um Verständnis und Kommunikation. Die Schüler hatten die Aufgabe, das Gehörte in einem kleinen Poster zusammenzufassen. Diese Ergebnisse werden gerade ausgestellt. Es sind viele kleine bewegende und überaus persönliche Mosaikstücke, die zum Bild der Bürgerkriegsjahre beitragen.« Sie schaut uns gedankenverloren an.
»Ziemlich bewegend sogar.«
Ein noch jünger aussehendes Mädchen mit Kopftuch winkt sie zu sich und so schnell wie sie aufgetaucht ist, so schnell verabschiedet sie sich auch. Schade, wir hätten sie gerne noch gefragt, was sie studiert, wie das Leben als Studentin hier ist und welche Geschichten über den Bürgerkrieg ihre Familie zu erzählen hat. Trotzdem sind wir guten Mutes. Auch am zweiten Tag merken wir, dass hier keiner verschämt oder genervt beiseite sieht, sondern wir überall mit offenen Herzen empfangen werden. Das Interesse auf beiden Seiten ist ehrlich, der Small Talk fällt aus, es geht direkt ans Eingemachte. Conversation libanaise. Wir sind begeistert.
Wir steigen Dutzende Stufen hinab zur Corniche, zur Strandpromenade. Dort ist am späten Mittag nicht viel los. Ein paar ältere Herren trainieren ihre welken Körper, es wird geangelt und gehupt. Auf einer der zahlreichen Bänke sucht man vergeblich nach Ruhe und Erholung. Die Corniche ist zwar Flaniermeile, aber gleichzeitig auch Hauptverkehrsader. Das scheint die mit Recreation beschäftigten Libanesen jedoch keineswegs in ihrer Erholung und Ertüchtigung zu stören. Wir schlendern in Erwartung eines Strandbades Richtung Leuchtturm, der den nordwestlichsten Punkt der Küste markiert. Es stellt sich heraus, dass die Beiruter eine spezielle Vorstellung vom Baden am Meer haben. Überall finden sich mehr oder weniger gut gestaltete Beach Clubs mit Betonromantik. Gebadet wird in Becken auf Meereshöhe, aber nicht im Meer selbst. Der Eintritt zu den Clubs ist ziemlich teuer. Umgerechnet zwischen 15 und 45 Euro. Wer kann sich das hier leisten? Das kann man doch günstiger haben, oder?
Wir winken ein Taxi heran und nennen den öffentlichen Ramlet al-Baida-Strand als Ziel. Bei den Beirutern ist er wegen der dahinter verlaufenden gleichnamigen Avenue als »Hariristrand« besser bekannt. Auf dem Weg dorthin hält der Taxifahrer plötzlich direkt an der Corniche und bedeutet uns auszusteigen. Wir sind uns sicher, dass wir noch nicht da sein können. Hat der Fahrer uns missverstanden? Bringen uns die 15.000 libanesischen Pfund nur bis hierher? Wir sind etwas ratlos. Der Taxifahrer lacht, steigt selbst aus und winkt uns hinter sich her. Mit ausgestrecktem Arm zeigt er Richtung Meer. Jetzt sehen wir, was er meint. Er möchte uns die Pigeon Rocks, zwei Felsformationen im Meer vor dem westlichsten Punkt Beiruts, zeigen. Bereits im Flieger haben wir die Naturschönheit bewundert, weil der Sicherheitsfilm der Middle Eastern Airlines sie zeigt. Nach der griechischen Mythologie sind die Felsen von Raouché, wie sie auch heißen, die Überbleibsel eines Seeungeheuers, das der Held Perseus tötete, um Andromeda zu retten. Perseus zeigte ihm das Medusenhaupt, woraufhin es zu Stein erstarrte.
»Come sunset«, sagt der Taxifahrer zu uns.
Wir nicken und nehmen uns vor, ein andermal das schon vor hundert Jahren im Baedeker-Reiseführer für Syrien und Palästina beschriebene Farbenspiel bei Sonnenuntergang zu würdigen. Jetzt ist uns nach Baden und wir begeben uns wieder auf die Rücksitze des Taxis. Der Hariristrand ist der einzige öffentliche im gesamten Stadtgebiet und liegt in Unesco. Der ungewöhnliche Name dieses Stadtteils geht auf den nur wenige hundert Meter hinter dem Strand liegenden UNESCO-Palast zurück. Das ungewöhnliche kubische Gebäude wurde im Jahr 1948 eröffnet, um die dritte internationale UNESCO-Konferenz der Vereinten Nationen abzuhalten. Für viele Zeitzeugen galt die Ausrichtung der Konferenz als der erste ernsthafte Auftritt der jungen libanesischen Republik auf internationaler Bühne. Der Palast wurde in den Folgejahren zu einem geschätzten Ort für lokale und internationale Aktivitäten, wie Konferenzen oder Ausstellungen. 1982 wurde der Palast durch Luftangriffe der israelischen Armee stark beschädigt, im März 1998 jedoch anlässlich des 50. Jahrestages der ersten UNESCO-Konferenz im Nahen Osten nach umfassender Sanierung wiedereröffnet. Wie am Palast, so sind auch bei den meisten der angrenzenden Gebäude in diesem Stadtteil die Wunden des Krieges wieder zugeheilt. Den Hariristrand scheint man dagegen vergessen zu haben. Er hat bestimmt schon bessere Tage gesehen. Verrostete Schaukelgestelle reihen sich aneinander, es sind nur wenige Menschen vor Ort und noch weniger gehen ins Wasser. Wir beziehen das auf die Kälteempfindlichkeit der mediterranen Bevölkerung und die geringe Neigung der Libanesen, sich abseits der Beach Clubs in Bikini und Shorts zu werfen und mit Sand zu beschmutzen. Wer die Reisehinweise offizieller deutscher Stellen genauer studiert hat, dürfte eigentlich überhaupt nicht in die Nähe von Mar Elias gelangen und an diesem Strand stehen. Wir tasten uns deshalb vorsichtig ins »feindliche« Gelände vor und klammern uns zunächst verkrampft an unsere Habseligkeiten. Unsere skeptischen und vorsichtigen Blicke in alle Richtungen können jedoch beim besten Willen keinen Feind ausmachen. Daher entscheiden wir kurzerhand, alles am Strand liegen zu lassen und gehen auf das kühle Nass zu. Das Wasser ähnelt bei näherer Betrachtung eher dem Erscheinungsbild des heimatlichen Dortmund-Ems-Kanals oder dem Inhalt eines Putzeimers nach einem Gang mit Schrubber und Lappen durch die Küche. Doch wir wagen einen todesmutigen Sprung in die grau-flockigen Fluten. Wer will schon klagen? Hier gilt es einzutauchen ins Lokalkolorit. Am nächsten Tag sollen wir dann herausfinden, dass die Qualität der Brühe noch um einiges schlechter ist als in unserem heimischen Badesee, denn die gesamten Abwässer der Stadt gehen nahezu ungeklärt in das Meer. Mit diesem Wissen findet selbst für hartgesottene deutsche Strandurlauber die Badefreude – zumindest hier in Beirut – ein jähes Ende. Es scheint so, dass die einzige Gefahr des Hariristrands unsichtbare Mikroben sind. Menschen braucht man (auch) hier nicht zu fürchten.
Nach einer heißen Dusche, deren Bedeutsamkeit wir Gott sei Dank erst einen Tag später erfahren, und aufgeladenen Herzen treten wir zur besten libanesischen Ausgehzeit in der Dunkelheit wieder vor die Türe und ergattern eine Chaiselongue unter Feigen- und Olivenbäumen im Al-Falamanki, einem Café und Restaurant an der Damascus Street, das kalte und warme Mezze serviert. Vor der Tür röhren protzige Luxuswagen mit Dubaier Kennzeichen. Westlich durchgestylte junge Araber prahlen mit ihrem teuren Blech. Hier kann man unbeaufsichtigt von heimischen Sittenwächtern mal so richtig die Sau rauslassen. Wie praktisch, wenn man Geld hat und die Missstände einfach zuhause zurückbleiben. Doppelmoral.
Ouzai – der Märtyrer trägt heute bunt
Beflügelt durch unser »Überleben« am Hariristrand am letzten Tag lassen wir uns heute mit dem Taxi von unserem Apartment in den südlich von Mar Elias gelegenen Stadtteil Ouzai bringen. Ouzai soll als schiitische Hochburg eigentlich eine No-Go-Area für Touristen sein. Das zumindest sind die Verlautbarungen des Auswärtigen Amtes und der Tenor von Artikeln im Politikteil führender Zeitschriften, die ein Büro vor Ort haben. Bezeichnenderweise liegen die schiitischen Stadtteile alle südlich einer gedachten Linie durch die iranische Botschaft. Hier sollte man also eigentlich nicht sein. Beim Anflug auf Beirut sind uns schon vom Flugzeug aus die baufälligen, aber farbenfrohen Häuser dieses Stadtteils aufgefallen. Das Kolorit passte so gar nicht zum betongrauen und beigen Ton des umliegenden Häusermeeres. Besser kann man kaum Werbung für eine als verwahrlost geltende Wohngegend machen. Wie ein Kinderzimmerboden nach einem Spiel mit Bauklötzen zieht das Kunterbunt uns an. Das Farbenfrohe gehört zu einem Ouzville genannten Projekt, dessen Schöpfer Ayyad Nasser einem der armseligsten Bezirke von Beirut den Sinn und das Gefühl von Gemeinschaft zurückgeben wollte. Die Gegend litt wie so viele andere auch unter der andauernden Zerstörung und der kaum nachlassenden Gewalt nach dem Ende des Bürgerkrieges. Die Transformation des Viertels Ouzai sollte durch den farbigen Anstrich der heruntergekommenen Gebäude vollzogen werden. Ouzai kündigt sich durch einen Wald von Flaggen der schiitischen Amal-Bewegung auf dem Mittelstreifen des parallel zum Meer führenden alten Highway nach Saida an. Die einzigen Farben, die wir bislang ausmachen können, sind lila und gelb auf einem überdimensionierten Graffiti, das ein junges seliges Märtyrerantlitz zeigt. Auf einer anderen lilafarbenen Häuserwand hält ein Junge mit Lockenkopf ein Spielzeuggewehr im Anschlag. Wir sind unserem Ziel offenbar auf der Spur. Hier werden radikale politische Botschaften an Mann, Frau und Kind gebracht. Mit der Leichtigkeit des farbenfrohen Puzzles aus dem Flugzeugfenster haben diese Bilder aber nichts gemein. Die Endlosigkeit der tristen Kleingeschäfte entlang der großen Straße nimmt kein Ende. Da unser Fahrer von Ouzville noch nie etwas gehört zu haben scheint, fragen wir in einem kleinen Spielzeugladen den Besitzer nach dem Weg zu den bemalten Häusern.
»Ah, Ihr meint die Kunst an den Häusern? Da könnt Ihr hier parken, sie fängt gleich um die Ecke an.« Wir folgen seinem Rat.
Eine Querstraße weiter und wir befinden uns in einer anderen Welt. Die Häuser sind zwar in ähnlich schlechtem Zustand wie in anderen armen Gegenden Beiruts, aber sie sind einfarbig oder gemustert angestrichen. Die Wände und Gartenmauern sind mit Graffiti und unterschiedlichen Motiven gestaltet. Darf es ein wenig Hawaii oder Karibik sein? Schildkröten, Bananenblätter und Hibiskusblüten lassen unweigerlich an die Inseln dieser Gefilde denken. Sehnsucht nach den Metropolen der Welt? Big Ben, Eifelturm und Basilius-Kathedrale laden zum Träumen ein. Oder wie wär’s mit einem Tag im Süden Amerikas? Lange vielfarbige Bänder um die Häuser geben einem das Gefühl, in einem kolumbianischen Straßendorf zu sein. Die Wege sind zudem sauber wie in einer deutschen Kleinstadt. Die schmalen bepflanzten Streifen vor den Eingängen sind gepflegt. Bunte Wimpel flattern über unseren Köpfen. Botschaften vom Frieden wurden an die Wände gesprayt. Ein klappriger Bulli steht auch noch herum. Fast ein wenig zu viel Klischee. Sind wir in einem Hippiedorf gelandet? Das nun wieder auch nicht, denn die Gruppe von Frauen in schwarzen Hijabs auf einem Balkon bringt uns wieder in die schiitische Wirklichkeit zurück. Doch in diesem kleinen Stadtteil direkt hinter der Küstenlinie scheint sich etwas getan zu haben. Genau darauf zielte die Idee der Initiatoren des Projektes ab: durch Veränderung der äußeren Umstände das Innere der Menschen bewegen. Der Beginn war für die Koordinatoren der Initiative schwer. Keiner der Anwohner wollte bei den Malerarbeiten helfen, also begannen sie allein. Doch dann wollten immer mehr ausländische und Beiruter Straßenkünstler in das Projekt involviert werden. Die Künstlerin Marie-Jo Ayoub brachte Studenten der Libanesischen Akademie der schönen Künste nach Ouzville. Der Spot für Street Art wurde immer bekannter. Normalerweise wäre keiner der Künstler vorher in diese gefährliche Gegend gegangen. Doch die in Farbe gegossene Kunst veränderte alles. Jetzt wollte jeder hierher kommen, die malenden Menschen sehen und einfach nur mitmachen. Kinder aus der Nachbarschaft gesellten sich dazu, legten ihre Spielzeugpistolen ab und bewaffneten sich mit Pinseln und Farbtöpfen. Wer wollte da noch passiv herumstehen und nicht Teil dieses Projektes sein. Denn je populärer das Viertel in Beirut und im ganzen Land wurde, desto mehr Besucher kamen und kommen hierher, so dass sogar das lokale Kleinbusiness immer mehr profitiert. Dazu gehören zum Beispiel kleine Cafés und Restaurants.
In einem von diesen landen wir auch, dem Café »Riba«. Vor dem Eingang sehen wir auf einem gegenüberliegenden Balkon ein hübsches Mädchen mit rotem Kopftuch. Sie hängt bunte Wäsche auf, lächelt und winkt, als würde sie uns zum Besuch des Lokals ermutigen. Wir nehmen auf der Außenterrasse Platz. Die Wellen schlagen gegen die Restaurantbrüstung und hinterlassen Spuren kleinster Salzkristalle auf unseren Gesichtern. Die Stühle sind bunt gestrichen, und ein kleiner Garten lädt zum Verweilen ein. Mit einem frisch gepressten Orangensaft in den Händen beobachten wir eine Crew von Fischern beim Einholen ihres Fangnetzes. Hier scheint auch der ideale Platz für spotter zu sein, wenn sie Maschinen beobachten, die den nahegelegenen Flughafen anfliegen. Der Innenraum des Restaurants ist im Vintage-Look gehalten. Alte Waagen, ausgediente Radios und kaputte Fotoapparate dekorieren Vitrinen und Regale. Getrocknete präparierte Fische und Haifischflossen schmücken die Wände. Wer’s lebendiger mag, der kann sein Essen direkt in der gut ausgestatteten Fischtheke auswählen. Das Lokal ist gut besucht, viele junge Leute und Familien sind unter den Gästen. Alle wirken entspannt. Die schiitischen Eiferer und das Elend Südbeiruts sind fern. Wir wähnen uns im schönsten Café Beiruts. Ouzville – ein Konzept, das Schule machen sollte im Libanon. Das Haar in der Suppe? Keines, nicht einmal die Steilklippe aus Müll kaum 50 Meter weiter hinter einer hohen Mauer. An die Berge aus Müll im Land hat sich unser Blick schon gewöhnt.
Shatila – im innersten Kreis der Hölle
And who will have won
When the soldiers have gone
From the Lebanon
The Lebanon
(Aus The Lebanon von The Human League)
Den Hariristrand haben wir »überlebt«, das schiitische Ouzai hieß uns willkommen. Ist es nach diesen Erfahrungen naiv, todesmutig oder einfach nur optimistisch zu denken, dass uns drei Monate später und wieder zurück im Libanon im Flüchtlingslager Shatila schon nichts passieren wird? Freunde und Bekannte in Deutschland würden uns für verrückt halten, den Zutritt zum Lager nun auch noch mit unserem kleinen Johann, der diesmal mit dabei ist, zu wagen. Doch wer den Libanon in Gänze verstehen will, der darf nicht an der Tragödie der palästinensischen Flüchtlinge vorbeischauen.
Shatila liegt fast unbemerkt rechterhand an der vom Flughafen in Richtung Zentrum führenden Autobahn. Hinter dem Camille-Chamoun-Stadion, in dem sonst die libanesische Fußballnationalmannschaft ihre Spiele austrägt, leben an der Stadtgrenze zu Beirut auf einer Fläche von nur einem Quadratkilometer nach offiziellen Angaben ca. 10.000 Menschen. Inoffiziell spricht man von bis zu 22.000 Bewohnern, was der Bevölkerungsdichte von Tokio entspräche. Im Unterschied zur saubersten und höchsten Megacity der Welt drängen sich hier aber die Großfamilien in den meist nur vier- bis fünfstöckigen baufälligen Häusern auf engstem Raum. Das Lager wurde 1949 durch das Internationale Rote Kreuz für palästinensische Flüchtlinge eingerichtet, die im Zuge des arabisch-israelischen Krieges aus Dörfern im Norden des heutigen Staates Israel vertrieben wurden. Waren die Lebensbedingungen seit Einrichtung des Camps schon immer miserabel, so verschärften der Golfkrieg und der syrische Bürgerkrieg mit dem Zuzug weiterer Flüchtlinge nochmals die Lage. Wir haben inzwischen das Lager erreicht. Es ist hier an der Ostseite von hohen Mauern mit Stacheldraht umgeben. Wer soll hier vor wem beschützt werden? Wir erwarten einen bewachten Eingang. Security, die kontrolliert, gibt es aber nicht.





























