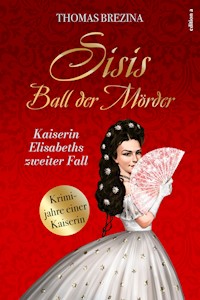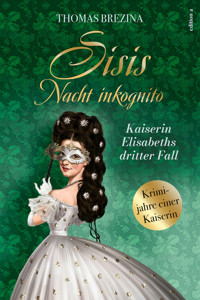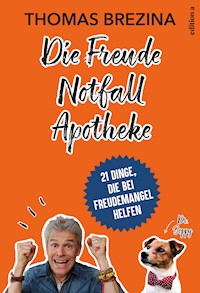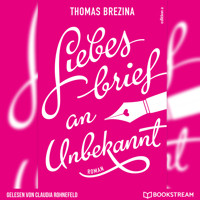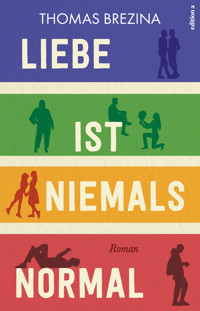
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julian, queer und Single, hat die besorgten und vorwurfsvollen Blicke seiner Eltern satt. Für das bevorstehende Fest zu seinem 22. Geburtstag kündigt er seinen Freund an. Das Problem: Es gibt ihn noch nicht. Mithilfe seiner besten Freundin Antonia stürzt er sich in die Welt des Datings, wo ihn Abenteuer und Peinlichkeiten erwarten. Wird er so den Richtigen finden? Von einem Dating-Desaster ins nächste stolpernd, bekommt er noch dazu einen neuen Mitbewohner. Der heißt Erik und ist ein großes Rätsel. Allerdings macht ihn gerade das besonders attraktiv …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LIEBE IST NIEMALS NORMAL
Thomas Brezina:
Liebe ist niemals normal
Alle Rechte vorbehalten
©2025 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Bastian Welzer
Satz: Anna-Mariya Rakhmankina
Gesetzt in der Benne
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 – 28 27 26 25
ISBN: 978-3-99001-828-6
eISBN: 978-3-99001-829-3
THOMAS BREZINA
LIEBE IST NIEMALSNORMAL
Roman
edition a
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Nachwort
1
»Hast du endlich einen süßen Boyfriend gefunden?«, fragte mich meine Mutter beim Mittagessen.
Ich verschluckte mich am Serviettenknödel, den ich mir gerade in den Mund gesteckt hatte, und musste husten. Weil ich meine Serviette nicht schnell genug hochreißen konnte, trafen ein paar kleine Knödelstücke den Rest des faschierten Bratens, der auf einem ovalen Servierteller lag.
Mein Vater schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Julian, hast du überhaupt kein Benehmen mehr?«
Hatte ich schon. Aber woher konnte ich ahnen, dass mir meine Mutter beim sonntäglichen Mittagessen eine Frage stellen würde, die nicht nur peinlich war, sondern auch klang, als hätte sie ein neues Vokabel im Englisch-Sprachkurs gelernt.
Boyfriend
Keine Ahnung, woher sie das Wort kannte. Ich hatte es jedenfalls noch nie aus ihrem Mund gehört. Sie sprach es aus wie Ameisensäure oder Brechwurz. Was eine Brechwurz genau war, wusste ich nicht, aber ich hatte das Wort neulich in einer Doku gehört und es war hängengeblieben.
»Hältst du den Mittagstisch für den geeigneten Ort, deinem Sohn eine solche Frage zu stellen?«, herrschte mein Vater die Frau an, mit der er seit dreißig Jahren verheiratet war. Ich hatte die Feier ihrer »Perlen-Hochzeit« erst vor ein paar Wochen erdulden müssen. Die halbe Verwandtschaft hatte sich nach meinem Leben in Wien erkundigt, nach meinen Fortschritten im Studium und ob ich endlich eine Freundin gefunden hätte. Mit eingefrorenem Lächeln im Gesicht hatte ich verneint.
Mein Schweigen und meine Teilnahme an der Perlen-Hochzeitsfeier waren eine reine Geldsache, genauso wie die Sonntagsessen, die ich alle zwei Wochen über mich ergehen ließ. Mein Vater hatte die regelmäßigen Besuche als Bedingung für seine monatliche Zahlung gestellt. Es war ein niedriger Betrag mit zwei Nullen am Ende, aber ich konnte auf das Geld nicht verzichten.
Meine Mutter kniff ihre Lippen zusammen, bis sie nur noch ein dünner Strich waren. Mit großer Beherrschung fixierte sie einen Punkt am anderen Ende des Esszimmers und sprach leise, aber mit Nachdruck. »Was ist dabei, wenn ich wissen möchte, ob mein Sohn endlich einen Freund hat und nicht mehr herumsuchen muss?«
Lieber Boden, tu dich auf und verschlinge mich, betete ich. Der Boden aber kannte keine Gnade. So saß ich weiter da und versuchte, meine Ohren mit Gedankenkraft zu verschließen.
Ging nicht.
Mit »herumsuchen« meinte meine Mutter »wilden, hemmungslosen, anonymen Sex mit Männern, einzeln oder in Orgien«. Das war ihr Bild von Queer-Dating.
Schön wär’s, dachte ich. Mein letztes Mal lag exakt elf Wochen und drei Tage zurück. Gus (Abkürzung für Gustav, wie ich später erfuhr) hatte mit mir in einem Café beim Naschmarkt eine Weile geflirtet und mich schließlich angequatscht. Nach ein bisschen belanglosem Smalltalk kam er zur Sache und lud mich zu sich ein. Seine Wohnung lag nur zwei Gassen entfernt, befand sich in einem Altbau, mit Betonung auf alt, und roch nach Schmutzwäsche. Doch ich war ausgehungert und stellte meinen Geruchssinn einfach ab.
Was folgte, können wir getrost überspringen. Das Ende nennen wir großzügig »unbefriedigend«. Gus wollte mich danach schnellstens loswerden und schickte mich fort, als wäre ich ein Installateur, der das verstopfte Klo nicht hatte reinigen können. Ich war noch nicht einmal an der Tür, da hörte ich ihn schon telefonieren.
»Das war der zweitmieseste Sex meines Lebens«, erzählt er wem auch immer und lachte. Entweder dachte er, ich hätte die Wohnung schon verlassen. Oder es war ihm egal.
Für mich war es wahrscheinlich nur der fünftmieseste Sex, ich kannte wirklich Schlimmeres. Trotzdem, oder gerade deshalb, sank mein Selbstbewusstsein von null auf minus drei.
Meine Mutter legte ihre Hand auf meine und holte mich aus grauen Erinnerungen an den trostlosen Esstisch zurück. Zu meinem Vater sagte sie: »Im Gegensatz zu dir finde ich es ganz normal, wie Julian ist. Ich will ihn glücklich sehen.« Sie wandte sich mir zu. »Und an deinem 22. Geburtstag musst du endlich mit jemandem kommen.«
»Sein Geburtstag ist doch schon in ein paar Wochen«, gab mein Vater zu bedenken. Ich war überrascht, dass er sich an das Datum überhaupt erinnern konnte. An seinen Hochzeitstag musste ihn eine Assistentin in seiner Firma erinnern.
»Na und?«, erwiderte meine Mutter.
»Ich will nicht, dass er irgendjemanden hierher mitbringt, den er gerade erst aufgegabelt hat.«
Ich wollte das auch nicht. Also jemanden nach Hause mitbringen. Selbst ein Mann mit Nerven aus Stahl, der mich für die große Liebe seines Lebens hielt, würde nach spätestens einer Stunde mit meiner Familie die Flucht ergreifen.
Meine Mutter tätschelte mir auf eine drängende Art die Hand. »Ich habe sowieso das Gefühl, es gibt da jemanden, den Julian mir verheimlicht.«
Mein Vater nahm das Küchenmesser, mit dem der Braten geschnitten wurde, und kratzte die oberste Schicht ab, die von meinen zerkauten Knödelresten kontaminiert worden war.
»Julian, wir lieben dich, so wie du bist«, versicherte mir meine Mutter.
Aus der Richtung meines Vaters kam ein unverständliches Knurren, das nicht gerade nach Zustimmung klang.
2
Der Sonntag hatte seinen festen Ablauf, der auch in dieser Woche eingehalten wurde. Mein Vater legte sich nach dem Essen mit der Zeitung auf das Sofa und hielt seinen Mittagsschlaf. Ich trug die Teller in die Küche und schlichtete sie in den Geschirrspüler. Meine Mutter deckte den Tisch für die nachmittägliche Jause.
Um halb vier Uhr traf meine große Schwester Amelie samt Ehemann und meiner Nichte Nathalie ein. Amelie war wie üblich gestresst und ständig auf der Jagd nach Nathalie, die, seit sie gehen gelernt hatte, wie ein Tornado durch jedes Zimmer fegte und alles herunterriss, was sie zu greifen bekam. Mein Schwager Gert sprang erst ein, wenn Amelie unübersehbare Zeichen von Erschöpfung zeigte. Mein Versuch, mit Nathalie zu spielen, endete mit einem Biss in meine Nase. Daher ließ ich es bleiben.
Um vier Uhr erschien mein großer Bruder Henrik, wie immer mit einem Karton voll Kuchen- und Tortenstücken, die alle klebrig und viel zu süß waren. Mein Vater schlug ihm zur Begrüßung auf den Rücken und erkundigte sich nach Zahlen oder anderem Kram aus unserem Unternehmen, in dem Henrik für die Finanzen zuständig war.
Henrik hatte aus seiner Geringschätzung für mich nie ein Hehl gemacht. Für meinen Vater war er wohl eine Art »Sprachrohr« der eigenen Gefühle und Gedanken und wurde daher von ihm nie in die Schranken gewiesen. Meine Mutter beließ es bei lahmen Ermahnungen wie: »Brüder sollten sich vertragen.«
»Ist es heute wieder gemütlich«, sagte Mama mehrere Male. Es war lautes Wunschdenken. Keiner von uns saß freiwillig und aus Freude am Tisch, weshalb auch kein richtiges Gespräch aufkam.
Als ich mich von meinem Sessel erhob, um den Zug nach Wien zu erreichen, schlug meine Mutter mit dem Löffel an ihre Kaffeetasse.
»Alle herhören! Julians Geburtstag fällt auf einen Samstag, und wir werden ein Fest im Clubhaus für ihn geben. Schließlich wird man nur einmal 22. Und außerdem …«, sie machte eine ausholende Geste, »... wird er uns jemanden vorstellen.«
»Bist du endlich zur Vernunft gekommen?«, fragte Henrik. »Wie heißt sie?«
»Wer ist er?«, wollte Amelie wissen.
Ich öffnete den Mund, um in aller Höflichkeit zu erklären, dass ich die Wunschfantasien meiner Mutter nicht erfüllen konnte, als ich mich sagen hörte: »Mama hat recht. Es ist Zeit, dass ihr ihn kennenlernt.«
Mein Vater gab das übliche Stöhnen von sich.
Amelie schoss ein Feuerwerk an Fragen auf mich ab.
Henrik steckte sich hinter dem Rücken unserer Eltern den Finger in den Mund und tat, als müsse er kotzen.
Meine Mutter umarmte mich, was sie schon lange nicht getan hatte. »Ich bin so stolz auf dich! Dein erster Freund!«
Weder war es mein erster Freund, noch gab es überhaupt einen Freund. Ich hatte das nur gesagt, weil ich Mamas mitleidigen, verständnisvollen Ton genauso satthatte wie die Verachtung meines Vaters oder die dummen Sprüche von Henrik.
»Das ist ein richtiges Comingout, Julian!« Meine Mutter hatte die Bedeutung dieses Wortes noch nie verstanden und ich hatte keine Lust, es ihr heute zu erklären. Außerdem waren Comingout und Outing für mich Wörter, die schreckliche Erinnerungen weckten. Ich habe mich bei meinen Eltern nämlich nie geoutet. Auch nicht bei meinen Geschwistern. Ich wurde geoutet. Von einer Mülltonne.
Einen Tag vor meinem siebzehnten Geburtstag, auf dem Parkplatz neben dem Golf-Clubhaus. Es war ein traumatisches Erlebnis gewesen, das ich seit Jahren vergeblich zu vergessen versuchte.
Den Rest der Jause verbrachte ich schweigend. Den ganzen Weg zurück nach Wien starrte ich aus dem Zugfenster und dachte über ungewollte Comingout vor fünf Jahren nach, das mein Leben nachhaltig verändert hatte. In den Tagen und Wochen danach hatte mir meine Familie das Gefühl gegeben, ein verwirrter, hoffnungsloser Perverser zu sein, der sich am besten als Einsiedler ins Gebirge zurückziehen sollte.
Meine Eltern gingen mit mir um wie mit einem pubertären Pickel. Mein Vater hätte mir mein Queer-Sein am liebsten ausgequetscht. Meine Mutter fragte sich selbstanklagend, was sie bei meiner Erziehung falsch gemacht hatte. Es folgte der Versuch, den Makel auszutrocknen. Sie bombardierte mich mit Artikeln und Berichten über die »Phase«, die manche Teenager angeblich durchwanderten, und über Angst vor der Rolle als Mann in der heutigen Gesellschaft. Als Draufgabe listete sie alle Schreckensmeldungen auf, die Google zu den Stichworten »homosexuell« und »Krankheit« lieferte.
Als das alles nichts half, ging sie zu »abdecken« über, indem sie mir ständig Töchter ihrer Freundinnen aus den diversen Wohltätigkeitsvereinen vorstellte, sie zum Essen einlud und mich bedrängte, mit ihnen auszugehen.
Als ich der Schule endlich den Rücken kehrte, hatte ich ein »Reifezeugnis« in der Tasche, fühlte ich mich aber alles andere als »reif« für das Leben. Da ich Betriebswirtschaft studieren sollte, um später in das Familienunternehmen einzusteigen, stimmten meine Eltern der Übersiedelung nach Wien zu. Ich zog zu Antonia, meiner besten Freundin, die damals gerade erst ein Haus von ihrer Patentante geerbt hatte. Kurzerhand gründeten wir eine WG. Unser Motto: »Wir werden allen zeigen, wie armselig unsere Familien mit ihrem spießigen Leben auf dem Land sind.«
Antonia hatte Erfolg. Ich aber musste mir eingestehen, dass ich immer mutloser und antriebsloser wurde, ob im Studium oder in meinem Liebesleben.
Nun hatte ich Idiot einen Freund für meinen Geburtstag angekündigt, den es gar nicht gab. Kam ich allein zum Fest im Golfclub, so würde das mein Image als Loser nur verstärken. Der einzige Ausweg, der mir in diesem Fall blieb, war, als Tellerwäscher auf einem Kreuzfahrtschiff anzuheuern oder ins Kloster zu gehen. Mit diesen trübseligen Gedanken öffnete ich die Eingangstür unserer WG.
Mich erwarteten nackte Tatsachen.
3
In unserem Vorzimmer stand ein unbekleideter Mann. Er kehrte mir den Rücken zu. Als er mich eintreten hörte, warf er mir über die Schulter einen wütenden Blick zu, als hätte ich hier nichts zu suchen.
»Was?«, fuhr er mich an. Ich hatte meine Augen nicht schnell genug von seinem wohlgeformten Hinterteil abgewandt. Bevor ich etwas sagen konnte, war er im Badezimmer verschwunden, knallte die Tür hinter sich zu und sperrte energisch ab. Von oben kam Antonia die Treppe herunter. Sie trug das alte weiße Hemd mit Farbflecken, das sie immer zum Malen anzog.
Ich deutete mit dem Kopf Richtung Bad. »Wer ist das?«
»Erik. Er hat heute Reginas Zimmer bezogen.«
Regina war angehende Tierärztin, die nach Fertigstellung ihrer Diplomarbeit am Freitag tränenreich Abschied gefeiert hatte, um zurück nach Kärnten zu gehen.
»Du hast mir gar nicht gesagt, dass ein Neuer einzieht«, beschwerte ich mich.
Ein klein wenig war ich gekränkt, weil Antonia und ich normalerweise alle möglichen Kandidaten und Kandidatinnen gemeinsam interviewten und danach zusammen die Auswahl trafen.
»Er ist heute Mittag vor der Tür gestanden und hat angeboten, zwei Monatsmieten in bar und im Voraus zu bezahlen, wenn er auf der Stelle bleiben kann.«
Da die Rechnung nach dem Service der Heizung viel höher als erwartet ausgefallen war, kam eine solche Vorauszahlung gelegen. Aber trotzdem. Ich schmollte.
Antonia ging an mir vorbei ins Wohnzimmer, wo ihre neuen Werke zum Trocknen aufgelegt waren. Sie malte keine Bilder, sondern Schilder und Sprüche. Ihre derzeitigen Bestseller waren:
ES GIBT KEIN PROBLEM, DAS MAN NICHT DURCH REDEN, PIZZA, SEX, ERPRESSUNG ODER PER AUFTRAGSKILLER LÖSEN KÖNNTE.
EIN MANN TUT, WAS ER TUN MUSS. EINE FRAU TUT, WAS EIN MANN HÄTTE TUN MÜSSEN.
BASTLE AUS DEN SCHERBEN GEPLATZTER TRÄUME EINE DISCOKUGEL UND TANZE.
Während sie den Zustand der verschiedenen Tafeln prüfte, erzählte sie, was sie über den Neuen wusste.
»Er kommt aus Frankreich und spricht großartig Deutsch. Allerdings redet er wenig, du musst ihm jedes Wort aus der Nase ziehen. Wieso und seit wann er in Wien ist, hat er nicht gesagt. Er wirkt ein bisschen Macho.«
»Den haben wir noch gebraucht«, entfuhr es mir. »Iv wird ihn fertigmachen.«
Iv bewohnte das kleinste und billigste Zimmer im ersten Stock. Beschreiben kann ich sie so: Iv (kurz für Yvonne) absolvierte die Ausbildung zur holistischen Mentaltrainerin und Heilpraktikerin und verdiente sich derzeit ihr Geld am Bau und während des Wochenendes als Türsteherin und Rausschmeißerin in einem Club. Letztere Beschäftigung gab ein Gefühl für ihre Kraft und äußere Erscheinung. Ihre Vorträge über »toxische und andere unnötige Männer« waren legendär.
Antonia beruhigte mich. »Sie ist mit drei Mieten im Rückstand, sie wird sich einbremsen und ihm Schonfrist geben.«
Kunstvoll malte Antonia ein großes F für den Spruch:
FRAUEN GEHEN NIE WÜTEND INS BETT. SIE BLEIBEN WACH UND PLANEN IHRE RACHE.
Durch die Wand hörte ich das Rauschen der Dusche. Ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, wie das Wasser an Eriks Körper herabrann. Antonia schnippte vor meinem Gesicht. »Hast du Sex-Kino im Kopf?«
Ich grinste verlegen. Sie kannte mich gut.
»Wie war’s bei deiner Family?«, erkundigte sie sich.
Bevor ich erzählte, rechnete ich kurz nach. »Bis zu meinem Geburtstag sind genau 54 Tage Zeit, es zu schaffen.«
Antonia pustete auf die Farbe, damit sie schneller trocknete. »Was zu schaffen?«
Ich gab einen Kurzbericht über die Ereignisse des Sonntags, inklusive der Schlussfolgerung, dass ich ohne »Boyfriend« nach dem Geburtstagsfest nur auf einem Schiff anheuern oder ins Kloster gehen könne.
Die Reaktion meiner besten Freundin war alles andere als beruhigend. »Wir sollten vielleicht schon eine Liste der Klöster aufstellen, die für dich infrage kommen.«
»Danke, du bist eine große Hilfe«, erwiderte ich trocken.
»Komm, das schreit nach Mint-Eis. Ich habe gestern Nachschub besorgt.«
Mint-Eis mit Schokostückchen war unsere Lieblingseissorte, die wir in Liter-Bechern aus dem Eissalon nach Hause brachten. Mit zwei Löffeln bewaffnet, setzten wir uns auf die Terrasse und aßen direkt aus dem Becher.
»Ich will und werde ihnen nicht die Genugtuung geben, allein zu kommen«, verkündete ich. Es klang nicht einmal für mich selbst überzeugend.
Antonia leckte Eis vom Löffel und überlegte. »Du könntest heiraten und ihnen deine Frau vorstellen. Du nennst sie Harald, sie dich Sybille, ihr spielt verliebt und erzählt von den Vorzügen eurer offenen Beziehung. Auf Wunsch kannst du die Sache auch polyamorös anlegen, ich stehe gern mit Rat, aber vielleicht nicht so sehr mit Tat zur Verfügung.«
Mir war nicht zum Lachen.
»Denk die Sache weiter«, fuhr Antonia mit großer Ernsthaftigkeit fort. »Wenn du dieses Theater gut anstellst und konsequent vorantreibst, könnte es bei einigen Mitgliedern deiner Familie zum Wahnsinn führen. Oder sie fürchten weitere Enthüllungen im Familienkreis und in der Nachbarschaft so sehr, dass sie dir dein Erbe vorzeitig auszahlen, damit du das Land verlässt und dich nie wieder zeigst.«
Antonia war es gelungen, mich kurz zum Grinsen zu bringen. Eigentlich wollte ich entgegnen, dass auch sie und ich heiraten könnten, aber sie sah über meine Schulter hinweg auf etwas hinter mir.
Ich drehte mich um und da stand Erik.
Bekleidet. Leider. Petrolgrünes T-Shirt und schwarze Jeans.
»Eis?«, fragte Antonia und machte eine einladende Geste zu dem halb leeren Becher.
Er schüttelte den Kopf. »Zu viel Zucker.«
»Soda Zitron zur Begrüßung? Oder Bier? Wein?«
Erik schüttelte nur den Kopf.
»Das ist übrigens Julian«, stellte Antonia mich vor. »Bester Freund und Mitbegründer dieser WG. Sein Zimmer ist unter dem Dach. Ihr teilt euch das Bad.«
Ein kurzes Nicken war alles, was Erik für mich übrighatte. Was für ein arroganter Widerling. Sein Dreitagebart wirkte frisch gestutzt, die mittellangen Haare waren noch feucht und schwungvoll nach hinten frisiert. Das kantige Kinn und die dichten Augenbrauen verliehen ihm etwas Energisches. Mich störte vieles an ihm, besonders die Glätte und Kälte, die er ausstrahlte.
»Ich dusche auch in der Nacht«, sagte Erik unvermittelt.
»Warmes Wasser gibt es bis 22 Uhr und wieder ab 5 Uhr. Energiesparen«, erklärte Antonia.
»Mir egal. Ich dusche auch kalt. Aber es kann spät sein. Will es nur sagen.«
»Danke für die Vorwarnung. Wenn du nicht laut singst oder Musik hörst, sollte es kein Problem werden.«
Erik wandte sich mir zu. Sein Blick hatte etwas Stechendes. »Gehört dir das ganze Kosmetikzeug?«
Seit der Pickelphase meiner Teenagerzeit war ich Experte für Hautpflege. Ich hatte Waschlotionen, Pflegelotionen, Tages- und Nachtcremes, eine Reinigungsmaske und ein wöchentliches Peeling.
Ich gab mein Bestes, überlegen zu klingen. »Ja. Und es steht nicht zum allgemeinen Gebrauch zur Verfügung.«
»Pédé«, murmelte er, drehte sich um und ging.
Sofort nahm ich mein Handy und googelte nach einer Übersetzung.
Antonia seufzte. »Er meint das sicher nicht so.« Sie sprach Französisch und kannte das Wort.
Die Übersetzung lautete: Schwuchtel oder »warmer Bruder«. Ich tippte und rief Erik »Dégueuler« hinterher.
Das Gartentor fiel scheppernd ins Schloss. Er war schon auf der Straße und hatte mich wohl nicht mehr gehört.
»Dégueuler?«, fragte Antonia.
Ich hatte es auch gerade erst vom Übersetzungsprogramm erfahren.
»Dégueuler heißt Kotzbrocken auf Französisch.«
4
Ich traute mich zu wetten, dass Dégueuler das Badezimmer verwüstet hatte und mir das Putzen überließ. Bestimmt war der Boden überschwemmt, Haare steckten im Abfluss und klebten im Waschbecken und, das Ekeligste, seine Spuren fanden sich in oder auf der Klomuschel. Ich würde Beweisfotos aufnehmen und ihm unter die arrogante Nase halten.
Erfüllt vom Zorn der Vorahnung riss ich die Badezimmertür auf. Antonia kam mir nach. »Und? Wie sieht’s aus?«
Wir inspizierten Waschbecken, Dusche, Toilette und Boden. Regina war putzwütig gewesen, daher war ich Sauberkeit gewohnt. Was ich aber nun sah, übertraf ihre Glanzleistung bei Weitem. Das Bad war nicht nur sauber, sondern wirkte wie frisch renoviert. Meine Tuben und Tiegel standen nicht mehr in meinem kreativen Durcheinander auf der Ablage, sondern in Reih und Glied und nach Größe geordnet.
An Erik selbst erinnerte nur der angenehme Geruch seines Shampoos oder Duschgels, der noch in der Luft hing. Weder Waschbeutel noch Zahnbürste, Shampoo oder Haargel lagen herum.
»Bemerkenswerter Typ«, raunte Antonia und kehrte zu ihren Schildern zurück. Sie hatte damit auf Instagram ein kleines, aber einträgliches Business begonnen und musste am Montag einige verschicken.
Nachdem ich die Sauberkeitsoase verlassen hatte, die früher Bad genannt worden war, stand ich unschlüssig in der Mitte des Vorzimmers. Meine Augen wanderten zur Tür von Eriks Zimmer. Auch wenn es sonst nicht meine Art war, wollte ich unbedingt einen Blick hineinwerfen, um mir etwas mehr Eindruck zu verschaffen, mit wem wir es hier zu tun hatten.
In den vier Jahren, die wir schon im Haus wohnten, hatte ich noch nie ohne Erlaubnis das Zimmer anderer Mitbewohner betreten. Bevor mich nun Moral oder Skrupel abhielten, packte ich die Schnalle und drückte sie schnell hinunter.
Abgesperrt.
Meine Neugier wucherte wie die Dornenhecke um Dornröschens Schloss. Da das Zimmer zwei Fenster in den Garten hinaus hatte, beschloss ich, von dort einen Blick in sein Inneres zu erhaschen.
Hatte Erik schon ausgepackt? Was hatte er mitgebracht, um das Zimmer seinen persönlichen Anstrich zu geben? In der Grundausstattung verfügte es über ein breites Bett, einen Schreibtisch, einen Sitzsack, einen Kasten, eine Ladenkommode und ein paar der Bilder an der Wand, die Antonia gemalt hatte. So viel wusste ich, ohne hineinsehen zu können. Welche Note er wohl dem Zimmer verliehen hatte?
Die Vorhänge des ersten Fensters waren zugezogen. Als ich ans zweite Fenster trat, stoppte mich ein energisches: »He!«
Ich drehte mich ertappt um. Zum zweiten Mal an diesem Tag flehte ich den Boden an, mich zu verschlucken, und zum zweiten Mal blieb er hart.
Erik war zurück. Er stand auf der Straße am Zaun und starrte von dort in meine Richtung.
Ich machte zwei verlegene Schritte rückwärts auf das Hochbeet zu, in dem ich Gemüse anpflanzte.
»Gurken und Melanzani«, hörte ich mich sagen.
»Wie?«
Natürlich hatte ich meine Pflanzung gemeint, aber im nächsten Moment fielen mir die eindeutig zweideutigen Emojis ein. Wie peinlich!
Erik trat durch das Gartentor und kam zu mir. Mir fielen seine breiten Schultern auf. Er wirkte trainiert, ohne übertriebene Muskelberge mit sich zu schleppen.
Ich grinste ihn verlegen an. Seine Miene blieb versteinert. Mit einer hilflosen Geste auf den Kasten des Beets zeigend, laberte ich: »Nicht nur Karotten und Melanzani, auch Zucchini und Tomaten. Alles nicht gespritzt.«
Erik bekam eine dünne Falte zwischen den Augenbrauen. »Gespritzt?«
»Pfft, pfft, pfft!«, machte ich und stellte pantomimisch eine Sprühflasche dar.
Die Falte über seiner Nasenwurzel wuchs weiter.
»Bio«, ergänzte ich. Weil er nicht sofort reagierte, versuchte ich mich erneut als Pantomime, um eine Kuh darzustellen, die einen Kuhfladen fallen ließ. Zur Abrundung der Darstellung machte ich »Muh!« und vollzog mit den Fingern über dem Beet eine Bewegung, als würde ich Streusel auf Streuselkuchen streuen.
Erik sah mich an, als hätte ich soeben gestanden, meine eigenen Fäkalien als Dünger zu verwenden. Er schüttelte den Kopf und murmelte etwas auf Französisch.
»He, wenn du mich schon beschimpfst, dann auf Deutsch«, fuhr ich ihn an.
»Ich sagte ›stupide‹«, erwiderte er ungerührt.
Er sprach es stupidddeeee aus. Die Ähnlichkeit mit stupid auf Englisch machte mir klar, was er meinte.
»Danke, du mich auch«, gab ich zurück.
»Was?«
»Darfst raten!«
Er behielt mich im Auge, als wäre ich ein Raubtier, das ihn anspringen könnte. Abwartend standen wir uns gegenüber und funkelten einander an.
»Was stimmt mit dir nicht?«, fragte er in fast akzentfreiem Deutsch.
Diese Frage brachte mich aus der Fassung. »Mit mir? Alles. Und damit du es weißt: Ich habe ältere Rechte auf das Bad. Alles bleibt so, wie es war.«
Vor mir tauchte ein imaginärer zweiter Julian auf, der über mich den Kopf schüttelte, die Hände vors Gesicht schlug und sich für mich schämte. Was für eine verblödete Ansage hatte ich da gerade vom Stapel gelassen?
Es piepte in Eriks Hosentasche. Er nestelte sein Handy aus der engen Jeans, warf einen Blick darauf, schimpfte lautlos vor sich hin und lief ins Haus. Ich wagte aus der Entfernung einen Blick in Richtung des zweiten Fensters seines Zimmers, dessen Vorhang er energisch zuzog.
Als er das Haus kurz darauf wieder verließ, hatte er einen schwarzen Rucksack geschultert. Ohne Verabschiedung eilte er davon. Ich wollte ihn unausstehlich finden, doch es gelang mir nicht so recht. Ich hatte mich mindestens genauso daneben benommen wie er. Nachdem ich das Gedeihen des Gemüses kontrolliert und für zufriedenstellend bepfunden hatte, ging ich nach oben in mein Zimmer.
»He, Frosch«, rief Antonia aus dem Wohnzimmer. »Schon Pläne, wie du deinen Märchenprinzen findest?«
Ich kehrte auf der Treppe um und ging zu ihr.
»Vorschläge?«
Antonia kämpfte mit breitem Klebeband und Packpapier auf dem Sofa. Das Einwickeln einer Sonne, deren Strahlen aus Pappmaché sich ständig durch das Papier bohrten, war keine einfache Sache.
»Apps?«
Ich half ihr beim Umwickeln jedes Sonnenstrahls.
»Apps? Nicht dein Ernst.«
Antonia riss mit ihren Zähnen ein Stück Klebeband ab.
»Mein voller Ernst. Check deine Nachrichten. Vielleicht hat sich dein Traummann bereits gemeldet, du hast es nur nicht gesehen.«
Aus Erfahrung wusste ich, dass Antonia auf diesem Thema herumreiten würde, deshalb murmelte ich was von Kopfschmerzen und stieg die knarzende Holztreppe in den zweiten Stock hinauf.
Mein Zimmer war der ausgebaute Dachboden, größer als alle anderen, hatte schiefe Wände und zwei weitere Besonderheiten: einen winzigen Balkon und eine Leiter zum Dachgiebel.
Ich schlüpfte in eine Sweatjacke, nahm mein Handy und kletterte auf das Dach. Von dort hatte ich einen prachtvollen Ausblick bis zur Hügelkette am Stadtrand. Ich saß im goldgelben Sonnenuntergang, ratlos, wie ich jemanden finden könnte, der schwindelfrei war und hier neben mir sitzen wollte.
5
Nach mehreren Pleiten und Pannen war ich zu dem Schluss gekommen, einfach nicht »datebar« zu sein.
Zu unattraktiv, zu uninteressant, zu wenig sexy. Auf dem Dach sitzend fielen sämtliche meiner Komplexe über mich her wie kleine Geier und begannen alles, was von meinem Selbstbewusstsein übrig war, zu zerfetzen.
»Die Rettung heißt Negroni.«
Antonia war mir mit zwei Gläsern und einer kleinen Flasche nachgekommen. Wir beide mochten Negroni, mixten ihn gern und lagerten ihn für besondere Anlässe in einem kleinen Eichenfass in der Küche. Am dunkelroten Inhalt der Flasche war zu erkennen, dass Antonia großzügig gezapft hatte.
»Bei der letzten Negroni-Therapie wären wir fast vom Dach gefallen«, erinnerte ich sie.
»Klappe zu und trink«, sagte Antonia. »Und jetzt Handy her. Frau Doktor kümmert sich um den Rest.«
Bevor ich es wegstecken konnte, hatte sie mir das Handy schon aus den Fingern gezogen. Sie kannte meinen Code und entsperrte es. Prüfend swipte sie herum.
»Hast du alle Datingapps gelöscht?«
Mein Schweigen war Antwort genug. Sofort begann Antonia, App für App wieder zu installieren. Sie öffnete Grindr und loggte sich in mein Profil ein. Da sie es selbst angelegt hatte, kannte sie mein Passwort.
Prüfend überflog sie die Eintragungen.
»Die sind nicht von mir«, stellte sie fest.
»Es geht auch nicht um dich. Ich habe sie verbessert.«
Sie las laut vor: »›Hobbys: Netflix, Playstation 5, Gärtnern, Ausgehen und Schwimmen.‹ Du klingst wie ein Fünfzehnjähriger. ›Meine Wünsche: Beziehung, keine Sexdates oder One-Night-Stands.‹ Damit bist du bereits für achtzig Prozent aller Kandidaten uninteressant. ›Mein Traumtyp: So alt wie ich, gutaussehend, Haarfarbe egal, sportlich und liebevoll‹. Das klingt, als wolltest du deinen Teddybären daten.«
»Hör auf, mich zu verarschen.« Ich entriss ihr das Handy, das mir entglitt, das Dach hinunterrutschte und in der Dachrinne landete. »Vielleicht ohnehin besser«, knurrte ich.
Wir saßen schweigend da und sahen das letzte Stückchen der Sonne hinter den Hügeln verschwinden.
»Jul!«
Sie sprach es »Tschul« aus und begann damit immer ernste, intime Gespräche.
»Nein«, sagte ich abwehrend.
»Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will.«
Doch, das wusste ich. Ich sollte ihr etwas erzählen, an das ich nicht einmal denken wollte. Stumm schüttelte ich den Kopf und hoffte, sie würde die Fragerei bleiben lassen.
Antonia schenkte uns ein, wir stießen an und nahmen einen großen Schluck. Das angenehme Brennen breitete sich in meinem Hals aus. Weil Antonia offenbar im Sternzeichen des »Hartnäckigen Fragezeichens« geboren war, gab sie nicht auf. Seit Jahren schon kam sie immer wieder auf das gleiche Thema zurück.
»Du willst jemanden finden, aber du willst nicht daten«, sagte Antonia. »Liegt es immer noch an dem, was damals passiert ist? Was ist beim Clubhaus geschehen?«
»Nichts.« Mein starrer Blick geradeaus sollte sie endlich zum Schweigen bringen.
»Du hast danach die halben Ferien nicht mit mir gesprochen. Es muss also etwas mehr als ›nichts‹ gewesen sein.«
Nein, Antonia würde mich auch diesmal nicht dazu bringen, über etwas zu reden, das mir Höllenqualen bereitete. Ausnahmsweise nahm ich mir ein Beispiel an meiner Mutter und saß mit zusammengekniffenen, dünnen Lippen da und schwieg.
Antonia atmete tief durch. »Hör zu, du musst irgendwann darüber sprechen. Wieso willst du nicht mit meiner Therapeutin reden?«
Antonias Therapeutin hatte ihr geholfen, herauszufinden, wieso sie jede aufkeimende Beziehung durch Klammerattacken erstickte.
Es hing mit ihrer Mutter zusammen, die sie in allen entscheidenden Momenten im Stich gelassen hatte. Trotzdem würde ich diese Therapeutin nicht aufsuchen, um bei ihr mein weniges Geld abzulegen und dann in der Praxis entweder kein Wort rauszubekommen oder zu heulen.
Endlich gab Antonia auf. Für ein paar Minuten wenigstens. In der Schule hatte sie eine Klassenkameradin einmal »Miss Fix-it« genannt, da sie hartnäckig alle Tricks anwendete, um eine Sache in Ordnung zu bringen.
Ihr nächster Vorschlag ließ bei mir sofort alle Abwehrmechanismen hochgehen. Er betraf die Organisation A-LOVE, die für sie hilfreich gewesen war.
»Es gibt die Untergruppe A-HO. Versuch die doch.«
Antonia meinte eine Online-Plattform, die von einer Psychologiestudentin gegründet worden war. A stand für anonym. Ob online oder live, niemand musste seinen Namen verraten oder sein Gesicht zeigen. Online ließ man die Kamera ausgeschaltet, bei Live-Events trafen sich alle an einem obskuren Ort und trugen Masken. Bei allen Sitzungen konnte man reden oder nur zuhören.
A-PO war die Gruppe von Menschen, die eine polyamouröse Beziehung lebten oder leben wollten. Antonia hatte länger mit dieser Art von Beziehung geliebäugelt und behauptete, durch A-PO wichtige Unterstützung erhalten zu haben.
»Wofür steht A-HO?«, wollte ich wissen, weil ich nun doch ein wenig neugierig war.
Antonia zögerte. »Es ist schlecht gewählt«, sagte sie langsam. »Gemeint sind die Anonymen Hoffnungslosen, aber …«
Ich machte eine wütende Handbewegung und verschüttete die Hälfte meines Negronis. »Ach, so siehst du mich also!«
»Beruhig dich, Jul. Ich sagte, die Abkürzung ist schlecht. Es geht um ›vermeintlich Hoffnungslose‹, die es in Wirklichkeit nicht sind.«
Das klang etwas besser, überzeugte mich aber trotzdem nicht.
»A-LOVE ist nicht teuer und es gibt viele Erfolgsgeschichten«, versuchte es Antonia weiter. »Schau dir die Google-Bewertungen an.«
»Kannst du beides fälschen oder kaufen.«
»Du bist heute nur negativ«, seufzte Antonia. »Es gibt eben viele, die sich über ihre Dating- und Sexprobleme heilsam auskotzen wollen. Genauso viel wird aber über gute Erfahrungen gesprochen, von denen du lernen kannst.«
Bestimmt war es besser, wenn sich Leute ihrer Probleme bewusst waren und sie nicht auf ihre Dating-Opfer abluden oder sie darunter begruben. Trotzdem hatte ich keine Lust, mich vor verkrachten Männern lächerlich zu machen, die mich ohnehin alle nur deprimierten.
»Einer aus meinem Kurs hat dort seinen Freund kennengelernt«, ließ Antonia beiläufig fallen.
»Und ich falle auf diesen plumpen Trick, mich zu überzeugen, nicht rein«, gab ich zurück. »Und jetzt hilf mir, mein Handy zu bergen.«
Ich war ein Mann von klaren, festen Entschlüssen. Ein Nein war für mich …
… nach ein paar Minuten ein Vielleicht ...
… und nach einer weiteren Stunde, in der ich wach im Bett lag, ein »Probieren wir es einmal.«
Ich zog den Laptop vom Nachtkästchen und googelte die Webpage von A-LOVE. Das Treffen der A-HO war für Montag, 21 Uhr geplant.
Ich meldete mich an und bezahlte elf Euro per Kreditkarte. Danach hielt mich die Frage wach, wie ich anderen mein Trauma schildern sollte. Es war der Grund für mein nicht vorhandenes Datingleben, davon war ich überzeugt. Weil ich nicht schlafen konnte, ging ich die Geschichte einmal mehr in meinem Kopf durch.
6
Aufgewachsen bin ich in einem Kuhdorf, das erst neulich zum Marktfleck erhoben wurde und den Namen Fiensberg trägt (Name vom Autor geändert). Als Teenager war ich der festen Annahme, »the one and only queer« der Umgebung zu sein.
Wir, die Leubichs, lebten hier seit drei Generationen, und nur ich, der Schandfleck der Familie, hatte seit frühester Kindheit verkündet, in Fiensberg solle nicht einmal meine Asche verstreut werden.
Der lebende Rest meiner Familie wird nicht müde, über die schöne Landschaft, die gute Luft und die »lieben Leute« von Fiensberg zu schwärmen. Ich glaube davon kein Wort. Der einzige Grund, warum sie geblieben sind, ist unser Familienunternehmen: Leubich Sanitär. Wir, also der Rest meiner Familie, erzeugen Sanitärporzellan. Meine Großmutter betreibt sogar ein Sanitärporzellan-Museum, das mein Urgroßvater begründet hatte.
Sanitär-Porzellan klingt edel und nobel, gemeint sind damit aber schlicht und einfach Klomuscheln. Es könnten auch Waschbecken oder Bidets sein, aber meine Familie stellt ausschließlich Klomuscheln her. Seit dem Kindergartenalter kenne ich die Unterschiede zwischen Flachspüler (alles bleibt liegen) und Tiefspüler (alles fällt ins Wasser), Hänge-WC und Stand-WC. Der große Trend sind Dusch-WCs mit eingebauter Dusche, die von unten Wasser schießt. Ich war neun, als ich im Schauraum die neuen Modelle so stark einstellte, dass sie zu Springbrunnen wurden und fast bis an die Decke spritzten.
Im Betrieb der Leubichs arbeitet die halbe Einwohnerschaft von Fiensberg, daher gelten die Leubichs als angesehene Menschen. Damit sind meine Großeltern, Eltern und Geschwister gemeint. Ich bin wohl eher der missratene Sohn, über den hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird.
Mein Vater ist Bürgermeister des Ortes und Präsident des Golfclubs. Den 18-Loch-Golfplatz hat mein Großvater erbauen lassen, der auch Ehren-Präsident ist. Am Eingang des Platzes steht ein moderner Holzbau, der als Clubhaus dient. Angeschlossen ist ein kleines Restaurant mit dem treffenden wie einfallslosen Namen »Restaurant am Golfplatz«.
Während andere auf Partys in dunklen Ecken schmusten und sogar noch weiter gingen, saß ich als Teenager abseits und wartete darauf, dass ich Mädchen reizvoll finden würde. Schließlich wollte ich es erzwingen und wählte dazu meine Freundin Antonia, die ich seit Kindergartenzeiten kannte.
Wir hatten einander damals das Leben gerettet: Sie hatte mich mit der Sandschaufel gegen Horror-Henry verteidigt, und ich hatte einen Eimer Wasser über Lili gegossen, die hinterfotzig andere biss und die Schuld auf Antonia schob, die damals die gleiche Zahnlücke hatte wie sie.
Bei der nächsten Party wollte ich nachmachen, was ich bei den Coolen der Klasse beobachtet hatte. Ich lockte Antonia in ein freies Zimmer, wo sie einen Schreikrampf bekam. Das lag weniger daran, dass ich sie an einer Stelle berührt hätte, wo meine Finger (noch) nichts verloren hatten, oder dass ich mich vor ihr entblößt hätte. Der Grund hieß Sisi und war eine Boa constrictor, die sich im bläulichen Licht eines Terrariums räkelte. Sie war das Haustier unseres Gastgebers.
Ich verschob den ersten Kuss auf ein paar Tage später, als Antonia und ich eine Radtour zum Waldsee unternahmen. Als ich mich auf der Bank an sie heranschob und meinen Arm um sie legen wollte, sagte sie gütig: »Und was soll das werden, wenn ich fragen darf?«
Ich wollte ihr sagen, dass ich sie unfassbar anziehend fand und unsere Münder endlich vereinen wollte. So hatte ich das in Filmen gesehen. Mehr als ein Stammeln brachte ich nicht heraus.
»Julian, du bist schwul«, lautete ihre wenig romantische Reaktion.
Darauf brach ich in Tränen aus, denn ich wusste, sie hatte recht. Doch damit hatte sie das schlimmste aller Urteile über mich gesprochen. Ich war das, was viele Jungs im Sportunterricht als Schimpfwort verwendeten. Es war ihr Standardsatz, sich über jemanden lustig zu machen: »Bist schwul?«
Ich wusste es, ohne es mir bisher eingestanden zu haben. Doch ich kannte meine Fantasien. Im Kunstunterricht interessierte ich mich immer nur für Gemälde mit nackten Männern, auch wenn ihre Geschlechtsteile manchmal peinlich klein gemalt waren.
In diesem Moment hatte Antonia mich gebrandmarkt. Ich konnte das Zischen des verkohlenden Fleisches hören und den Gestank riechen.
S.C.H.W.U.L.
Im nächsten Moment umarmte sie mich heftiger, als ich es jemals gewagt hätte, küsste mich schmatzend ins Gesicht und sagte: »Ich bin so froh.«
Wie sie erklärte, war ich für sie der einzig normale Mensch von Fiensberg, in einer Person ihr bester Freund, ihre beste Freundin und der Ersatz für ihre schreckliche Mutter.
Nachdem ich mich langsam an das unaussprechliche Wort gewöhnte, das andere als Schimpfwort verwendeten, meldete sich langsam die Begierde in mir.
Ein wenig kuscheln. Händchen halten. Ein Kuss vielleicht.
»Du brauchst dringend Sex. Das erste Mal ist immer eine große Angelegenheit, dann läuft’s leichter«, lautete Antonias Meinung dazu.
Das klang furchterregend, mit der Betonung auf erregend. Wo aber sollte ich so ein Lustobjekt finden? Wie gesagt, meiner Ansicht nach gab es keinen Zweiten wie mich. Unter keinen Umständen hätte ich eine Annäherung an einen Schulkameraden gemacht, obwohl es den einen oder anderen gab, den ich nicht unattraktiv fand. Wenn ich einen Fehltreffer landete, war mein Ruf für alle Zeiten zerstört. Oder zumindest bis zur Matura.
Antonia weihte mich in die Welt der Datingapps ein, mit denen sie bereits vertraut war. Sie wählte fürs Erste Grindr, eine App, die vor allem für Sex-Dates bekannt war. Gezeigt wurden fast ausschließlich Fotos von Männern des Volkes der kopflosen Schwulen, die Tag und Nacht im Fitnesscenter verbrachten.
»Ich glaube, ich bin mehr der Typ für Beziehung oder so«, gab ich zu bedenken, aber Antonia wischte den Einwand vom Tisch. Sie legte ein Profil für mich an und stellte mir dazu einige Fragen. Die Erste betraf meine »sexuelle Position«.
»Bisher hauptsächlich liegend und unter der Decke.«
Sie bekam einen Lachanfall.
»Julian, ich liebe dich. Aktiv, passiv oder beides?«
»Nächstes«, sagte ich.
Sie bohrte zum Glück nicht weiter. Während sie klickte und tippte, redete Antonia vor sich hin. »Beziehungsstatus ist einfach: Single.«
Danach wollte sie mit meinem Handy Fotos von mir machen. Die Bilder sollten, wie bei den anderen, alle ohne Kopf sein. Ich trug Jogginghosen und Antonia bestand darauf, dass ich einen Daumen im Bund einhakte und den Hosenrand verführerisch ein Stück nach unten zog. Antonias Angebot, auch ein paar Dick-Pics zu machen, lehnte ich ab. Schließlich lud sie die Fotos hoch.
Es fehlte nur noch der Profilname. Ich googelte, um mir Ideen zu holen, und schlug »Cosmic Cuddler« vor.
Antonia rollte die Augen. »Vergiss es, bei dieser App ist Action gefragt. Du brauchst was, das Fun verspricht.«
»Rainbow Rider« kam also auch nicht infrage und »Hot-Jul« fand sie »too low«.
»NeuUndNeugierigPro«, trug sie ein. Klick und das Profil ging ab zur Prüfung.
Eine Stunde später stand es online. Ich sah einen teigig hellhäutigen Oberkörper mit zu dünnen Armen und den ausgeleierten Gummibund meiner Boxershorts, den der runtergezogene Rand meiner Jogginghose freigab. Ich selbst hätte mein Profil nicht angeklickt.
Die App zeigte nicht nur andere Kopflose, sondern auch, in welcher Entfernung sie sich befanden. Der Nächste war neun Kilometer entfernt. Ich war verloren. Ich würde mein Frühlingserwachen in Fiensberg verschlafen.
Weil ich aber einen Funken Hoffnung hegte, verschickte ich jeden Tag Nachrichten an alle möglichen Oberkörper. Der Inhalt strotzte nicht gerade vor Originalität. Er reichte von »Hi!« bis »Was tust du gerade?« oder »Kommst du mal in meine Gegend?«
Die einzige Antwort, die ich erhielt, war Werbung für ein Fitnessstudio. Nach Tagen, die zu Wochen wurden und mich jede Hoffnung auf Zweisamkeit vergessen ließen, geschah das Wunder, auf das ich so sehnsüchtig gewartet hatte. Es hieß Romeo4U6 und besaß ordentlich Sprengkraft.
7
Als ich in meinem Bett unter dem Dach lag und zur Decke starrte, schoss in meinem Kopf eine gedankliche Straßensperre hoch.
Nein, ich würde niemandem darüber erzählen, was weiter geschah. Vom Treffen der A-HO meldete ich mich wieder ab. Mein Geld würden sie mir hoffentlich zurückerstatten.
Antonias Beharren auf die Nützlichkeit von Datingapps konnte ich nicht nachvollziehen. In mir sträubte sich alles, wenn ich an diese Apps nur dachte.
Datingapps und Running Sushi hatten einiges gemeinsam: Das Angebot wurde dir am laufenden Band präsentiert und du konntest nach Gusto und Laune auswählen.
Lebensmitteltests haben ergeben, dass Frische und Qualität beim Running Sushi zu wünschen übrigließen. Bei Datingapps betraf dasselbe Problem die Echtheit von Fotos und die menschlichen Qualitäten der Personen, die darauf zu sehen waren. Die meisten verdienten nicht einmal das Prädikat »Mangelhaft«.
Ich hatte mir vor einigen Jahren in einem Running-Sushi-Restaurant eine Fischvergiftung geholt, die mir nie geahnte Kuschelstunden mit meiner Familie verschaffte. Meine Kuschelobjekte waren allerdings nicht lebende Familienmitglieder, sondern die Produkte von Leubich Sanitär, also die Klomuscheln in unserem Haus.
Kniend hielt ich sie stundenlang umarmt, während ich mir meine Eingeweide rauskotzte.
Mein Handy zeigte 0.58 Uhr, als ich das langgezogene Quietschen des Gartentors hörte. Ich erkannte daran die Rückkehr von Mitbewohner Klaus Blass, der seine Verlobte Jutta in Tübingen besucht hatte. Voller Rücksicht bewegte er das scheppernde Tor nur langsam und drückte es behutsam ins Schloss.
Ich war wohl eingenickt, denn ein lautes Geräusch weckte mich. Es war erneut das Tor, diesmal jedoch so fest zugeschlagen, dass der ganze Zaun zitterte. Ich blickte auf die Uhr.
1.32 Uhr.
Iv kehrte heim. Ihr Dienst am Eingang des Clubs endete um ein Uhr. Danach fuhr sie bei jedem Wetter mit dem Fahrrad aus der Stadt nach Hause. Sie stieß das Tor stets mit dem Fuß auf und zu, da sie die Hände auf der Lenkstange des Rades hatte.
Endlich versank ich in friedlichen Schlaf. Diesmal beendete das Zufallen der Haustür die Erholungsphase.
1.58 Uhr.