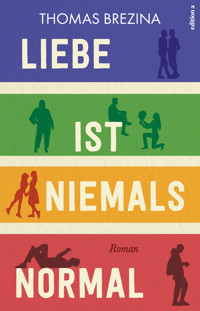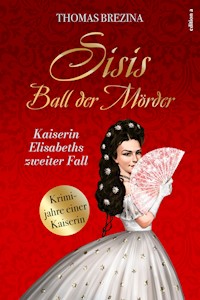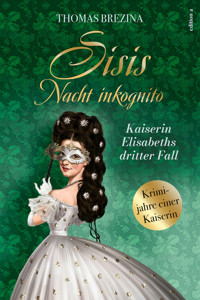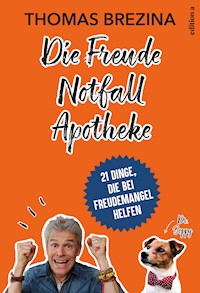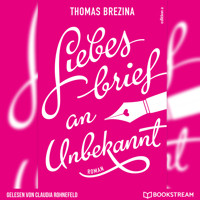Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Gift, das man weder riecht, noch schmeckt, das tötet und den Tod natürlich aussehen lässt. Kaiserin Elisabeth hört zum ersten Mal von ihrer Hofdame, dass es so etwas gibt. »Kannst du glauben, dass Oberland ermordet wurde?«, will sie wissen. »Es scheint keinen Grund zu geben, wieso ein Lehrer und Bibliothekar ermordet wird«, antwortet Ida. »Wäre da nicht das Päckchen, das er Ihrer Majestät geben wollte…« Kaiserin Sisis erster Fall im Wien des Jahres 1866.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Brezina:Sisis schöne Leichen
Alle Rechte vorbehalten
© 2021 edition a, Wienwww.edition-a.at
Lektorat: Maximilian HauptmannCovergestaltung: Bastian WelzerCoverillustration: Bernd ErtlSatz: Lucas Reisigl
Gesetzt in der GaramondGedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 25 24 23 22 21
ISBN 978-3-99001-542-1eISBN 978-3-99001-543-8
THOMAS BREZINA
Sisisschöne Leichen
Kaiserin Elisabeth ermittelt
Inhalt
28. Mai 1866
Kapitel 01
29. Mai 1866
Kapitel 02
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
1. Juni 1866
Kapitel 09
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
2. Juni 1866
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
5. Juni 1866
Kapitel 22
Kapitel 23
6. Juni 1866
Kapitel 24
9. Juni 1866
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
10. Juni 1866
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
11. Juni 1866
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
15. Juni 1866
Kapitel 36
16. Juni 1866
Kapitel 37
Kapitel 38
19. Juni 1866
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
20. Juni 1866
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
21. Juni 1866
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
22. Juni 1866
Kapitel 51
Kapitel 52
23. Juni 1866
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
24. Juni 1866
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
18. August 1866
Kapitel 64
1. September 1866
Kapitel 65
29. Februar 2020
Kapitel 66
Danke
Für diesen Krimi wollte ich die Persönlichkeit von Kaiserin Elisabeth und die Atmosphäre am Kaiserhof kennenlernen und erfühlen. Dabei haben mir Expertinnen und Experten auf vielerlei Art geholfen. Ich bekam Spezialführungen und zahlreiche Unterlagen, wie zum Beispiel Elisabeths Kosmetikrezepte oder das Menü eines kaiserlichen Abendessens. Besonders wichtig waren die interessanten Gespräche mit
Mag. Michaela Lindinger vom Wien Museum
Dr. Elfriede Iby, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung von Schloss Schönbrunn
Michael Wohlfahrt, Kurator Sisi Museum
Sowohl beim Planen des Mordes als auch bei den Überlegungen zur Ermittlung hat mir mein Freund Christian Reiter, Gerichtsmediziner, wertvolle Ideen und Informationen geliefert.
Da er außerdem Hobby-Imker ist, hat er mich auch auf diesem Gebiet beraten.
Verleger Bernhard Salomon, Lektor Maximilian Hauptmann und das Team der edition a haben dafür gesorgt, dass dieses Buch in bester Qualität erscheinen kann.
Es ist eine große Beruhigung zu wissen, dass meine Bücher und Projekte professionell und leidenschaftlich von Walter Fischl gemanagt werden, gemeinsam mit Michael Prügl und Bernhard Trenz. Alle drei sind mehr als berufliche Partner.
Während des Schreibens dieses Buches hatte ich viele Nachdenkphasen. Mein Mann Ivo hat es geduldig ertragen, dass ich auf den langen Spaziergängen mit unserem Hund Joppy kreativ geschwiegen habe. Sein Verständnis und seine Unterstützung sind einfach großartig.
Danke, danke, danke an alle! Ich weiß zu schätzen, von so vielen wunderbaren Menschen umgeben zu sein.
28. Mai 1866
01
»Ida, ich möchte schöne Leichen haben.«
Die Hofdame war an die ausgefallenen Wünsche von Kaiserin Elisabeth gewohnt. Doch dieser ließ sie verzweifeln. Wie sollte ihn Ida erfüllen?
Bekleidet mit einem weißen Morgenmantel aus Seide, Ränder und Saum mit Spitzen besetzt, lag die Kaiserin auf der Chaiselongue in ihrem Gartenappartement im Schloss Schönbrunn. Die Fenster des Raumes waren geschlossen, um Hitze und Licht draußen zu halten. Die hohen Temperaturen waren für die Jahreszeit ungewöhnlich. Vielleicht waren sie der Grund für Elisabeths nicht nachlassende Migräne.
»Bringe mir schöne Leichen«, wiederholte Elisabeth.
Für Ida klang die Kaiserin wie ein krankes Kind, das sich von den Eltern ein Geschenk zur Besserung wünschte.
»Elisabeth, du wirst verstehen…«, begann Ida. Es gab nur wenige Menschen, die Kaiserin Elisabeth mit dem vertrauten Du ansprechen durften. Ida gehörte zu ihnen, zumindest, wenn die beiden alleine waren. »Es ist nicht so einfach, sie zu beschaffen.«
Die Kaiserin seufzte. Obwohl Ida ein Jahr jünger war als Elisabeth, empfand die Hofdame manchmal mütterliche Gefühle für sie. Ganz besonders an einem Tag wie heute, an dem Elisabeth so litt.
Ihre langen, dunkelbraunen Haare waren zu zwei lockeren Zöpfen geflochten. Sie ruhten hinter der Kaiserin leicht erhöht auf Gestellen mit vergoldeten Füßen und Querstangen. So wurde die Kopfhaut entlastet, für die das Gewicht der wadenlangen Haare eine große Strapaze darstellte. Der Hofarzt hatte der Kaiserin diese Therapie bei Migräne und Kopfschmerz verordnet.
»Wirst du heute Abend dem Empfang beiwohnen und der Delegation aus China die Ehre geben?«, fragte Ida, obwohl sie die Antwort im Voraus kannte.
»Bestelle dem Kaiser, dass ich zu krank dafür bin.« Elisabeth schloss die Augen und atmete tief aus.
»Ich werde es auf der Stelle tun.« Ida war bereits aufgestanden, doch die Kaiserin rief sie zurück.
»Warte!«
Ida wandte sich um.
»Du vergisst die schönen Leichen nicht.«
Im Stillen verfluchte Ida die Friseuse Fanny. Sie hatte der Kaiserin vor einigen Tagen beim täglichen Bürsten von den schönen Leichen erzählt. Seither wollte Elisabeth eine ganze Sammlung davon anlegen.
»Ich tue mein Bestes«, versprach sie.
»Beeile dich. Ich will die Schönheit des Todes studieren.«
»Sehr wohl, Elisabeth.« Ida verließ das Zimmer und schloss leise die Türe hinter sich. Als sie zur Wendeltreppe schritt, die nach oben in das kaiserliche Appartement führte, räusperte sich jemand hinter ihr. Ida drehte sich erschrocken um.
Neben der Tür, die in den Garten führte, saß ein Mann, den Hut auf seinen Knien. Niemand außer den Hofdamen und Bediensteten hatte Zutritt zum privaten Appartement der Kaiserin.
Ida öffnete den Mund, um nach der Wache zu rufen. Der flehende Blick des Mannes ließ sie innehalten. Ihre Augen wanderten über seinen schlichten Anzug. Rock und Hosen waren weit und an Ellbogen und Knien etwas ausgebeult. Sein Haupt war bis auf einen dünnen, dunklen Haarkranz kahl. Die blauen Flecken an seinen Fingern sahen nach Tinte aus. Sie kannte ihn. Aber woher?
»Alfred Oberland«, stellte er sich vor. »Hofbibliothekar und Lehrer der Künste für Seine Hoheit, den Kronprinzen.«
Ida erinnerte sich, den Mann in Begleitung von Josef Latour gesehen zu haben, der seit einigen Monaten für die Erziehung des Kronprinzen verantwortlich war.
»Wer hat Sie hereingelassen?«
Oberland hatte eine leicht gebückte, devote Haltung. »Oberst Latour hat mich bei Ihrer Majestät, der Kaiserin, angekündigt.«
»Das muss mir entgangen sein«, entgegnete Ida kühl. Sie wusste über alle Audienzen und andere Verpflichtungen von Elisabeth Bescheid.
»Oberst Latour hatte die Freundlichkeit, der Kaiserin zu bestellen, dass ich ihr etwas übergeben möchte.« Er zog ein flaches Päckchen aus seinem schwarzen Rock. Es war in festes, graues Papier eingeschlagen und mehrfach mit Faden umwickelt. Ein dickes, grünes Siegel prangte über dem Knoten der Verschnürung.
Idas Blick wanderte von dem Päckchen zu den wässrigen Augen des Mannes. Es rührte sie, wie er mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Blick dastand.
»Ich bitte Sie, ich muss zur Kaiserin und das hier in ihre Hände legen.« Oberlands Stimme war ein leises Flehen.
»Das ist am heutigen Tage unmöglich.« Die Hofdame stellte sich vor die Tür des Zimmers, in dem Elisabeth lag, um ihm ohne weitere Worte klarzumachen, dass er gehen sollte.
»Bitte«, wiederholte er leise. »Es ist von großer Dringlichkeit. Glauben Sie mir!«
»Geben Sie mir, was Sie für die Kaiserin haben. Ich werde es an sie weiterleiten.« Ida streckte die Hand nach dem Päckchen aus, aber Oberland zog es zurück.
»Nein, nein, nein, ich muss es ihr persönlich geben und dazu eine sehr vertrauliche Mitteilung machen.«
»Suchen Sie um eine neue Audienz an.« Ida konnte mit ihren 26 Jahren bestimmter auftreten, als ihre mädchenhafte Erscheinung erwarten ließ.
Alfred Oberland hob an, etwas zu sagen, unterließ es dann aber. Er wandte sich um und schritt zum Ausgang. Grüßend nickte er ihr noch einmal zu, bevor er die Türe öffnete und die Stufen hinunterging.
Kurz darauf war er im Park von Schloss Schönbrunn verschwunden.
29. Mai 1866
02
Latour wusste, dass er keine Schuld an dem trug, was die Kaiserkinder an diesem Tag hatten mitansehen müssen. Er konnte doch nicht ahnen, dass der Mann vor Gisela und Rudolfs Augen tot umfallen würde.
Josef Latour war erst seit einigen Monaten von Elisabeth mit der Erziehung des Kronprinzen betraut worden. Er wusste, dass sie seine Besetzung gegen den Widerstand des Kaisers durchgesetzt hatte. Man erzählte sich im Schloss, Elisabeth hätte dem Kaiser ein Ultimatum gestellt: Entweder sie durfte allein darüber entscheiden, wo sie wohnte, wohin sie reiste und von wem der Kronprinz unterrichtet wurde, oder sie würde Kaiser Franz Joseph verlassen.
Der Kaiser hatte nachgegeben. Ob aus Liebe oder Angst vor dem Skandal, konnte Latour nicht einschätzen.
Und nun dieser schreckliche Vorfall. Dabei hatte alles wunderbar begonnen.
Alexander, der junge Naturkundelehrer, hatte vorgeschlagen, mit Rudolf einen Ausflug zu machen. Um ihm das Leben der Bienen näherzubringen, wollte er mit dem Kronprinzen und Latour seinen Vater besuchen, dessen große Leidenschaft die Imkerei war.
Kronprinz Rudolf und seine zwei Jahre ältere Schwester Gisela wurden getrennt unterrichtet. Die Erzherzogin hatte einen weiblichen Hofstaat, der sich um ihre Ausbildung kümmerte. Die Geschwister sahen sich nur noch selten, und das schmerzte sie sehr. Rudolf beklagte sich oft darüber, wie sehr er seine Schwester vermisste. Der Ausflug war auch dafür gedacht, den beiden einen gemeinsamen Tag zu ermöglichen. Kaiserin Elisabeth hatte Latour ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt. Ob sie mit dem Kaiser darüber gesprochen hatte, darauf wollte Latour allerdings nicht wetten.
Den ganzen Hinweg war der kleine Kronprinz so vergnügt gewesen, wie es ein Siebenjähriger nur sein konnte. Er genoss die Kutschenfahrt und redete die ganze Zeit vom Honig, den er so gerne aß. Gisela war neugierig, wie echte Bienenwaben aussahen. In den letzten Monaten hatte Latour öfters solche Momente erlebt. Es waren Momente, in denen er erkannte, dass Rudolf und Gisela gewöhnliche Kinder waren, unbeschwert und unberührt von der komplizierten Welt der Erwachsenen. Dann schmerzte es Latour manchmal, wenn er daran dachte, was diese Welt für die beiden Kinder, vor allem für Rudolf, bereithielt.
Latour und Alexander waren mit den Kaiserkindern zu einem Fuhrwerkerhaus gefahren, nicht unweit des Praters.
»Fuhrwerke gibt es dort schon seit einer Generation nicht mehr«, erzählte Alexander, als sie in die Straße einbogen, in der das Haus lag. »Mein Vater war der erste in der Familie, der ein Universitätsstudium absolvierte. Doch seine große Liebe gilt der Imkerei.«
Alexanders Mutter, eine rundliche Frau mit rosigen Backen, hatte die Gäste empfangen und tief vor den kaiserlichen Hoheiten geknickst. In der Küche warteten auf einem Tisch mit Honigcreme gefüllter Kuchen und Limonade, die mit Honig gesüßt war. Zwei Gläser Honig standen zum Mitnehmen bereit.
Als hätten sie seit Tagen nichts zu essen gehabt, machten sich die Kinder über Kuchen und Limonade her.
Alexanders Vater kam aus dem Garten und begrüßte die hohen Besucher. Er schwitzte und sein kragenloses Hemd klebte an seinem Rücken. Auf Latour machte er einen nervösen Eindruck. Vermutlich hatte seine Aufregung mit den Kaiserkindern zu tun. Seine Frau bot ihm Kuchen und Limonade an, aber ihr Mann lehnte alles ab.
Durch eine niedrige Tür traten sie ins Freie. Der Imker zeigte ihnen eine Holzkiste, die an der Oberseite einen Deckel hatte.
»Die neueste Technik der Imkerei«, erklärte er und zog Holzrahmen heraus. »In diesen Rahmen bauen die Bienen aus Wachs ihre Waben. Sind sie mit Honig gefüllt und verschlossen, kann ich sie herausnehmen. Ich kratze die Wachsdeckel ab und stelle die Rahmen in diese Schleuder. Auch sie ist brandneu. Erst vor einem Jahr wurde sie vorgestellt und ich habe eine der ersten erstehen können.«
Die Schleuder war eine nach oben hin geöffnete Trommel mit einer Kurbelmechanik. Rudolf und Gisela durften beide an der Kurbel drehen und die leere Schleuder in Betrieb sehen.
Höhepunkt der ungewöhnlichen Unterrichtsstunde war der Besuch bei den Bienenstöcken.
»Für den Besuch der kaiserlichen Hoheiten habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht«, verkündete der Imker. »Zum ersten Mal in diesem Jahr werde ich einen vollen Rahmen aus einem Stock entnehmen. Die Hoheiten müssen mir dann helfen, den Honig herauszuschleudern.«
Er führte die Besucher zu einem Strauch, wo ein Tisch und zwei Stühle bereitstanden. Rudolf und Gisela setzten sich und konnten wie im Theater zu den Bienenstöcken sehen, die sich zehn Meter entfernt befanden.
Der Imker hatte ein graues Arbeitsgewand übergestreift, bei dem Ärmel und Hosenbeine an den Gelenken eng verschlossen werden konnten. Danach setzte er sich einen Hut auf, von dessen Krempe ein dünner Schleier auf seine Schultern herabfiel.
Auf dem Tisch wartete ein blauer Henkelkrug mit einer aufgemalten weißen Biene.
»Die ist aber groß«, stellte Gisela fest. »Und so schön gemalt.«
»Ein Imker hat immer kaltes Wasser bereit«, erklärte Alexanders Vater. »Es muss sehr kalt sein, denn falls mich eine Biene sticht, kann ich den Stich sofort damit kühlen.«
Augenzwinkernd fügte er hinzu: »An einem so warmen Tag dient es mir aber vor allem, um den Durst bei der Arbeit zu stillen.« Zum Beweis nahm er einen großen Schluck. Danach schüttelte er den Krug und warf einen Blick hinein.
»Kaum noch etwas drin«, stellte er ein wenig verlegen fest. »Die Vorbereitungen haben mich durstig gemacht… Ich werde ihn später nachfüllen.«
Latour konnte sehen, wie stolz Alexander auf seinen Vater war. Ihm gefiel, wie kundig und spannend er den Kaiserkindern von der Imkerei erzählte.
Die kaiserlichen Hoheiten beobachteten aufgeregt, wie der Imker zu den Kisten ging. Doch auf halbem Weg stockte er. Er fuhr sich mit der Hand zum Hals und wandte sich um. Seine Augen waren aufgerissen, als hätte er etwas Schreckliches gesehen. Nach Luft ringend fiel er zu Boden.
»Vater, Vater!« Alexander lief sofort zu ihm. Alfred Oberland lag seitlich im Gras und kehrte den Kindern den Rücken zu. Als er nicht reagierte, rüttelte Alexander seinen Vater an der Schulter. Da er noch immer kein Lebenszeichen von sich gab, drehte er ihn auf den Rücken, hob den Schleier und öffnete den obersten Knopf des Hemdes. »Ein Arzt, holt den Doktor! Schnell! Schnell!«, rief er.
Schützend hatte sich Latour vor die Kinder gestellt. Er zog sie in die Höhe und schob sie Richtung Haus. Als er zurückblickte, benetzte Alexander gerade das Gesicht des Vaters mit dem Rest des Wassers aus dem blauen Krug.
Seine Mutter kam aus der Küche und verstand die Aufregung zunächst nicht. Sie deutete auf die Hoheiten. »Hat sie eine Biene gestochen?«
»Holen Sie einen Arzt. Ihr Mann braucht Hilfe«, raunte Latour ihr zu. Er brachte die Kinder in die Küche und setzte sie an den Tisch, an dem sie zehn Minuten zuvor Kuchen gegessen hatten. Gisela hatte den Arm um den kleinen Bruder gelegt, dessen Augen ständig von Latour zu seiner Schwester und dann wieder durch die offene Tür wanderten. Der Arzt musste in der Nähe seine Praxis haben, vermutete Latour, als ein Mann mit Tasche in der Hand nur wenig später an ihm vorbei nach draußen stürmte. Alexanders Mutter lief hinter ihm. Es dauerte nur kurz, dann kam sie zurück. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen.
Eilig führte Latour die kaiserlichen Hoheiten aus dem Haus und verfrachtete sie in die Kutsche. Er trug dem Kutscher auf, sich um die zwei zu kümmern. Latour selbst lief in den Garten zurück, wo er den geschockten Alexander und seine weinende Mutter fand. Der Arzt stand gerade auf und schüttelte bedauernd den Kopf.
»Es muss ein Bienenstich gewesen sein. Wahrscheinlich im Mund, vielleicht auch in der Nase. Er ist erstickt.«
Alexanders Mutter schluchzte auf und umarmte ihren Sohn.
»Es ging schnell«, meinte der Arzt bloß.
Latour trat neben Mutter und Sohn. »Mein aufrichtiges Beileid.« Er war mit der Situation überfordert und wusste nichts anderes zu tun, als sein Mitgefühl auszusprechen.
Der Arzt holte Papiere aus seiner Tasche, setzte sich an den Tisch, auf dem noch der blaue Henkelkrug stand, und begann, den Totenschein auszufüllen. Latour bot seine Hilfe an, aber Alexander lehnte ab. Die kaiserlichen Hoheiten mussten auf dem schnellsten Weg zurück nach Schönbrunn.
Auf dem ganzen Rückweg sprach Latour kein Wort. Ihn plagte die Sorge, dass die Kaiserin seine neuen Lernmethoden, zu denen auch dieser Ausflug gehörte, kritisieren würde. Außerdem konnte er gewiss sein, dass sein Vorgänger, Graf Gondrecourt, von dem Vorfall erfahren würde. Der Graf war unehrenhaft entlassen worden und Latour war daran nicht unbeteiligt gewesen. Er würde jede Gelegenheit nutzen, um sich an Latour zu rächen.
03
Elisabeth saß am kleinen Schreibtisch in ihrem Arbeitszimmer und verfasste einen Brief an ihre Schwester Helene. Auf dem roten Sofa lag Houseguard ausgestreckt. Der Wolfshund gab leise schnarchende Laute von sich. Hinter Elisabeth flog die Tür auf. Sie drehte sich um und wollte gegen die Störung protestieren, als sie sah, dass es Rudolf war, der hereinstürmte. Sein Gesicht glänzte feucht, sein Haar klebte an der Stirn. Das Hemd hing aus der Kniehose und ein Strumpf war bis zum Schuh hinuntergerutscht.
Hinter Rudolf folgte seine große Schwester Gisela. Die Schleifen in ihrem dunkelblonden Haar waren aufgegangen, die Enden hingen lose herab.
Houseguard hob den Kopf und knurrte.
»Still«, befahl ihm Elisabeth. »Du kennst die zwei doch.«
Der Wolfshund klopfte nun zur Begrüßung mit dem Schwanz auf den seidenen Bezug des Sofas.
»Mama!« Rudolf schluchzte auf, lief zu ihr und verbarg seinen Kopf in ihrem Schoß. Elisabeth hob die Hände und legte sie nach kurzem Zögern tröstend auf den Jungen.
Gisela blickte sie mit großen Augen an. Ihre Unterlippe zitterte.
»Ist etwas geschehen?«, wollte Elisabeth wissen.
Als Antwort huschte Gisela neben sie und umklammerte ihren Oberarm.
Mit einer Hand strich die Kaiserin Rudolf über den Kopf, die andere musste sie verdrehen, um Giselas Gesicht zu ertasten. Sie fühlte etwas Feuchtes auf ihren Wangen. Gisela weinte.
Elisabeth hörte ein kurzes Räuspern. Sie sah Latour mit seiner betont aufrechten Haltung eintreten. Hinter sich schloss er die Türe. Sein Haar war dicht und gescheitelt, ein buschiger, sorgsam gepflegter Schnauzbart verdeckte den Großteil seiner Oberlippe.
»Latour?« Die Kaiserin deutete mit den Augen auf die verstörten Kinder.
Elisabeth hörte, wie Rudolf etwas murmelte.
»Was hast du gesagt?«
Rudolf richtete sich auf. »Er kommt doch morgen wieder? Morgen ist er wieder da, oder?«
Gisela schluchzte.
Elisabeth war ratlos über den Gefühlsausbruch der Geschwister. Josef Latour schien nach Worten zu ringen.
Houseguard verließ das Sofa. Helle Haare blieben auf dem Stoff zurück. Der Wolfshund gähnte und schüttelte sich, worauf sich noch mehr Haare aus dem Fell lösten und durch die Luft schwebten.
Die Kaiserin wollte nach der kleinen Glocke greifen, die auf dem Schreibtisch stand, die Umklammerung der Kinder hinderte sie aber daran. Latour kam zu Hilfe und reichte Elisabeth die Glocke. Es dauerte nur einige Sekunden, bis ein Diener eintrat.
»Majestät?«
»Limonade für die Kinder und…?« Sie blickte Latour fragend an.
»Limonade auch für mich, bitte.«
Der Diener verneigte sich und verschwand so schnell und lautlos, wie er gekommen war.
»Rudolf, Gisela, ihr erdrückt mich«, sagte Elisabeth und versuchte, sich behutsam zu befreien. Doch Rudolf krallte sich nur noch fester in den gekreppten Stoff des Rockes.
Josef Latour fasste den Kronprinzen sachte an den Schultern. »Kaiserliche Hoheiten, setzt Euch mit mir. Wir trinken Limonade und beruhigen uns.«
Die Kinder gehorchten. Er nahm sie mit zum Sofa, auf dem Houseguard gelegen hatte. Als Elisabeth den Mund öffnete, um sich nach dem Grund für die Aufregung zu erkundigen, platzte Gisela schon damit heraus.
»Er ist tot.«
»Wer ist tot?«, fragte Elisabeth erschrocken.
Rudolf und Gisela schluchzten wieder leise.
Latour wählte seine Worte sehr sorgfältig. »Majestät, auf unserem heutigen Ausflug zu Studienzwecken waren die kaiserlichen Hoheiten unglücklicherweise Augenzeugen eines bedauerlichen Unfalls.«
»Wie fürchterlich.« Elisabeth wollte fragen, wer ums Leben gekommen war, aber es erschien ihr besser, damit zu warten, bis sie mit Latour allein war.
»Als wir ins Schloss zurückkamen, wollten die Hoheiten sofort zu Ihnen und ich konnte ihnen diese Bitte nicht verwehren.«
»Natürlich nicht.« Die Kaiserin sah ihre Kinder mitfühlend an. »Meine armen Lieblinge.«
Rudolf und Gisela waren bleich und wirkten müde.
Latour erhob sich. »Wenn ich vorschlagen dürfte, die Hoheiten gleich in ihre Zimmer zu bringen. Ruhe wäre fürs Erste das Beste.«
Elisabeth nickte zustimmend. Sie winkte die Kinder zu sich, breitete die Arme aus und drückte die beiden zum Abschied kurz und zart. Danach verließen sie mit Latour den Raum.
Elisabeth blickte eine Weile auf die geschlossene Tür und drehte sich dann wieder zum Schreibtisch. Dort lag der angefangene Brief. Sie hatte gehofft, die Zeilen an ihre Schwester Helene würden ihr helfen, mit der Schwermut des heutigen Tages besser zurecht zu kommen. Neun Jahre, dachte Elisabeth. Neun Jahre ist es nun schon her. Und die Trauer wird nicht leichter.
Es klopfte und der Diener brachte auf einem Tablett drei Gläser Limonade. Nachdem er gegangen war, zerriss sie den Brief und ließ die Stücke auf dem Tisch liegen. Was sie nun brauchte, war Bewegung und frische Luft. Gerne hätte Elisabeth mit Ida über alles gesprochen, aber ihre Vertraute würde erst später am Nachmittag ins Schloss zurückkehren. Sie war noch unterwegs, um schöne Leichen zu besorgen.
Elisabeth wollte ihr Appartement nicht durch das Gardezimmer verlassen. Schon oft hatte sich ihre Idee als nützlich erwiesen, eine Wendeltreppe einbauen zu lassen, die das Schreibzimmer mit ihrem Gartenappartement im Erdgeschoss verband. Unbemerkt konnte sie auf diesem Weg das Schloss verlassen.
»Komm, Houseguard«, sagte Elisabeth und klatschte in die Hände. Mit einer Hand hielt sie die Schleppe des Kleides hoch, die andere lag auf dem Geländer. Die Mode der weiten Röcke machte das Treppensteigen nicht gerade einfach. »Wir machen einen Spaziergang!«, rief sie dem Wolfshund zu.
Latour würde sie finden, wenn er sich um die Kinder gekümmert hatte, um ihr von den Ereignissen zu berichten. Hier aber wollte sie nicht bleiben.
Houseguard zögerte. Elisabeth wusste, dass ihm die offenen Stufen unheimlich waren. Die Aussicht auf den Spaziergang war aber verlockend. Einen Augenblick später hörte sie seine Krallen auf dem Metall der Treppe kratzen.
04
Der schlichte Ziegelbau, vor dem Ida stand, erinnerte an eine Fabrik. Neben der Tür hing ein blank poliertes Messingschild. Ida studierte die Inschrift. Sie hatte gefunden, was sie suchte. Aber was nun? Sie betrachtete nachdenklich die lange Metallstange mit Griff, die zur Türglocke gehörte.
Ida zögerte. Sie konnte unter keinen Umständen einfach anläuten und nach schönen Leichen verlangen. Schon gar nicht so, wie sie aussah. Ihre feine Kleidung und der Sonnenschirm, den sie auf der Schulter trug, verrieten, dass sie nicht aus dieser Gegend war. Bevor sie ihren Wunsch vortrug, wollte sie Amalie Buback erst einmal kennenlernen und prüfen. Die Frau musste verschwiegen sein. Sie könnte herausfinden, in wessen Auftrag Ida unterwegs war. Unter allen Umständen musste sie Tratsch über Elisabeths Wunsch nach schönen Leichen vermeiden.
Schließlich gab sich Ida einen Ruck und zog am Griff. Drinnen hörte sie eine Glocke schellen. Erwartungsvoll blickte sie zur Tür. Niemand öffnete. Nach einer Minute klingelte sie erneut und schließlich ein drittes Mal. Aber niemand kam.
Was sollte sie tun? Der Fiaker, der sie von Schönbrunn nach St. Marx gebracht hatte, wartete an der Ecke. Der Kutscher lehnte beim Vorderrad und hatte die Arme verschränkt. Er starrte nicht in ihre Richtung, aber Ida war sicher, er beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie hatte den ganzen Weg vergeblich gemacht.
Ein Bursche kam die Straße heruntergelaufen. Er hielt mit der Hand seine Kappe auf dem Kopf, damit sie nicht herunterfiel. Das einfache, weite Hemd und die etwas zu kurzen Hosen ließen vermuten, dass er ein Handwerker war.
Vor Ida blieb der Bursche stehen. »Wollen Sie zu ihr?« Er deutete mit dem Kopf auf die Tür.
»Ich möchte mit Amalie Buback sprechen«, erwiderte Ida.
»Sie ist auf dem Friedhof.«
»Auf dem Friedhof? Nicht in ihrem Atelier?«
»Wir haben einen, der sich erschossen hat und gleich eingegraben wird. Ich muss die größere Kamera bringen. Was weiß ich, wieso. Sie ist da immer sehr heikel.« Er steckte den Schlüssel ins Schloss und sperrte auf. »Sie können drinnen warten, wenn Sie fotografiert werden wollen.«
»Es geht nicht um ein Foto von mir, sondern…« Ida brach ab und fuhr nach einer kleinen Pause fort. »Ich muss persönlich mit Amalie Buback sprechen. Daher möchte ich, dass Sie mich zu ihr führen.«
Wieder zuckte der Bursche mit der Schulter. »Ich hole die andere Kamera.« Er verschwand im Haus.
Durch die offene Tür sah Ida in einen großen, hellen Raum. Licht flutete durch die hohen Fenster und das verglaste Dach. Verschiedene Sitzmöbel standen herum. Bei einem Stuhl ragte eine Stange aus der Lehne, an deren Ende sich eine halbrunde Halterung befand.
Ida hatte so etwas schon einmal gesehen. Wer sich fotografieren ließ, konnte dort seinen Kopf einspannen lassen, um ihn ruhig zu halten.
Aus einem Nebenraum brachte der Bursche die hölzerne Kamera auf einem Stativ. Schwarzer Stoff hing von ihr herab. »Ich hab’s eilig«, sagte er. Nachdem er abgesperrt hatte, lief er die Straße hinauf.
Ida konnte kaum mit ihm Schritt halten. Das lange Kleid war eindeutig ungeeignet für diesen Ausflug.
05
Elisabeth hatte nicht vor, ziellos im Schlosspark herumzuwandern. Mit schnellen Schritten ging sie hinter dem Schloss Richtung Obeliskenallee. Als sie und ihr Hund die ersten Bäume der Allee erreichten, schnupperte Houseguard an den Stämmen und hob bei jedem das Bein.
Von der Seite des Schlosses, an der ihr Gartenappartement lag, kam ein Mann in einem unauffälligen grauen Anzug. Er trug einen Hut und hielt den Kopf gesenkt.
»Flott«, trieb sie den Wolfshund an. »Es gibt auch oben Bäume.«
Houseguard löste sich ungern von der interessanten Duftmarke und kam ihr nach. Elisabeths Vorsprung wuchs, weil sie mehr lief als ging.
Die Kaiserin war auf Latours Bericht gespannt. Sie konnte sich noch immer nicht vorstellen, was genau geschehen war. Allerdings zweifelte sie nicht daran, in Latour einen verlässlichen Erzieher gefunden zu haben.
Elisabeth hatte Josef Latour während ihres zweijährigen Aufenthalts auf Madeira kennen und schätzen gelernt. Er war mehrmals als Gesandter des Kaisers zu ihr gekommen. Seine Aufgabe war es, die Briefe des Kaisers zu überbringen und die Rechnungen einzusammeln, die während des Aufenthalts von Elisabeth und ihrem fast hundertköpfigen Hofstaat angefallen waren.
Der Landsitz Quinta Vigia war von ihr gemietet worden, weil sie den Blumengarten liebte, der ihn umgab. Außerdem hatte sie von der Terrasse den schönsten Blick auf das Meer. Elisabeth hielt sich mehrere Hunde und in einer Voliere bunte Papageien. Sie fühlte sich wie damals in ihrer Kindheit auf Schloss Possenhofen in Bayern.
Mit Latour saß sie meistens im Freien und genoss die milde Seeluft Madeiras. Ihr Arzt meinte, sie würde eine heilende Wirkung auf Elisabeths angegriffene Lunge haben.
Verschämt hatte Latour einmal erwähnt, dass die milde Wärme Madeiras für ihn in den Wintermonaten eine willkommene Abwechslung zur Kälte in Wien war. Er berichtete bei jedem Besuch von Neuigkeiten aus der Hauptstadt des Reiches. Die meiste Zeit redete er vom Kaiser und den Kindern. Obwohl er es nie aussprach, verstand Elisabeth, dass sie nicht nur ihr Mann, sondern auch der Hof und die Menschen des Landes vermissten.
Im Laufe der Zeit besserte sich nicht nur ihre Gesundheit, vor allem fühlte sich Elisabeth sicherer und stärker.
Aus dem Spiegel in ihrem Ankleidezimmer blickte ihr nicht länger Sisi entgegen, das süße Mädchen, in das der Kaiser so verliebt war, über das aber seine Mutter Sophie, sein Bruder Ludwig Viktor und viele andere bei Hof den Kopf schüttelten. Sie war kein Kind mehr, das sich von ihnen belehren oder erziehen ließ, wie es in den ersten Jahren ihrer Ehe mit Franz Joseph geschehen war.
Aus Sisi war Kaiserin Elisabeth geworden, eine erwachsene Frau von einzigartiger Schönheit. Auf ihren Spaziergängen in der Hauptstadt Madeiras, Funchal, hatte sie die bewundernden Blicke der Menschen gespürt. Ihre Hofdamen berichteten, dass Elisabeths Anmut Gesprächsthema auf der ganzen Insel war.
Die Unterhaltungen mit Josef Latour hatten zu Elisabeths neuem Selbstbewusstsein beigetragen. Sie redete mit ihm über Poesie, Philosophie und die Kunst der alten Griechen. Elisabeth spürte seinen Respekt für ihre Bildung.
Sie begriff, dass er zwischen dem Kaiser, dem Hof und ihr vermitteln wollte. Er achtete dabei ihre Zurückhaltung und zeigte, wenn auch auf stille Weise, Verständnis. Besonders hoch rechnete sie ihm an, dass er sie mit keiner Silbe zur Rückkehr mahnte. Latour erwähnte höchstens die Spekulationen der Presse über ihre Abwesenheit, die zuerst Monate, nun aber schon zwei ganze Jahre andauerte.
Das leise Bellen ihres Hundes holte Elisabeth in die Gegenwart zurück. Sie sah sich nach Houseguard um und bemerkte dabei fünfzig Schritte hinter sich den Mann im grauen Anzug. Er blickte zu Boden und schlenderte zur Seite hinter den Stamm einer hohen Kastanie. Elisabeth verdrehte die Augen.
Für wie dumm hielten sie ihre Bewacher eigentlich?
Der Wolfshund erschien hechelnd neben ihr. Nebeneinander schritten sie auf das Ziel von Elisabeths Spaziergang zu: die kleine Gloriette.
06
Ida hatte schon einige Male vom St. Marxer Friedhof gehört, den sie nun betrat. Der Bursche stapfte durch ein Gittertor. Ohne sich ein einziges Mal umzudrehen, lief er durch eine lange Allee. Die Bäume trugen das zartgrüne Laub des späten Frühlings. Flieder und andere blühende Büsche nahmen dem Ort etwas von der Traurigkeit, die hier zu fühlen war.
Wege zweigten nach links und rechts ab. An beiden Seiten waren Gräber und Grüfte angelegt.
Ida wollte dem Burschen schon zurufen, ein wenig langsamer zu gehen, als er von allein stehen blieb. Er deutete auf eine Grabstätte. Ein steinerner Engel lehnte an einem Sockel, auf dem eine Säule stand. Das obere Ende war bewusst so gestaltet, dass die Säule wirkte, als wäre sie in der Mitte abgebrochen.
W. A. MOZART1756 - 1791
»Mehr ist auch von ihm nicht übriggeblieben«, sagte der Bursche mit Spott in der Stimme.
Ida wollte einwerfen, dass Mozarts Musik unsterblich war, kam aber nicht dazu. Der Bursche war schon weiter. Er bog nach links ab und Ida hörte eine Frau rufen.
»Peter, na endlich.«
Als Ida in den Nebenweg trat, blieb sie mit einem Ruck stehen und bekreuzigte sich hastig.
Auf zwei einfachen Holzblöcken stand ein offener Sarg aus dunkler Eiche. Der Deckel lag daneben im Gras. Am Grab stützten sich zwei kräftige Männer in dreckigen Hosen auf ihre Schaufeln. Gelangweilt verfolgten sie, was die Frau tat. Es musste die Photographin Amalie Buback sein. Sie hatte ihr rotblondes Haar unter die gleiche Kappe gestopft, wie sie auch der Bursche trug. Ein paar Strähnen hingen schlampig bis zu ihren Schultern herab.
»Sie sucht dich«, erklärte der Bursche und zeigte auf Ida.
»Kommen Sie morgen wieder.«
Nie zuvor war Ida so respektlos angesprochen worden. Was bildete sich diese Photographin ein? Die knielangen Hosen und ihre grüne Jacke waren Männerkleidung und passten weder zu einer Frau noch auf den Friedhof. Wo blieb die Ehre für die Verstorbenen? Idas Entrüstung wuchs.
Peter stellte die Kamera neben dem Ende des Sarges auf, wo sich der Kopf des Toten befand.
Es war nicht der erste Tote, den Ida sah. Auf dem Anwesen ihrer Eltern in Ungarn hatte es mehrere Todesfälle gegeben. Die Neugier hatte die kleine Ida damals in die Kammer schleichen lassen, in der die Toten aufgebahrt wurden. Der Anblick hatte seinen Schrecken verloren.
Um zu beweisen, dass sie sich nicht einfach so fortschicken ließ, trat Ida zwei Schritte näher. Bisher war ihr der Blick auf den Toten nicht möglich gewesen. Was sie nun sah, ließ sie die Hand vor den Mund schlagen.
Der Mann im Sarg musste ungefähr in ihrem Alter sein. An seiner Schläfe klaffte eine Wunde, die Ränder dunkel und von Blut verkrustet. Jemand hatte mit fleischfarbener Schminke darüber gemalt, was die schreckliche Tatsache nicht verbergen konnte, dass an dieser Stelle eine Revolverkugel eingedrungen war.
Amalie fotografierte von der anderen Seite.
»Der Mund… drück ihn ein wenig nach oben, Peter!«, verlangte Amalie. Ohne Zögern trat Peter zu der Leiche und bearbeitete die Mundwinkel mit den Fingern.
»Das reicht.« Amalie verschwand unter dem schwarzen Tuch. »Abnehmen!«, rief sie.
Peter zog den Deckel vom Objektiv. Laut zählte die Photographin bis zehn. Dann setzte Peter den Deckel wieder auf.
Amalie kam unter dem Tuch hervor. »Noch zwei. Eines wird sicher gelungen sein.« Sie verschob die Kamera leicht zur Seite.
Die Totengräber murrten.
»Ihr könnt ihn gleich eingraben«, versprach Amalie. Sie zog etwas aus der Hose. Die Männer streckten sofort die Hände aus und sie ließ Münzen hineinfallen. Schnell verschwand das Geld in den Hosentaschen der Totengräber.
Noch immer wartete Ida neben einem Fliederbusch. Der Duft der letzten Blüten hatte eine beruhigende Wirkung auf sie.
»Fertig.« Amalie klatschte in die Hände. »Du bringst alles ins Atelier, Peter.« Sie ging los und blieb vor Ida stehen.
»Wollen Sie ein Foto? Kind? Heirat? Oder geht es um einen Verstorbenen?«
Amalie musste Idas Überraschung bemerkt haben, denn sie setzte hinzu: »Das sind die drei häufigsten Gründe, wieso sich Menschen fotografieren lassen.« Mit einem Blick auf Idas Kleidung fügte sie hinzu: »Einfache Leute, die nicht so viel Geld haben.«
Ida sah über Amalies Schulter zum Sarg, dem die Totengräber den Deckel aufsetzten.
»Schulden sollen der Grund gewesen sein. Spielschulden«, erklärte die Photographin. »Der junge Mann hat keinen anderen Ausweg gefunden. Der Vater ist nicht einmal zum Begräbnis erschienen. Die Mutter war allein. Der Priester hat sich geweigert, den Sohn einzusegnen, da er den Freitod gewählt hat. Von mir wünschte sie sich eine letzte Erinnerung an den Sohn. Ihr Mann darf davon nichts wissen.«
»Sie machen das oft, nicht wahr? Fotos von Toten?«, sagte Ida.
»Deshalb liegt mein Atelier neben einem Friedhof.«
»Man hat Sie mir als Photographin von Toten empfohlen«, fuhr Ida fort.
»Was kann ich also für Sie tun?«
»Zuerst muss ich Sie um absolute Diskretion bitten.«
»Sehe ich wie eine Klatschbase aus?«
Ida kam ins Stammeln. »Nein, nein.«
»Na also.« Amalie ging flott.
Da Ida Spaziergänge mit Elisabeth gewohnt war, fiel es ihr nicht schwer, mit der Photographin Schritt zu halten.
»Wieso sind Sie hergekommen?«, wollte Amalie wissen.
»Es geht um Fotos schöner Leichen, die jemand erwerben möchte.«
Die Photographin blieb stehen und sah Ida amüsiert an. »Sollen die Fotos schön sein oder die Leichen?«
»Beide.«
»Damit kann ich dienen.«
Ida war erleichtert, dass Amalie vorerst nicht fragte, für wen die Fotos sein sollten.
Nachdem sie in das Atelier zurückgekehrt waren, vereinbarte Ida mit Amalie den Preis für die Fotos und den Ort der Übergabe. Sie achtete darauf, dass er weit genug von Schloss Schönbrunn entfernt lag, damit Amalie Buback keinen Verdacht schöpfte.
Sie sah zwar nicht aus wie eine Klatschbase, aber die Kaiserin von Österreich war auch keine normale Kundin.
07
Elisabeth liebte die kleine Gloriette. Hier konnte sie den Menschen entfliehen, die im Park spazieren durften. Der Zutritt zum Pavillon war nur ihr gestattet und selbst im Hochsommer blieb der Innenraum angenehm kühl. Sie saß an einem kleinen weißen Tisch, der die Form eines Seerosenblattes hatte. Die Sitzfläche der beiden Stühle war ebenso gestaltet. Jedes Mal, wenn sie sich hier zurückzog, bewunderte sie die kunstvollen Wandgemälde und das rosafarbene Marmorbecken an der Wand, aus dem ständig Wasser plätscherte.
»Majestät?«
»Latour, treten Sie ein.«
»Der Gardist bei Ihrem Appartement hat mir gesagt, Sie wären hier.«
»Mein Schicksal ist es, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden.« Sie deutete Latour, Platz zu nehmen. »In diesem Fall ist es ausnahmsweise ein Glück. Wie geht es Gisela und Rudolf?«
»Giselas Aja hat beide zu Bett gebracht. Ich werde später noch einmal nach ihnen schauen.« Latour rang noch ein wenig nach Luft. »Verzeihen Sie, Majestät, aber der Weg herauf ist recht steil.«
Houseguard kratzte an der Tür. Latour stand auf, um ihm zu öffnen. Der riesige Wolfshund ließ sich zu Füßen seiner Herrin auf den Boden sinken. Er seufzte tief und legte den Kopf zwischen die Pfoten.
»Nun erzählen Sie«, verlangte Elisabeth. Ihre Betroffenheit wurde immer größer, je länger Latour sprach.
»Dieses Leid«, sagte Elisabeth leise, nachdem der Lehrer geendet hatte. »Die arme Familie. Ich werde ihnen eine Unterstützung in dieser schweren Zeit zukommen lassen.«
»Ich habe dem Naturkundelehrer den morgigen Tag frei gegeben.«
»Das ist gut so.« Elisabeth seufzte tief und faltete die Hände im Schoß. Als sie aufsah, bemerkte sie Latours besorgte Miene. Sie neigte fragend den Kopf.
»Majestät, ich hoffe, Sie haben nicht den Eindruck, ich hätte meine Kompetenz überschritten.«
»Ich finde diese Art des Lernens ausgezeichnet. Der fürchterliche Vorfall war von niemandem vorherzusehen.« Elisabeth sah die Erleichterung in Latours Gesicht. Sie seufzte. »Der 29. Mai ist also nicht nur für mich ein Trauertag.«
Eine Pause entstand.
»Es war genau heute, am 29. Mai, vor neun Jahren«, sagte Elisabeth, ohne den Oberst anzusehen, »als meine erste Tochter Sophie auf einer Reise durch Ungarn Fieber bekam. Kurz darauf starb sie. Sie war zwei Jahre alt.« Leise fügte sie hinzu: »Ich mache mir bis heute Vorwürfe deswegen.«
»Majestät…« Latour suchte nach Worten.
Elisabeth hob die Hand. »Es gibt keinen Trost. Nur Trauer, mit der man zu leben lernt.«
Sie erhob sich. Houseguard war sofort auf den Beinen. Latour öffnete ihr die Tür und Elisabeth verließ die kleine Gloriette. Während sie ihren Sonnenschirm aufspannte, fragte die Kaiserin: »Ich will Anweisung geben, dass die Familie des Imkers eine Unterstützung erhält. Wie ist der Name?«
»Habe ich das nicht erwähnt?«, fragte Latour zerstreut. »Der Imker hieß Oberland. Alfred Oberland. Er hat in der Hofbibliothek gearbeitet und den Kronprinzen in Musik unterrichtet. Und manchmal«, Latours Stimme wurde leiser, als er sich erinnerte, »spielte er für die kaiserlichen Hoheiten auf der Geige.«
08
Als Elisabeth in ihr Appartement zurückkehrte, war das Abendessen vorbei. Sie war froh, keine Ausrede erfinden zu müssen, wieso sie am Essen nicht hatte teilnehmen können. Die Waage hatte am Morgen knapp 52 Kilogramm gezeigt und das war für Elisabeth entschieden zu viel. Ein Fastentag würde ihr guttun.
Sie begab sich in das Ankleidezimmer, wo sie bereits von den Kleiderzofen erwartet wurde. Es waren schüchterne Mädchen, die unter Anleitung einer älteren Zofe beim Auskleiden halfen. Eine Zofe hielt den seidenen Hausmantel der Kaiserin bereit und Elisabeth schlüpfte hinein. Es war angenehm, den kühlen Stoff auf der Haut zu spüren.
Im Toilettezimmer wartete Fanny Feifalik auf sie. Fanny knickste, als Elisabeth eintrat, und rückte ihr den Stuhl vor dem Spiegel zurecht.
»Ich kann es heute kaum erwarten, meine Augen zu schließen«, sagte Elisabeth. Sie nahm wahr, wie Fanny nickte und die Lippen zusammenpresste. Am Morgen hatte sie noch ein paar tröstende Worte verloren, doch Elisabeth hatte ihr befohlen, zu schweigen.
»Ida?«, rief sie. Sie war gewohnt, dass ihre Hofdame immer in der Nähe war. Aber Ida kam nicht. Sie konnte sich doch nicht schon zurückgezogen haben? Elisabeth fiel ein, dass Ida einen Photographen hatte aufsuchen wollen, um ihr Bilder von Verstorbenen zu besorgen. So reizvoll sie die Idee am Vortag gefunden hatte, so wenig gefiel sie ihr heute.
Mit geschulten Händen löste die Friseuse die kunstvoll hochgesteckte Frisur der Kaiserin, bis die Haare offen fast bis zum Boden fielen. Behutsam glättete sie das Haar mit einer Bürste.
»Reich mir mein Album, Fanny«, verlangte Elisabeth.
»Wo kann ich es finden, Majestät?«
»Es liegt wohl in meinem Gartensalon auf dem Tisch.«
Fanny unterbrach das Bürsten und ging nach unten. Doch sie brachte jenes Album, das Elisabeth für die schönen Leichen vorgesehen hatte.
Elisabeth reagierte gereizt. »Nein, das andere. Das volle Album.«
Fanny entschuldigte sich und eilte davon. Mit einem dicken, in Leder gebundenem Buch kehrte sie wieder. Elisabeth legte es sich auf die Knie und begann darin zu blättern. Es war eine Sammlung von Photografien verschiedener Frauen, die in ihren Augen Schönheiten waren. Sie hatte den Auftrag gegeben, dass alle Botschafter aus den verschiedenen Ländern Lichtbilder der schönsten Frauen senden sollten.
Pauline Metternich, die Frau des österreichischen Botschafters in Paris, hatte Elisabeth jedoch Fotos von Frauen der Halbwelt geschickt. Elisabeth und »Mauline Petternich«, wie die Kaiserin sie gerne nannte, konnten sich nicht ausstehen. Die Frau des Botschafters lebte nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber. Elisabeth empfand das als geschmacklos.
»Sie dachte wohl, ich merke das nicht«, sagte Elisabeth zu Fanny, während sie durch die Seiten blätterte. »Aber einige dieser Frauen sind wahre Schönheiten. Die Metternich sollte sich an ihnen ein Beispiel nehmen.«
Fanny unterdrückte ein Lachen. Die Prozedur des Bürstens nahm einige Zeit in Anspruch. Elisabeth gähnte und wollte zu Bett gehen. Im Toilettezimmer ließ sie sich die Zahnbürste reichen, auf die aus einem Tiegel schon ein Klecks Zahncreme aufgetragen worden war.
Nach dem Zähneputzen begab sich Elisabeth in das eheliche Schlafzimmer. Eine Zofe nahm ihr den Morgenmantel ab, unter dem sie nackt war. Nachdem sie sich hingelegt hatte, arrangierte die andere Zofe ihr Haar rund um ihren Kopf auf dem Laken. Kopfkissen gab es keines, da es Falten im Gesicht verursachen konnte.
Auf den Bauch ließ sich Elisabeth ein nasses Laken legen. Die Kälte sollte helfen, die schlanke Taille zu bewahren. Zum Abschluss öffneten die Zofen die Fenster und ließen die Nachtluft in das Zimmer. Zwei Kerzen auf einem Tisch in der Ecke spendeten ein wenig Licht.
Franz Joseph, mit Nachthemd und langen Unterhosen bekleidet, schlüpfte auf seiner Seite des Bettes unter die Decke und wünschte Elisabeth eine gute Nacht.
Das Ehepaar lag nebeneinander im Doppelbett. Nah und doch so weit voneinander entfernt, dachte Elisabeth. Statt der Freiheit, nach der sich Elisabeth so sehr sehnte, kannte ihr Mann bloß die eiserne Pflicht, mit der er sein Weltreich regierte. In diesem riesigen Imperium war Platz für Millionen von Menschen, und doch kam ihr vor, als gäbe es keinen Platz für sie. Elisabeth drehte den Kopf zu Franz Joseph, der auf dem Rücken lag und die Augen geschlossen hatte.
Sie war jung und dumm gewesen, als der Kaiser sich in sie verliebt und sie diese Verliebtheit als Auszeichnung empfunden hatte. Mit 15 Jahren hatte sie keine Ahnung davon gehabt, was es bedeutete, Kaiserin von Österreich zu sein. Ihr Vater war über die Heirat nie begeistert gewesen. Elisabeth hatte den Freiheitsdrang von ihm in die Wiege gelegt bekommen.
Sie erinnerte sich an die ersten Tage nach der Hochzeit, die sie in Schloss Laxenburg verbracht hatten. Die beiden Mütter lauerten wie Geier auf einen Beweis, dass die Ehe vollzogen worden war. Franz Joseph hatte sie die meiste Zeit allein gelassen, weil er den Regierungsgeschäften nachgehen musste. Erzherzogin Sophie, seine Mutter, hatte den ganzen Tag etwas an Elisabeth auszusetzen gehabt und mit ernster Miene ständig angemerkt, dass sie sich dem Hofprotokoll unterzuordnen hatte.
Damals war ihr klargeworden, dass sie in einem goldenen Käfig gefangen saß. Aus Sisi, die voller Lebensfreude steckte, war Kaiserin Elisabeth geworden, die von Tag zu Tag bedrückter wurde.
In ihren Briefen an die geliebte Schwester Sophie hatte sie einmal geschrieben: Franz Joseph ist mehr Monarch als Ehemann. Die Pflicht geht für ihn immer vor. Die wichtigste Frau in seinem Leben ist seine Mutter. Es regiert in ihm der Kopf, kaum aber sein Herz.
Die quälenden Verpflichtungen als Kaiserin, der Tod der ersten Tochter, die Geburt von Rudolf, das alles hatte Elisabeth krank gemacht. Der schwere Husten, der sie quälte, erforderte eine Luftveränderung, hatte der Arzt diagnostiziert und Madeira vorgeschlagen. Elisabeth war glücklich gewesen, dem Hof, aber auch Franz Joseph und seiner Mutter entfliehen zu können.
Wehmütig dachte sie oft an ihre Kinderzeit zurück. Ihre Mutter hatte immer darüber geklagt, sie könne nie stillsitzen und interessiere