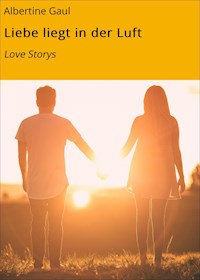Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Judith Reh lebt mit ihrer Tochter Janina in einem kleinen Städtchen in Deutschland. Als Kindergärtnerin bestreitet die allein erziehende Mutter ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter, ein neuer Mann ist in weiter Ferne. Dann hört sie eines Nachts in ihrer Wohnung unheimliche Geräusche und sieht eine Schattengestalt im Flur. Kurz darauf wird sie Zeuge eines Motorradunfalls in der Nähe ihrer Wohnung. Bald schon hat sie es mit einem heimwehkranken Geist und einem dämonischen Spion zu tun. Als dann ein LKw in ihren Kindergarten rast, ist Judith mitten im Abenteuer ihres Lebens angelangt. Wie wird es enden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe kommt manchmal auf Umwegen!
1. Kapitel
Der Auftrag
Es herrschte helle Aufruhr in dem Reich des Dämonenherrschers Abbadon, denn der König hatte verkündet, sein Imperium bis zu den Lebenden auf die Erde ausdehnen zu wollen. Viele seiner Untergebenen machten sich Hoffnungen, bei der Eroberung dabei sein zu dürfen und ein Stück vom Kuchen abzubekommen.
Nur Nybrass, Jungdämon und noch unerfahren in der Unterwerfung anderer Spezies, machte sich keine Hoffnungen, bei dem Angriff mit dabei sein zu dürfen, als ihn der Ruf des Herrschers erreichte. Ein Bote brachte ihm die Nachricht, sofort zum König zu kommen.
„Er hat gesagt, es eilt“, sagte der und überreichte dem überraschten Nybrass ein Schreiben seines Königs, in dem dieser die Worte des Boten noch bekräftigte.
„Ich mache mich sofort auf den Weg“, erklärte Nybrass und dankte dem Boten für die Nachricht. Dabei fragte er sich, was der Herrscher von ihm wollte. Hatte er von den geheimen Gedanken seines Untertanen erfahren und wollte ihn nun bestrafen? Oder war er auserwählt, die Truppen des Königs ins Land der Menschen zu führen, um den ersten Schlag auszuführen?
Was es auch sei, den Ruf des Herrschers zu ignorieren, würde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen, daher machte sich Nybrass sofort auf den Weg.
Das Reich der Dämonen befand sich in einer anderen Dimension, verbunden nur durch einzelne Portale, die auf der einen Seite von Dämonen, auf der anderen Seite von Engeln bewacht wurden. Das Übertreten dieser Grenze war den Unterweltlern strikt verboten, und wurde von höchster Stelle sofort geahndet.
Trotzdem wagen es immer wieder einzelne Dämonen, diesen Schritt zu gehen. Angezogen von Hass, Streit und Gewalt, fanden sie einen Weg, ins Reich der Lebenden zu gelangen, um dort noch mehr Wut und Aggression zu verbreiten. Doch auch die Menschen fanden Wege, die Verführungen der Dämonen abzuwehren und sie in ihr Reich zurückzuschicken.
Nybrass kam an mehreren dieser Portale vorbei, als er zum Palast schwebte. Nein, Dämonen liefen nicht in ihrem Reich, sie schwebten. Eine Art der Fortbewegung, die weniger Energie erforderte und auch ein schnelleres Fortkommen ermöglichte.
Er kannte die Wächter, grässliche Kreaturen, mit Hundeköpfen und langen Fangzähnen, die jeden kontrollierten, die die Tore passieren wollten. Einige waren ganz nett, für einen Dämon, andere wiederum machten sich einen Spaß daraus, dem Jungdämon Streiche zu spielen und damit ihre Macht zu demonstrieren.
Heute hatten Baka, Lilu und Mura Dienst an den Toren. Die drei kannte Nybrass gut, sie waren seit Kindertagen miteinander befreundet, daher würden sie ihn auch nicht daran hindern, zu Abaddon zu gelangen und ihm keine Streiche spielen.
„Wohin so eilig“, fragte Baka, ein Dämon, der sich in seiner Freizeit oft auf die Erde schlich, um sich vom Fleisch der Toten zu ernähren.
„Der König wünscht mich zu sprechen“, antwortete Nybrass wahrheitsgemäß. Vor seinen Freunden brauchte er sich nicht zu verstecken.
„Hast du was ausgefressen“, stichelte Mura, ein Dämon, dessen Haupt immer etwas locker auf den Schultern saß, seit ihn ein Gott mit einer Steinschleuder enthauptet hatte.
„Nicht, das ich wüsste“, sagte Nybrass. „Ich frage mich, ob er mich mit auf die Erde nimmt, um seine Truppen anzuführen.“
Liliu kicherte. „Ausgerechnet du. Das glaubst du wohl selber nicht.“ Der Dämon, einst für Tod, Krankheiten und Seuchen zuständig, war in der Hierarchie ganz nach unten gerutscht, als er es wagte, sich mit Abaddon um die Macht im Reich zu streiten. Als Strafe durfte er nun die Dimension nicht verlassen und musste die Portale bewachen.
Was ihn mächtig ärgerte, wie er Nybrass wiederholt gestanden hatte. „Irgendwann macht er einen Fehler und dann bin ich an der Reihe. Warte es nur ab, Nybrass. Abaddon ist nicht so schlau und mächtig, wie er immer tut. Ich kriege ihn, früher oder später.“
„Es war nur so ein Gedanke. Was sollte er sonst von mir wollen? Eine Rebellion habe ich nicht angezettelt, auch sonst bin ich eher unauffällig! Also, was meint ihr, was er von mir will“, fragte Nybrass seine Freunde.
„Vielleicht will er dich bloß testen“, überlegte Mura. „Was er auch von dir will, du solltest ihn nicht warten lassen.“
„Ja, du hast Recht. Ich muss weiter. Wir sehen uns.“
Nybrass verabschiedete sich von seinen Freunden und eilte schwebend weiter, durch höllische Einöden, in denen Bestrafte ihre Arbeiten verrichteten und an blühenden Gärten vorbei, einem Paradies nicht unähnlich. Nur dass es eine Illusion war, geschaffen, die Lebenden zu blenden und es ihnen leichter zu machen, sich im Reich einzuleben. Dämonen benötigten eigentlich kein Grün, aber Nybrass genoss jedes Mal den Gang durch dieses Wunschbild. Er sehnte sich seit seiner Kindheit nach dem Reich der Lebenden, wollte die Menschen und die Erde erforschen. Dazu gehörten auch Bäume und Blumen. Viel hatte ihm seine Mutter davon erzählt, bevor sie vom König wegen Verrates verbannt wurde. Nybrass hatte sie nie wieder gesehen.
Ein Gedanke, den er sorgfältig verstecken musste, als der pompöse Palast von Abaddon in Sicht kam. Die Anlage lag auf einer Anhöhe, geformt aus einen Vulkan, und stellte jeden Palast an diesem Ort in den Schatten. Höher und breiter wie eine ganze Stadt, verziert mit Gold und Edelsteinen, protzte sie mit jener Macht, die Abaddon ausübte. Jeder, der diese Anlage betrat, sollte in Erfurcht erstarren und daran erinnert werden, zu was der Herrscher fähig war.
Auch Nybrass war beeindruckt, als er die unterste Ebene erreichte, an denen erste Kontrollen stattfanden. Es gab ein eisenbeschlagenes Tor, an denen Palastwachen standen, die ihn nach seinem Begehr fragten.
„Ich habe ein Schreiben vom Herrscher, mich so schnell wie möglich im Palast einzufinden“, erklärte Nybrass und reichte einem der Wächter das Papier.
Dieser studierte es gründlich und gab es an seinen Kollegen weiter, der es ebenfalls las.
„Es scheint echt zu sein“, sagte er dann. „Kannst du dich ausweisen?“
„Nybrass aus Dis. Seht mein Mal“, er streckte seine Hand mit den sechs klauenartigen Fingern aus, auf dessen Rücken ein Zeichen eingraviert war. Es zeigte eine Schlage, über deren Kopf eine schwarze Wolke schwebte.
„Ich sehe es“, nickte der Wächter. „Und nun die Gedankenkontrolle. Bist du bereit?“
Innerlich zitterte Nybrass, denn einige seiner Gedanken konnte er nicht so einfach verstecken. Doch er hoffte, dass die Wächter nicht zu tief gruben und nickte daher.
Sofort spürte er die andere Präsens in seinen Gedanken. Sie suchte, forschte und brachte unangenehme Erinnerungen an den Tag. Erinnerungen an Demütigungen, Verletzungen und Sticheleien, denen er in seinem Dämonendasein ausgesetzt gewesen war.
Nach einer Weile zog sich der Wächter aus Nybrass Gedanken zurück und nickte grinsend.
„Interessante Gedanken“, sagte er. „Aber nicht gefährlich für den Herrscher. Du darfst passieren.“
Nybrass war erleichtert und durchschritt das erste Tor. Weitere folgten, doch die Kontrollen waren nicht mehr so streng, wie am ersten Eingang. Er wurde lediglich nach Waffen und schriftlichen Gründen für eine Rebellion durchsucht. Für beides gab es keine Anzeichen, so dass der Jungdämon sich nicht so in Acht nehmen musste.
Schließlich erreichte er das Allerheiligste, den Thronsaal des Herrschers. Eine große Halle, die ebenfalls mit Gold und wertvollen Malereien geschmückt war, die Szenen aus dem Leben des Herrschers zeigten. Hohe Bilder, die das frivole Leben am Hof darstellten und auch vor pornographischen Szenen nicht Halt machten.
Nybrass warf nur einen kurzen Blick auf die Gemälde und konzentrierte dann seine ganze Aufmerksamkeit auf den opulenten Thron am Ende der Halle, auf dem Abaddon neben seiner Geliebten Ereschkigal saß und Hof hielt.
„Sei willkommen, Nybrass, Sohn von Agash und Devas. Bruder des Firik. Du folgtest meiner Einladung schnell, so wie ich es gewöhnt bin“, begrüßte ihn der gewaltige Herrscher und Nybrass verbeugte sich.
„Die Freude liegt ganz auf meiner Seite, Meister. Wie kann ich euch dienen?“
„Du kommst flott auf den Punkt“, lachte Abaddon und bot Nybrass mit der Hand einen Platz in seiner Nähe an. „Setz dich und ich sagte dir, wieso du hier bist.“
„Danke.“
„Wie du weißt, rüste ich meine Truppen auf. Die Wächter auf der anderen Seite sind nachlässig geworden und ein Durchbruch zu den Lebenden ist möglich. Nur nicht sofort. Daher benötige ich einen Spion auf der anderen Seite, der meine Ankunft vorbereitet. Meine Wahl fiel auf dich, da ich nur Gutes von dir hörte.“ Er schwieg einen Augenblick und sah Nybrass durchdringend an. „Ich möchte, dass du auf die Erde zu den Menschen reist und dort erste Anschläge verübst. Lass sie zittern vor meiner Macht, stifte Verwirrung und Unsicherheit. Sie sollen sich bis zu meiner Ankunft nicht erholen, denn das mindert ihre Wachsamkeit. Verstehst du, Nybrass?“
Wieder ein intensiver Blick.
Nybrass nickte bedächtig. „Ich verstehe, Meister. Es ist eine große Ehre für mich, euch zu dienen.“
„Gut, das wollte ich hören. Um keine Zeit zu verlieren, reist du schon heute. Mein Diener Balor wird dich zum Portal bringen. Er sorgt auch für deine Ausrüstung.“
„Danke, Meister!“
„Sei erfolgreich. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite!“ Es klang fast wie eine Drohung und Nybrass zuckte leicht zusammen.
„Das hoffe ich doch, Meister“, beeilte er sich zu sagen.
„Geh nun mit Balor.“ Eine kurze Bewegung mit der Klaue und Nybrass war entlassen.
Er folgte dem buckeligen, hochgewachsenen Diener des Herrschers aus der Halle, durch ein Seitentor in die Ebene unterhalb des Palastes. Dort warteten vor einem hohen Stein schon zwei griesgrämig schauende Wächter, denen Balor einige Anweisungen erteilte.
„ Er hat die Erlaubnis zu passieren“, sagte er bestimmt. „Öffnet das Portal.“
„Es wird geöffnet.“ Der Wächter drehte sich um und berührte mit einem Edelstein, den er an einer Kette um den Hals trug, den Stein hinter ihm. Ein greller Blitz sauste über die Oberfläche und verursachte Risse in dem Gestein, durch die Licht schimmerte. Immer breiter wurden die Risse, bis der Stein förmlich in einer gewaltigen Explosion auseinander riss und ein wuchtiges Portal frei gab, in dessen Mitte es grün leuchtete.
Nybrass hatte mit Staunen zugesehen, wie es sich öffnete und sein Dämonenherz klopfte vor Aufregung, als ihm Gerüche nach Wald, Wasser und Tieren in die Nase stieg.
„Es ist so weit“, sagte Balor und überreichte ihm die Ausrüstung, ein großes Stoffbündel. „Das Tor steht in der Nähe einer großen Stadt. Die Menschen nennen sie Köln. Dorthin schickt dich Abaddon, um seine Ankunft vorzubereiten. Nimm dies, und geh mit höllischen Wünschen. Sobald deine Mission ausgeführt ist, warte auf weitere Anweisungen.“
„Danke. Ich werde ihn nicht enttäuschen, Balor.“
„Das hoffe ich doch. Er kann sehr nachtragend sein.“
Nybrass nickte, schulterte das Bündel und machte sich auf den Weg, die Erde mit Schrecken zu überziehen. Was ihn genau dort erwartete, wusste er nicht, aber seine Neugierde war groß und sein Tatendrang auch. Es war eine große Ehre, dafür auserwählt zu sein und er wollte Abaddon nicht enttäuschen.
Als er das Tor passiert hatte, tauchte er in einen dichten Wald ein, mit hohen Bäumen und Tieren, die er riechen konnte. Nur Menschen und Häuser, wie man es ihm gesagt hatte, fand er hier nicht. Etwas ratlos wanderte er weiter, weg von dem Portal, das sich bereits wieder geschlossen hatte.
Er spürte auf seiner Haut Feuchtigkeit und blickte nach oben. Zwischen den dichten Kronen der Bäume sah er bleigraue Wolken, aus denen Regen fiel.
„Wo bin ich hier nur gelandet“, murmelte er und sein Dämonengesicht verzog sich zu einer Fratze. „Bäume, wie ich es erträumte, Grün und Wasser. Nur die Stadt scheint weit weg zu sein. Ob Balor das falsche Portal geöffnet hatte? Mist, was mache ich bloß?“
Ratlos lief er weiter, bis er hinter all den Bäumen doch noch Häuser entdeckte.
Falsche Landung?
Während sich Nybrass überlegte, wie er am besten vorgehen sollte, um die Menschen zu verwirrten, weckte, nicht weit entfernt von ihm, eine junge Mutter ihre Tochter.
„Janina, es ist Zeit aufzustehen“, sagte Judith Reh und streckte den Kopf durch die Tür.
Die Achtjährige brummelte und drehte sich dann auf die andere Seite.
„Ich habe keine Lust. Darf ich nicht zu Hause bleiben, Mama?“
„Nein, heute ist Donnerstag und es ist Schultag. Also, raus aus den Federn, mein Schatz.“
„Schule ist doof“, meinte Janina und warf die Bettdecke zur Seite. „Der Tim ärgert mich immer.“
„Dann solltest du dich wehren. Sag ihm, er ist ein Feigling, wenn er dich ständig ärgert.“
„Das sagst du so! Tim ist viel stärker wie ich, der zieht mir ständig an den Haaren“, beschwerte sich Janina.
„Dann zieh zurück. Na komm, ich setz dich vor der Schule ab, dann brauchst du nicht mit Frau Resi und Sarah gehen.“
Immer noch verärgert, weil ihre Mutter sie nicht zu Haus ließ, schlurfte Janina ins Bad, während ihre Mutter das Frühstück zubereitete.
Leise summend füllte sie die Kaffeemaschine mit Wasser und Kaffeemehl, erhitzte Milch und schmierte Brote für sich und ihre Tochter.
Dabei dachte sie, wie schön es wäre, wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben, einen, der auch Janina akzeptierte und nicht gleich absprang, sobald sie von dem Mädchen erzählte.
„Und ich darf nicht zu Hause bleiben“, fragte Janina, als sie in die Küche kam. „Ich habe Bauchschmerzen.“
„Du schummelst, mein Schatz. Und ich kann nicht schon wieder wegen dir zu Hause bleiben. Frau Bauer schickt mir irgendwann die Kündigung, wenn ich zu viel fehle. Nein, du musst in die Schule gehen“, erklärte Judith bestimmt.
„Mir geht es aber nicht gut, Mama.“
„Lass mal sehen. Fieber hast du nicht, blass bist du auch nicht. Tut mir leid, ich kann dir keine Entschuldigung schreiben.“
„Ach, Menno. Dann haut mich der Tim wieder.“
„Du musst lernen, dich zu wehren, Janina. Es geht nicht anders. Du weißt, wie wichtig der Job für mich ist. Wenn ich ihn verliere, stehen wir beide bald auf der Straße. Ich habe nicht vor, vom Amt abhängig zu sein. Ok, auch jetzt haben wir nicht viel, aber mit Arbeitslosengeld ist es noch weniger. Willst du das?“
„Nein, aber der Tim….“
„Sprich mit der Lehrerin, Janina. Oder, besser ich rufe sie nachher an.“
„Dann sagt der Tim, ich bin eine Petzte und es wird noch schlimmer, Mama. Bitte, nicht anrufen. Ja?“
„Nun gut. Dann redest du mit der Lehrerin. Sie muss dir helfen.“
„Vielleicht“, seufzte Janina. Ihr stand wieder ein grauseliger Schultag bevor und wenn sie daran dachte, verstärkten sich ihre Magenschmerzen noch. Nur ihre Mutter sah das nicht ein.
Resigniert schnappte sich die Grundschülerin ihre Tasche und ließ sich von ihrer Mutter, in ihrem alten weißen Polo, zur Schule fahren.
„Bis heute Mittag, Janina. Es wird schon noch!“ Ermunternde Worte, die Janina nicht erreichten. Für sie war alles grau und trist.
„Hoffentlich.“ Mit mulmigen Gefühl stieg sie aus und ging zum Gebäude.
Nicht weit, und für die Menschen unsichtbar, beobachtete ein Dämon das Geschehen und schlüpfte in das Auto von Judith, sobald sich eine Gelegenheit bot.
Sie würde sicher wissen, was das für eine Stadt das war und wo das Einkaufzentrum lag, das er suchte.
Judith bekam von ihrem blinden Passagier wenig mit, nur der plötzliche Geruch von Hundekot ließ sie irritierte unter die Sitze schauen. War sie vor dem Haus in einen Haufen getreten? Oder vielleicht Janina?
Als sie nichts fand, riss sie das Fenster auf und startete den Wagen. Es wurde Zeit ihren Arbeitsplatz, einen Kindergarten zu erreichen. Sie war schon viel zu spät dran, wie sie erschreckt feststellte.
Trotz des Zeitdrucks achtete sie darauf, nicht zu schnell zu fahren, hielt an jeder Ampel und achtete auf spielende Kinder, die auf dem Weg zu Schule oder Kindergarten waren.
Endlich erreichte sie den Kindergarten „Pfauental“ und parkte in einer Seitenstraße den Wagen, denn es gab für Mitarbeiter keine Stellplätze in der Nähe.
„Hallo, Judith. Du bist spät dran“, sagte ihre Kollegin Marie. „Frau Bauer schaut schon grummelig. Halt dich besser von ihr fern.“
„Mach ich“, seufzte sie und verstaute ihre Sachen im Spint. „Du weißt, meine Tochter? Sie wollte heute nicht aufstehen, meinte sie würde in der Schule geärgert. Was soll ich bloß machen?“
„Sprich mit der Lehrerin. Die muss sich kümmern“, sagte Marie.
„Das will sie nicht. Janina denkt, es wird dann noch schlimmer.“
„ Aber danach besser. Überlege es dir, ja?“
Judith nickte. „Vielleicht rufe ich sie doch heute Mittag an. Es muss was geschehen, so geht es nicht weiter.“
„Gute Idee“, sagte Marie und kümmerte sich dann um ihre Gruppe, die „Dinozwerge“.
Judith arbeitete in anderen Räumen, ihre Schützlinge waren schon größer und gingen bald in die Schule. Bis zum Mittag wurde gespielt, getobt, gebastelt und draußen herum getollt, dann konnte die junge Frau ein wenig durch atmen, denn die ersten Kinder wurden abgeholt und der Rest der Bande ruhte sich nach dem Essen aus. Sie gehörten zu Familien, deren Eltern arbeiteten und ihre Kinder erst im Laufe des Nachmittags abholen konnten.
Judith räumte ihre Räumlichkeiten auf und überlegte, was sie morgen mit den Kindern spielen konnte. Noch war es Sommer, aber der Herbst war nicht mehr weit und einige Bäume bekamen bereits bunte Blätter. Besonders die Kastanien, obwohl es erst Ende Juli war.
„Ich gehe morgen mit den Kindern in den Wald“, erzählte sie Marie. „Blätter sammeln. Was machst du?“
„Vielleicht gehe ich auch mit, wenn Frau Bauer nichts dagegen hat. Im Wald waren wir seit dem Frühjahr nicht mehr. Ich sage den Eltern Bescheid, sie sollen den Kindern alte Sachen mitgeben.“
„Daran habe ich noch nicht gedacht“, meinte Judith nachdenklich. „Und Regenkleidung, falls die Wettervorhersage stimmt.“
Am Nachmittag war es deutlich ruhiger, da weniger Kinder in der Einrichtung waren. Trotzdem war Judith froh, als endlich ihr Feierabend nahte, denn ihre Tochter und deren Problem gingen ihr nicht aus dem Kopf. Mit der Lehrerein hatte sie mittags kurz gesprochen, doch schien es noch keine konkrete Lösung für das Problem zu geben. Frau Furk hatte zwar versprochen, mit Tim zu reden, aber Judith war nicht überzeugt, dass der Rabauke den Unfug ließ. Sie hoffte nur, dass es für Janina nicht wirklich schlimmer wurde.
Auf dem Weg zur Schule hielt sie erst an einem Laden, um einige Dinge fürs Mittagessen einzukaufen, dann fuhr sie weiter zur Schule, wo Janina schon wartete. Mit zerrissener Jacke und Lehmflecken auf der Hose.
„Wie siehst du denn aus“, rief Judith entsetzt.
„Tim“, flüsterte Janina weinerlich, dann lauter: „Warum hast du auch die Lehrerin angerufen? Jetzt ist es nicht nur Tim, sondern auch seine Clique. Ich hasse dich!“
„Hey, ich wollte dir nur helfen. Ist die Lehrerin noch da? Dann spreche ich mit ihr. Du wartest im Wagen.“ Mit Wut im Bauch stieg Judith aus. Die Sache musste ein für alle Mal geklärt werden, wenn Janina nicht mit Bauchschmerzen in die Schule gehen sollte.
Sie fand Frau Furk im Lehrerzimmer, wo sie sich mit einer Kollegin unterhielt.
„Kann ich sie kurz sprechen?“
„Ja, sicher. Worum geht es?“
„Janina und Tim. Haben sie gesehen, wie meine Tochter aussieht? Der Bengel hat ihre Jacke zerrissen und sie in den Matsch geschupst. Finden sie das in Ordnung?“
„Ich habe mit Tim gesprochen, wie besprochen. Und nein, ich hatte anderen Unterricht in den letzten Stunden.“
„Ich bin wirklich sauer. Wenn das nicht aufhört, muss ich mit Tims Eltern sprechen. So geht das nicht weiter! Janina hat jeden Morgen Bauchschmerzen!“
„Ich spreche morgen mit Tim. Auch mit seinen Eltern, wenn sie wollen. Wir finden eine Lösung.“
„Das hoffe ich“, schnaubte Judith. „Sonst gehe ich eine Abteilung weiter und schreibe nach Arnsberg!“
„Das brauchen sie nicht. Ich kümmerte mich darum.“ Warme Worte, die Judith nicht wirklich glauben konnte. Seit ihre Tochter in dieser Klasse war, gab es ständig Ärger mit Rabauken. Besonders Tim Houton war einer der schlimmsten. Doch Strafen gaben es für den Sohn einflussreicher Unternehmer nicht. Er tat, was immer ihm gefiel.
„Ok. Ich verlasse mich auf sie“, sagte Judith, dachte aber, dass sie trotzdem die Schulverwaltung anschreiben würde, sollte sich nichts ändern. „Schließlich hat auch meine Tochter eine Chance verdient und nicht nur so reiche Heinis wie dieser Tim.“
„Wir bevorzugen keinen“, verteidigte sich die Lehrerin erregt. „Oder wollen sie anderes behaupten?“
„Für mich sieht es so aus“, erklärte Judith, noch immer verärgert. „Nur weil ich als Kindergärtnerin arbeite, ist meine Tochter nicht weniger wert. Sie hat alles, was sie braucht. Auch eine Mutter, die Grenzen setzt. Was nicht jeder ihrer Schüler von sich sagen kann. Geld ist nun nicht mal alles.“
„Wie gesagt, bei uns wird niemand bevorzugt. Egal, was sie sagen. Wie versprochen rede ich morgen nochmal mit Tim und seinen Eltern. Mehr kann ich nicht tun.“ Jetzt war auch Frau Furk verärgert, was Judith an ihren blitzenden Augen sehen konnte. Doch sie hielt sich zurück und zeigte diesen Ärger nur durch den Klang ihrer Stimme. Nie würde ihr ein böses Wort über die Lippen kommen, dass ihre Position an dieser Schule gefährdete.
„Besser, wie nichts“, murmelte Judith und verabschiedete sich von der Frau.
Janina wartete bereits und fragte, wie es gelaufen sei.
„Sie wird noch mal mit Tim reden“, meinte Judith. „Fahren wir heim, Schatz. Ich bin echt müde und Hunger habe ich auch.“
Der Tag endete für Judith so, wie er begonnen hatte, mit Essen kochen und ihre Tochter versorgen. Erst, als Janina im Bett war, erlaubte sie sich zu weinen. Es war so schwer, ein Kind alleine groß zu ziehen, wenn nicht mal die Großeltern in der Nähe lebten.
„Wie soll das nur weiter gehen“, schniefte sie. „Und Janina ist erst acht. Ach, hätte ich doch nur Hilfe!“ Aber eine Antwort erhielt sie nicht, vorerst.
2.Kapitel
Der Einzug des Dämonen
In der Nacht hatte Judith seltsame Träume, von einem Mann, der in der Schlafzimmertür stand und sie beobachtete. Das merkwürdige an ihm war sein Gesicht, das einem Reptil ähnelte, mit flacher Nase und Schuppen statt Haut. Sonst wirkte er wie ein Mensch, groß und breitschulterig.
Eine seltsame Kälte ging von ihm aus und Judith bekam keine Luft.
Hustend und mit einem Druck auf der Brust, wachte sie auf und blickte sich verstört um. Nein, in der Tür konnte sie niemanden entdecken. Alles war still und dunkel.
Es war nur ein düsterer Traum, dachte sie und drehte sich auf die andere Seite. Da ist niemand, ich bin mit Janina alleine in der Wohnung. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, wollte nicht vergehen und zur Sicherheit schaute Judith zur Tür. Ein Schatten huschte durch den Flur, an ihrer Tür vorbei, zum Kinderzimmer.
Judith war zu Tode erschrocken und warf die Decke weg. Falls Einbrecher in der Wohnung waren, sollten sie ihre Tochter in Ruhe lassen. Der Instinkt der Löwin erwachte in ihr und sie wollte ihre Tochter beschützen.
Aber im Flur war niemand, auch in Janinas Zimmer nicht. Die schlief tief und fest, und schien nichts mitbekommen zu haben.
Leise schlich sich Judith in ihr Bett zurück. Bis zum Morgen waren es noch Stunden und sie wollte schlafen.
Kaum lag sie, klopfte es gegen die Wand. Laut und deutlich hörte sie das Geräusch. Mit klopfendem Herzen stand Judith wieder auf und sah nach, was es verursacht haben könnte. Sie fand – nichts.
„Ich bilde mir das nur ein“, flüsterte sie und schlüpfte wieder unter die Bettdecke. „Es gibt sicher eine rationale Erklärung dafür. Spannungen in den Wänden, zum Beispiel.“
Erneut klopfte es, dann hörte sie leise Schritte im Flur. Eine Tür quietschte, wieder Schritte. Diesmal aus dem Wohnzimmer.
Unruhig und ängstlich, es konnte ja doch ein Einbrecher sein, stand sie erneut auf und machte im Flur das Licht an. Dort war niemand, nicht mal ein Schatten. Judith ging weiter und blickte in das dunkle Wohnzimmer. Die Fenster waren geschlossen und zugezogen. So sehr sie sich umblickte, entdecken konnte sie niemanden.
Seufzend, denn es war bereits drei Uhr früh, kehrte sie in ihr Schafzimmer zurück.
Sie musste unbedingt schlafen, denn in wenigen Stunden begann ein neuer Arbeitstag, und den konnte sie nur ausgeschlafen überstehen.
Als sie im Bett lag, wurde es eiskalt im Schlafzimmer und ein kalter Hauch streifte ihr Gesicht. Judith spürte die Anwesenheit einer Person oder Präsenz, die sie nicht zuordnen konnte und die ihr, vor Angst, den Schweiß ausbrechen ließ, so böse fühlte sich dieses Wesen an.
„Wer ist da“, fragte sie leise und als Antwort kam aus einer Zimmerecke ein leises Knurren. Es hörte sich nicht nach einem Hund an, eher überirdisch und abgrundtief böse.
„Was willst du“, fragte Judith und sie musste schlucken. War sie wirklich so mutig? Sie fühlte sich vor Angst wie gelähmt und konnte sich nicht rühren.
Wieder dieses Knurren, diesmal lauter und warnend.
„Zeig dich, ich will dich sehen“, flüsterte sie, doch plötzlich verschwand der Druck von ihrer Brust und es wurde wärmer im Zimmer. Judith konnte das Wesen nicht mehr spüren und erschöpft schloss sie die Augen.
Das ist alles doch nicht wahr, dachte sie. Ich spinne. Glauben wird mir das nicht mal Marie und die kennt mich gut.
Es dauerte, bis Judith eingeschlafen war und ihr Wecker klingelte sie, in den schönsten Träumen, aus dem Bett.
Ein neuer Tag begann, nach so einer unruhigen Nacht.
Janina wecken und zur Schule bringen, danach in den Kindergarten, heute bis kurz
nach eins, denn es war Freitag.
Routine für die alleinerziehende Judith.
Im Kindergarten traf sie Marie, die gute Laune hatte und leise vor sich hin summte.
„Hey, gut geschlafen“, fragte Judith. „Du klingst so fröhlich!“
„Ja, habe ich. Rate mal, wen ich gestern in der Stadt gesehen habe? Da kommst du nie drauf, Judith.“
„Dein Schwarm Micha?“
Marie schüttelte den Kopf. „Kalt, ganz kalt. Rate weiter!“
„Ich weiß es nicht! Komm, sag schon!“
„Erinnerst du dich an den schönen Arne Groß? Er war bei uns auf der Schule.“
„Ja, an den erinnere ich mich zu gut, Marie. Und, hast du mit ihm gesprochen?“
„Nein. Dazu war er zu weit weg. Aber ich sah ihn mit einer Frau und einem Kinderwagen. Hat deine Janina ein Geschwisterchen bekommen?“
„Ehrlich, Marie. Das ist mir völlig egal, was dieser Schönling macht. Für seine Tochter bezahlt er nicht mal regelmäßig Unterhalt. Wenn ich nicht dauernd mit einem Anwalt drohen würde, bewegte er sich kein Stück. Nein, der kann mir doch gestohlen bleiben, der Fatzke!“ Wütend knallte sie ihre Tasche auf den Tisch.
„Du bist aber nicht gut auf ihn zu sprechen, dabei war er mal dein Schwarm!“
„Das ist vorbei. Er ist und bleibt ein Arsch, Marie.“
„Schon gut. So habe ich es nicht gemeint. Reden wir von etwas anderem. Karin ist krank. Übernimmst du ihre Gruppe?“
„Von mir aus. Aber ich muss pünktlich gehen, das habe ich Janina versprochen. Wir wollen Schuhe kaufen.“
„Kein Problem. Heute ist Freitag und die meisten Kinder sind bis mittags abgeholt.“
„Ok. Dann gehen wir es mal an, nicht“, meinte Judith und schloss ihre Jacke ein.
Karins Gruppe waren die „Heinzelmännchen“, Kinder von drei bis sechs. Es gab auch Problemkinder darunter, wie Max, der autistische Züge aufwies und nicht mit anderen Kindern spielen wollte. Stattdessen hockte er stundenlang in der Ecke und sortierte die Bauklötze.
Karin hatte ihre eigene Methode, den Jungen in die Gruppe zu intergieren, Judith gelang dies nicht so gut.
Viel zu schnell ging dieser arbeitsreiche Freitag vorbei und die junge Frau war froh, mittags endlich ihre Sachen packen zu können. Sie liebte ihren Beruf, doch nach fünf Tagen war sie müde und geschafft.
„So, ich bin dann mal weg“, rief sie Marie zu und verließ dann den Kindergarten.
„Ja, bis Montag!!!!“
Janina wartete schon vor der Tür, als Judith sich durch das Verkehrsgewühl gearbeitete hatte und vor dem Schulgelände hielt.
„Tut mir Leid, Süße. Der Verkehr! Wartest du schon lange?“
„Nö, nicht besonders. Die anderen sind aber alle schon weg.“
„Ich habe es nicht eher geschafft. Sorry! Fahren wir jetzt in die Stadt und kaufen deine Schuhe?“
„Von mir aus!“
„Das klingt nicht begeistert. Was ist los, Janina?“
„Tim, der ist los.“
„Ich dachte, das sei geregelt. Die Lehrerin hat es versprochen.“
„Ja, aber Tim ist sauer und hat mir mein Pausenbrot geklaut und es in den Mülleimer geworfen. Er sagte, wenn ich es wollte, solle ich es mir da raus holen!“
„Das hast du hoffentlich nicht gemacht, oder?“
„Was sollte ich machen? Meinen Kopf hat er auch hinein gesteckt.“
„Und die Lehrerin?“
„Die hat nichts gesehen und mit mir geschimpft, weil ich voller Bananenschalen war.“
„Frechheit. Diesen Tim knöpfe ich mir nächste Woche mal persönlich vor. Der kann was erleben!“ Judith war richtig sauer und hätte an liebsten gewendet, um mit Tims Eltern zu sprechen. Aber sie hatte ihrer Tochter Schuhe versprochen, das ging vor.
„Bitte nicht, Mama. Du machst es noch schlimmer“, flehte Janina mit Tränen in den Augen.
„Es geht echt nicht so weiter, Schatz. Sieh dich doch an, wie du wieder aussiehst. Willst du ihn gewinnen lassen?“
„Nein, aber er ist viel stärker wie ich. Und er hat Freunde.“
„Du nicht?“
„Doch, aber Tim ist echt fies. Er hetzt sie gegen mich auf.“
„Blödmann! Wenn ich mit ihm fertig bin, weiß er nicht, ob er männlich oder weiblich ist! Den nehme ich mir Montag zur Brust!“
Schließlich erreichten sie das Parkhaus in der Stadt. Von dort waren es nur wenige Schritte bis zum Laden. Aber es dauerte, bis ihre Tochter die richtigen Schuhe gefunden hatte. Weiße Sneakers mit Einhörnern darauf sollten es sein. Die zu finden, glich einem Suchspiel. Denn alle anderen lehnte Janina ab und bettelte, sobald ihre Mutter ihr sagte, sie habe keine Lust mehr zu suchen.
„Bitte, ich weiß, dass es die hier gibt“, bat sie und Judith gab nach.
Nach dem Schuhkauf gab es Pommes und Bratwurst, denn zum Kochen blieb heute keine Zeit. Auch wenn nicht viel Geld in der Kasse war, musste es jetzt so sein. Schließlich versuchte Judith so sparsam wie möglich zu leben.
Ziemlich müde und geschlaucht kehrten die zwei in ihre Wohnung zurück, vorbei an einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad, nicht weit von ihrem Mehrfamilienhaus entfernt.
„Ist er tot“, fragte Janina und deutete auf den verhängten Unfallort.
„Ich weiß es nicht“, antwortete Judith und folgte dem Verkehrsstrom, der durch die Polizei-und Rettungswagen gestaut wurde. „Wünschen würde ich es ihm nicht.“
Sie warf nur einen kurzen Blick zu den Sanitätern, die bemüht waren, den Verletzten zu versorgen. Eine Barre wurde herbei gebracht und der Mann darauf gelegt. Judith konnte in der Nähe des Motorrades einen Mann sehen, der das Ganze unbeteiligt verfolgte. Was sie aber erschreckte war, das die Polizisten ihn offensichtlich nicht sehen konnten, denn sie gingen einfach durch ihn hindurch. Nur kurz warf der Mann Judith einen Blick zu, als sie langsam vorbei rollte. Es schien ihr aber, dass er ihr etwas zurief, das wie „Hilfe!“ klang, denn er bewegte seinen Mund.
Ein Schauer lief durch ihren Körper und sie sah weg.
Dann war sie vorbei und ihr Zuhause in greifbarer Nähe. Judith parkte ein und versuchte, das gerade erlebte zu verdrängen. Zu schrecklich waren die Bilder gewesen.