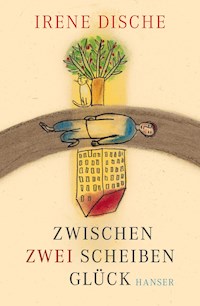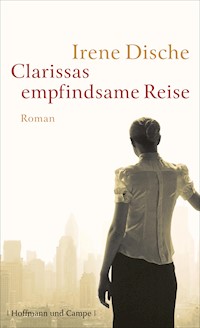8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist Geschmackssache. Manche Menschen mögen's süß, manche scharf, und andere sind sowieso immer sauer. Irene Dische hat 25 Liebesgeschichten geschrieben und in drei Kapitel unterteilt: Himmel, Fegefeuer, Hölle. Sie enden traurig oder sie gehen glücklich aus - doch überraschen tun sie alle. Da ist ein glücklich verheiratetes Ehepaar, das vorzeitig auseinandergerissen wird, doch im Himmel lebt ihre Beziehung weiter. Dort angekommen ist auch eine alte trauernde Witwe, die ihren verstorbenen Ehemann schmerzlich vermisst und ihr Geld verschenken will, aber von niemandem ernst genommen wird. Im Fegefeuer hingegen schmort die Beziehung eines Paares, das sich gegenseitig zu Tode langweilt und dennoch nichts daran ändert. Und dann gibt es den selbstverliebten Schönling in Gesellschaft gleich mehrerer Frauen: Die Liebelei mit seinem Spiegelbild lässt ihn einsam und allein durch die Hölle irren. All diesen Geschichten liegen wahre Begegnungen und Begebenheiten zugrunde. Irene Dische hat daraus kunstvoll ein Hohelied der Liebe komponiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Irene Dische
Lieben
Erzählungen
Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser und anderen
Hoffmann und Campe Verlag
Sad Endings
Traurige Enden
Romeo und Julia
Niemand hinderte Romeo und Julia am Heiraten. Im Gegenteil, alle freuten sich. Romeo war schon achtundzwanzig und Julia achtzehn. In Romeos Frankfurter Wohnung wurde mit den Verwandten, die aus Nürnberg und Teheran angereist waren, ausgelassen gefeiert, dann folgten die Hochzeitsnacht und noch einige Nächte mehr. Romeo und Julia waren zufrieden mit dem Lauf der Welt. Nur die Augenblicke, in denen sie getrennt waren, missfielen ihnen sehr. Wenn Julia nicht in Reichweite war, wurde Romeo von Visionen heimgesucht. Er sah Julia vor sich, ein zierliches Mädchen mit schwerem, schwarz schimmerndem Haar, »wie Lava« (Romeo), und seine Hände halluzinierten, wie sich ihre Haut anfühlte, diese »scheinbar kühle, aber immer warme Haut« (noch einmal Romeo), und in jedem Winkel der Erinnerung suchten seine Augen nach den ihren – diesen braunen Augen, die ihrem noch jugendlich runden Gesicht seinen Schwerpunkt gaben und aus ihr das »schönste Mädchen in der Familie« machten (so die übereinstimmende Meinung der Familie). Wenn er nicht mit ihr sprechen konnte, unterhielt er sich im Kopf mit ihr, und dort antwortete sie immer.
Julia war weniger romantisch, pragmatischer. Wenn sie nicht mit Romeo zusammen war, betrachtete sie das Hochzeitsfoto. In dem Augenblick, als es entstanden war, hatten sie noch ein bisschen Angst gehabt, einander zu umarmen, aber man sah schon, wie vollkommen sie zueinanderpassten. Obwohl Romeo »so groß« war (Julia), fast eins fünfundsiebzig, volle fünfzehn Zentimeter größer als seine Frau, war er schlank und geschmeidig. Majestätisch »wie Seidenfächer« (Julia) klappten seine langen Wimpern vor den scheu dreinblickenden braunen Augen auf und nieder. Sie machte ihm Komplimente, weil er nicht in Testosteron ertrank wie die meisten anderen Jungen. Er war aus dem Iran nach Amerika gegangen, hatte dort fünf Jahre allein gelebt und für sich selbst gesorgt, so gut es bei seiner Unbeholfenheit in praktischen Dingen ging. Er war kaum imstande, eine Glühbirne einzuschrauben. Schließlich jedoch hatte ihn sein Job als Programmierer nach Frankfurt gerufen, und dort hatte er Julia kennengelernt, die bald verkündete, sie werde sich von nun an um ihn kümmern. Jede Minute ohne Romeo erschien ihr als eine schändliche Zeitverschwendung.
Sehnsucht kam allerdings nur selten auf, weil es nun, da sie verheiratet waren, nichts mehr gab, was sie für länger als ein paar Stunden voneinander fernhielt. Und so hatten sie keinen Grund zur Klage. Auch wenn sie sich Mühe gegeben hätten – ihnen wäre keiner eingefallen.
Sie lebten zurückgezogen, bescheiden, hatten noch keinen Wagen, kleideten sich geschmackvoll, aber dezent, als wollten sie nicht bemerkt werden. Romeo hatte nur einen Stolz – eine große Krawattensammlung. Zur Hochzeit schenkte er Julia ein richtiges Kostüm, wie es in Amerika Frauen in leitender Stellung tragen. Mit Büroarbeit kannte sie sich aus und träumte davon, eines Tages eine wichtige Position einzunehmen, vielleicht als Managerin. Sie war nicht in Deutschland geboren, sondern als Kind ins Land gekommen und hatte trotz ihres deutschen Schulabschlusses keine Arbeitserlaubnis. Sie arbeitete dennoch – als Putzfrau – und behauptete, Hausarbeit sei hauptsächlich Management.
Romeo und Julia lebten zweieinhalb Wochen zusammen. Sie gingen zusammen zur Arbeit und richteten sich den Tag so ein, dass sie zusammen nach Hause kamen. Dort half er ihr aus dem neuen Wollmantel, und sie half ihm beim Aufknoten einer seiner fantastischen Krawatten. Sie kümmerte sich um all das, was ihm so schwer von der Hand ging, und er brachte ihr kleine Geschenke mit. Sie aßen immer gemeinsam. Wenn sie nicht zusammen waren, dann warteten sie mit dem Essen, das heißt, sie ließen das Mittagessen ausfallen. Und sie schliefen immer zusammen ein. Doch eines Tages wurde Romeo auf einen Posten in einer Niederlassung seiner Firma in Los Angeles berufen. Jemand hatte dort unerwartet gekündigt, und die Stelle musste so schnell wie möglich neu besetzt werden. Romeo besaß eine Greencard. Niemand zweifelte daran, dass Julia mitkommen würde. Romeo blieben nur wenige Tage, um seine Angelegenheiten in Frankfurt zu regeln. Julias Eltern waren entsetzt. »Warum denn nach Amerika?«, wollten sie wissen. – »Esel haben eben keine Ahnung, wie gut Obstsalat schmeckt«, entgegnete Julia. Sie konnte sehr bissig sein, auch gegenüber ihren Eltern. Romeo beeilte sich zu erklären: In Amerika würde Julia endlich eine Arbeitsgenehmigung bekommen. In Amerika würde sie fließend Englisch sprechen lernen. In Amerika würden sie einen Wagen haben und eine gemeinsame Zukunft, die noch besser war als die Zukunft, die sich ihnen in Frankfurt eröffnete – und außerdem war das Wetter in Amerika alles in allem besser, wärmer.
Julias Eltern seufzten, versprachen, sie würden zu Besuch kommen, und organisierten ein Fest. Ohne auf den Preis zu achten, kauften sie ihnen zum Abschied zwei besonders große, besonders stabile, besonders rote Koffer mit vielen Taschen und komplizierten Reißverschlüssen und machten schüchterne Witze, nun müsse sich ja wohl Julia um die ganze Packerei kümmern, weil Romeo … Er war eben unbeholfen. Fröhlich machten sich die beiden auf den Weg zum amerikanischen Konsulat, um für Julia ein Visum zu beantragen.
Dort sagte man ihnen, weil Julia keine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland besitze und kaum zwei Wochen verheiratet sei, sei sie nicht automatisch berechtigt, Romeo zu begleiten. Bürokratie verbarrikadierte den Weg. Es könnte ein Jahr dauern, bis Julia ein Visum bekäme, vielleicht länger. Da die beiden von Anfang an gesagt hatten, dass sie in Amerika bleiben wollten, verweigerte man Julia am Ende auch das Touristenvisum.
»Trockene Kötel bringt man nicht zum Glänzen«, sagte Julia, als sie das Konsulat verließen. »Abwarten«, beruhigte Romeo sie und geleitete sie durch den Schnee nach Hause. »Du kennst Amerika nicht. Amerika ist ein Land der Ausnahmen. Anders als hier. Wir werden einen gemeinsamen Antrag stellen und alle unsere Gründe aufschreiben, warum wir unbedingt zusammen reisen müssen. Für den eigentlichen, den wahren Grund hat jeder Verständnis.«
So gelang es Romeo, Julias Befürchtungen zu zerstreuen. In dem Antrag auf Ausstellung einer Aufenthaltsgenehmigung für seine Frau brachte er dann sein fließendes Englisch zum Glänzen. Es blieb ihnen nur noch eine Woche, und Romeo kündigte die Wohnung. Sie machten sich einen Spaß daraus, immer neue Zukunftspläne zu entwerfen, während sie gleichzeitig ihre wichtigste Habe in zwei Koffern verstauten, für jeden einen. Sie hatten beschlossen, Amerikaner zu werden. Julia besorgte ein Exemplar des obligatorischen Geschichtstests und fragte Romeo ab. »Welche Farben hat die Nationalflagge?« war einfach. »Wie viele Sterne?« war auch nicht schwer. Als Romeo einen Prospekt zugeschickt bekam, der zeigte, wo seine Firma sie beide in der Nähe von Los Angeles unterbringen wollte, hängte Julia ihn an die inzwischen kahle Wand ihres Wohnzimmers. Voller Stolz ließ Romeo alle Freunde, die vorbeikamen, das »perfekte Firmenapartment« bewundern, spielte den Experten und erklärte jedem, was eine »Wohneinheit mit kontrolliertem Zugang und integrierter Einkaufs-Plaza« war, worin die »Kabel-TV-Grundversorgung« bestand (150 Kanäle) und wie groß ein »King-Bett« war. Eines der Fotos zeigte das Paradies: einen Swimmingpool mit Palmen.
Sie feierten lange und tranken auf ihr neues Zuhause. Am nächsten Tag erwachten sie mit Kopfschmerzen, und Julia mit ihren achtzehn Jahren meinte, jetzt hätten sie das Alter der Mäßigung erreicht. An diesem Nachmittag wartete sie nicht an der Straßenecke, wo sie sich sonst immer trafen. Romeo stürmte allein nach Hause und fand sie zusammengerollt auf dem Sofa, das Gesicht nass und zerknautscht. Sie wollte nicht aufstehen und nichts sagen, aber er bekam das Papier zu fassen, das sie in der geballten Faust hielt, ein Schreiben der amerikanischen Einwanderungsbehörde. Julias Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung war glatt abgelehnt worden.
Romeo nahm Julia in die Arme und versuchte sie zu trösten. »Auch wenn man eine Million Mal ›Halwa‹ sagt, wird einem der Mund davon nicht süß«, sagte sie zu ihm. »Du musst etwas tun. Es kann doch nicht sein, dass eine Sache, bei der es um Leben und Tod geht, von einem Visum abhängt.«
Am nächsten Tag betraten sie das amerikanische Konsulat zum zweiten Mal, und diesmal machte Romeo am Empfang eine Szene. Er rief, so laut er konnte: »Wir verlangen ein Visum für meine Frau.« Sofort war man bereit, eine Ausnahme zu machen: einen Termin mit dem »zuständigen Beamten« innerhalb von nur zwei Tagen. »Es wird der Konsul selbst sein«, sagte Julia. »Den Amerikanern sind Anfragen in letzter Minute immer am liebsten«, sagte Romeo. Am Tag nach dem Termin ging ihr Flug. Julia hatte noch kein Ticket, weil man ohne Visum keines kaufen konnte. Aber Romeos Ersparnisse reichten. Er rief bei der Fluggesellschaft an und reservierte für sie einen Platz in der Businessclass. Er sagte, den habe sie verdient, was sie erröten ließ.
Inzwischen hatten sie in ihrer Wohnung nur noch eine Matratze und die Koffer. Sie machten den verabredeten Ausflug zum amerikanischen Konsulat. Die Sekretärin kam auf sie zu, und ihre Worte waren wie eine Handvoll Kiesel, die sie ihnen ins Gesicht schleuderte. Leider. Infolge unvorhergesehener Umstände. Der Termin. Abgesagt. Der zuständige Beamte verhindert. Sitzungen. Niemand im Haus. Romeo saß bloß da. Julia fing an zu schluchzen. Zu der Sekretärin sagte sie: »Wenn das Schicksal gegen einen ist, beißt man sich auch an Marmelade die Zähne aus.«
Worauf die Sekretärin wütend wurde und zur zusammenhängenden Rede zurückfand: »Junge Frau, hier geht es nicht um Schicksal, sondern um Visavorschriften.« Doch dann griff die Traurigkeit, die aus den braunen Augen hervorquoll und sich über die kindlichen Wangen ergoss, auch nach dem steinernen Herzen der Sekretärin. Sie musste wegsehen, sonst hätte auch sie angefangen zu weinen. »Bitte, Madam, wecken Sie unser Glück auf«, flehte Julia sie an. Die Sekretärin verschwand und kehrte wenig später lächelnd zurück. Julia flüsterte Romeo triumphierend zu: »Ich habe eine grausame Sekretärin zum Lächeln gebracht!« Diesmal rieselten die Wörter der Sekretärin wie Hochzeitskonfetti auf Romeo und Julia herab. Zufällig. Ein Glücksfall. Der Vizekonsul gerade gekommen. Unerwartet. Hier entlang, bitte. Ein lächelnder Mann hinter einem blanken Schreibtisch. Er reichte Julia ein Papiertaschentuch. »Ich will sehen, was ich für Sie tun kann. Ich melde mich heute Nachmittag.«
Es war das Letzte, was sie von ihm hörten. Alle Versuche, ihn anzurufen, endeten bei einer automatischen Bandansage mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, von denen keine passte. Am nächsten Morgen kamen Romeos Kollegen, um das Paar abzuholen und die letzten Sachen aus der Wohnung zu räumen. Dass es noch Kleider und einige Dinge gab, die er nicht mitnehmen wollte und die sie untereinander aufteilen sollten, lenkte sie ab. Erst als sie schon im Auto saßen, fragten sie ihn, wo denn Julia sei. Romeo beruhigte sie: »Es hat eine kleine Verzögerung mit ihrem Visum gegeben. Julia hat sich darüber sehr aufgeregt, deshalb habe ich sie zu ihren Eltern gebracht. Da bleibt sie, bis sie nachkommen kann.« Am Flughafen checkte er mit den beiden neuen roten Koffern ein und ging an Bord der Lufthansamaschine nach L.A. Er saß allein, sah sich zwei Filme an, aß alles, was man ihm vorsetzte. Am Tag des Sieges ist niemand müde.
Nach der Ankunft in Los Angeles schlenderte er durch die Passkontrolle und beschleunigte seine Schritte erst auf dem Weg zur Gepäckausgabe. Ruckelnd kamen die beiden roten Koffer in Sicht. Er wuchtete sie auf einen Kofferkuli. Niemand sah ihm dabei zu. Niemand sah, wie er einen der Koffer öffnete und mit der Hand hineinlangte. Niemand sah, wie seine Hand zurückfuhr, wie ihn Übelkeit überkam, wie er sich plötzlich in die eigene Hand biss, wie er zitterte.
Es bemerkte auch niemand, wie er von einem der Koffer die Gepäckbanderole abriss und in die Tasche steckte, wie er ihn zum Laufband zurückschob, als handele es sich um eine Verwechslung. Andere Koffer tauchten auf, aus Seoul, aus Singapur, aus Tokio. Es wurde Abend, bevor jemandem der rote Koffer auffiel, der auf dem Gepäckband immer noch einsam seine Bahn zog. Man nahm ihn herunter und rollte ihn ins Fundbüro. Unterdessen hatte Romeo längst den für ihn reservierten Mietwagen gefunden, war über verschiedene Highways zu seiner neuen Bleibe gefahren, hatte seine Krawatten aus dem Koffer genommen, hatte sie zusammengebunden und um den beheizten Handtuchhalter in seinem Luxusbad geschlungen und hatte es trotz aller Unbeholfenheit ohne Weiteres geschafft, sich zu erhängen.
»Unbekannte Schöne in herrenlosem Koffer« lautete die Schlagzeile am nächsten Tag. Der Leichenbeschauer klassifizierte sie als weiß, jung und weiblichen Geschlechts. Der Tod hatte sie von zwei Seiten in die Zange genommen: in erster Linie durch Quetschung infolge des Gewichts anderer Gepäckstücke. Der Koffer war doch nicht so stabil gewesen. Während des Fluges jedoch musste er zuoberst gelegen haben. Der Tod hatte sich Zeit gelassen und war erst beim Ausladen eingetreten, als sie schon wegen Unterkühlung im Sterben lag. Als einige Tage später auch Romeos Leiche entdeckt wurde, fand man in seiner Manteltasche die fehlende Banderole. Das Rätsel war gelöst, was inzwischen aber niemand mehr wissen wollte, und so bekam es nur noch ein paar Zeilen in einer Lokalzeitung.
Dies ist eine wahre Geschichte, nur die Namen wurden verändert.
Die Decke
Einer der Risse war seit letzten Sonntag breiter geworden. Ein halber Zentimeter in drei Tagen, mal nachrechnen, sagte sich Simone. Sie hatte viel Zeit. Dieser Riss bildete die lange Seite von einem unordentlichen Trapez aus lauter Rissen direkt über ihrem Bett. Sie hatte dem Trapez den Namen von Max gegeben, der vor ein paar Jahren verschwunden war. Sein Gesicht hatte eine ähnliche Form gehabt, aber geliebt hatte sie ihn trotzdem. Ein hässliches Gesicht war ihr lieber als ein hässlicher Körper, und Max war drahtig gewesen. Drahtig und amüsant. Wenn sie ihn an der Decke sah, amüsierte sie sich noch immer.
Max war da oben nicht allein. Die Lampe leistete ihm Gesellschaft – der Kleine Raik, wie Simone sie nannte, weil aus dem mit Gips verkleisterten Loch in der Decke mehrere Kabelenden hervortraten und die Lampe unansehnlich herunterbaumelte, eigentlich bloß ein Kabel mit einer nackten Glühbirne, die ein grelles, dummes Licht verstrahlte. Seit Jahren wollte sie sie herunternehmen und etwas Hübscheres anbringen, aber sie war nie dazu gekommen. Die Decke war sehr hoch, und um die Lampe zu erreichen, brauchte sie eine höhere Leiter. Ein halber Zentimeter in drei Tagen bedeutete, dass sich der Stuck pro Tag um fast zwei Millimeter verschob. Vielleicht war in der Wohnung darüber jemand herumgehopst und hatte den Vorgang beschleunigt. Vielleicht würde er sich jetzt wieder verlangsamen.
Raik, ihr Mann, war groß genug. Er konnte die Lampe erreichen, der sie den Spitznamen Kleiner Raik gegeben hatte. Aber er ließ sich nicht dazu bringen, etwas zu reparieren, das sie repariert haben wollte. Er bastelte gern an irgendwelchen Sachen herum, aber nicht wenn sie ihn darum bat, und sie hatte den Fehler gemacht, ihn zu bitten, und damit nur seinen Unwillen geweckt. Immer glaubte er, sie wolle ihn herumkommandieren. Doch diese Decke war ihre Decke, und dieses Zimmer war ihr Zimmer. In seinem Zimmer war alles in Ordnung. Wenn ihm dort eine Lampe nicht gefiel, wechselte er sie aus. Er wurde wütend, wenn Simone ihm einen Tipp gab, der sein Zimmer betraf. Einmal hatte sie ihm vorgeschlagen, den Schreibtisch nicht vor das Fenster zu stellen, weil sich die Vorhänge dann schlecht öffnen und schließen ließen. Er hatte gesagt: »Mein Zimmer geht dich nichts an«, hatte den Schreibtisch vor das Fenster gestellt und die Vorhänge immer zugelassen.
Das hier war also ihre Decke. Der Anblick weckte in ihr das gleiche angenehme Wiedersehensgefühl, das sie früher beim Anblick ihres Balkongartens gehabt hatte. In dem Jahr, als sie Max kennenlernte und mit ihm ein Leben in einem richtigen Haus mit einem richtig großen Garten plante, hatte sie auf ihrem Balkon nichts gepflanzt. Und im Jahr darauf, als es diesen Plan nicht mehr gab, hatte sie den Balkon gemieden. Blumen machten ihr keine Freude mehr. Jetzt machte ihr die Decke ein bisschen Freude. Drüben am Fenster hatte sie sieben feine Risse, die nach verschiedenen Richtungen auseinanderliefen. Simone nannte die Risse Laura. Sie erinnerten sie an Lauras Haare, die sie an der Jacke und der Hose ihres Mannes gefunden hatte.
Raik war stolz auf Laura gewesen, weil sie zweiunddreißig Jahre jünger war als er. Er hatte sich ihretwegen aber auch geschämt, weil sie nichts Besonderes war, eine Assistentin in seinem Büro, nicht sonderlich hübsch, mit einer piepsenden Stimme. Sogar die Sekretärinnen machten sich über sie lustig. Deshalb musste Raik die Affäre geheim halten. Aber er war verrückt nach ihr gewesen, und der Altersunterschied machte ihn fast hysterisch vor Glück, denn er bestätigte seine Vermutung, dass er selbst in Wirklichkeit noch gar keine dreiundsechzig, seine Frau aber schon eine alte Jacke war. Einige Monate lang war es ihm gleichgültig gewesen, dass Simone abends oft allein wegging – nach dem Abendessen, denn ein häusliches Leben hatten sie noch geführt. »Du Ärmste, deine Augenbrauen werden langsam grau«, sagte er über dem Nachtisch, bevor er ins Bad ging und sein Gebiss bürstete, was er nur tat, wenn er Laura besuchen wollte. Beim Weggehen rief er dann: »Ich gehe noch mal ins Büro.« Simone konnte seine Heimlichtuerei kaum übersehen. Eines Tages nahm er einige Notenhefte seiner Mutter aus dem Bücherschrank und verließ mit ihnen das Haus. Zu diesem Zeitpunkt wusste Simone schon von Laura und stellte sich vor, Raik habe sie überredet, Gesangsunterricht zu nehmen, so wie er zwanzig Jahre früher auch sie überredet hatte. Raiks Mutter war Gesangslehrerin gewesen, und er konnte so sachkundig über Lieder sprechen wie sonst kaum jemand. Wenn das Trapez namens Max weiter in diesem Tempo absackte, zwei Millimeter am Tag, würde es bald seinen Halt verlieren. Es würde abstürzen. Wie schwer mochte ein Brocken Stuck von dieser Größe sein?
Laura hatte sich bald wieder von Raik zurückgezogen und einen Liebhaber in ihrem Alter genommen. Raik war deprimiert gewesen, war aber darüber hinweggekommen, indem er sein Zimmer renovierte und außerdem darauf bestand, dass seine Frau ihm nun treu war und jedes Mal, wenn sie aus dem Haus ging, genau erklärte, wohin sie wollte. Er fand es nicht fair, dass sie eine Affäre hatte, wenn er keine hatte. Er wolle wieder glücklich verheiratet sein, verkündete er.
Sie hatte sowieso gerade mit Alfonso Schluss gemacht. Alfonso war noch herrischer als Raik gewesen – aber drahtig. Raik nahm mit seinem Körper jetzt den ganzen Platz ein.
Simone sah nach der Decke über der Tür. Dort war sie sauber, nicht verunstaltet. Keine Risse, nichts. Ein reiner Tisch. So wünschte sich Simone ihr Leben. Sie war fünfundvierzig und hatte sich schon mehrere Spritzen geben lassen, um die tiefe Falte zwischen ihren Augen zum Verschwinden zu bringen. Die Falte war aber immer wiedergekommen – eine Hieroglyphe für Traurigkeit.
Eines Tages werde ich vielleicht wieder richtig glücklich sein, dachte sie. Hoffentlich, bevor mir Max auf den Kopf fällt. Man konnte wirklich nicht vorhersagen, wie lange es noch dauern würde. Dazu hätte sie sein Gewicht herausfinden und sich verschiedene physikalische Gesetze klarmachen müssen. Natürlich konnte sie auch einen Maler kommen lassen, damit er die Decke in Ordnung brachte. Ihr fiel die Freude ein. Mit Max war sie überglücklich gewesen. Er hatte natürlich gewollt, dass sie Raik verließ und für immer mit ihm zusammenlebte. Raik war in Tränen ausgebrochen, als sie es ihm sagte, und sie hatte den Plan sofort fallen gelassen. Sie hatte Max die Wahrheit gesagt: dass sie ihn liebte, wie sie noch nie einen Mann geliebt hatte. Dass sie es aber nicht übers Herz brachte, einen Menschen so unglücklich zu machen, nicht einmal ihren Ehemann. Max hatte ihr nicht geglaubt und die Höchststrafe verhängt – er hatte kein Wort mehr mit ihr gesprochen.
Ein Maler würde wahrscheinlich wollen, dass die Möbel aus dem Zimmer geräumt wurden. Er würde eine Woche brauchen, um die Stuckdecke in Ordnung zu bringen. Für 18 Euro die Stunde. Und dann würde er noch zwei Tage anhängen müssen, um die schmutzigen Wände neu zu streichen. Ihr Glück mit Max war von kurzer Dauer gewesen. Aber es war eine Suche wert, und vielleicht ließ es sich wiederfinden. Das machte alles in allem 18 mal 7 mal 8 Euro – also zusammen …? Auch bei Alfonso hatte sie das Glück gesucht, aber er war nicht der Richtige. Sie hatte ihm wehgetan, aber es hatte ihr nicht viel ausgemacht, denn sie hatte bemerkt, dass es auch ihm nichts ausgemacht hätte, ihr wehzutun – sie hatte bloß eher damit angefangen. Keine Chance auf Glück. Falls sie es je wiederfand, würde sie es nicht mehr loslassen. Raik war fast fertig. Er stöhnte laut. Er ackerte.
Am Ende tat es immer weh. Er vergrub sein Gesicht an ihrem Hals, und seine Schulter versperrte ihr die Sicht auf die Decke. Er war schwer und roch ein bisschen ranzig. Er tat ihr leid, weil er so ein Rüpel war. Jeden Sonntag und jeden Mittwoch kam er zu ihr, die Vaseline in der Hand. Sie mochte es nicht, wenn er sie küsste oder aufwärmte, weil es zwecklos war und weil sie die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen wollte. Ihm war es recht so. Er reichte ihr die Vaseline, zog sich schwungvoll aus und machte sich über sie her. Danach begann für sie dann die stille Zeit mit der Decke. Wenn diese Phase dem Ende zuging, wurde sie immer ungeheuer traurig. Raik tat ihr leid, weil er so ein schlechter Liebhaber war und weil er so dick war und eine Glatze hatte. Wenn sein Stöhnen richtig laut wurde, begann sie leise zu weinen. Ihr liefen jedes Mal die Tränen über die Wangen, während er die Zielgerade herunterdonnerte.
Nachher brauchte er immer ein paar Minuten, blieb auf ihr liegen und schnappte nach Luft. Er begrub ihr Gesicht in seiner Achselhöhle, deshalb hielt sie die Augen so lange geschlossen. Schließlich richtete er sich ein wenig auf, wischte ihr mit seiner schweren Hand die Tränen aus dem Gesicht und rollte zur Seite. Sie sah nicht zu ihm hinüber. Sie verabschiedete sich von der Decke. Er stand auf, sammelte seine Kleider ein und wollte nach nebenan, in sein Zimmer. »Da sind wir nun zwanzig Jahre verheiratet und ficken noch immer, was das Zeug hält«, sagte er stolz. »Zwei Mal die Woche. Ich wette, von meinen Kollegen bringt das keiner.«
Wie Huseyn gefasst wurde
Nachdem er Dr. Smith so getroffen hatte, wie der es verdiente, nämlich sauber ins Herz, mit einer einzigen Kugel aus kürzester Entfernung (zwei Zentimeter – er war kein geübter Schütze), nachdem er vor Schreck über den Knall ein paar Schritte zurückgetaumelt war und dann die Leiche untersucht hatte (eine Schweinerei auf dem Linoleumboden der Praxis), nachdem er kurz die Kasse durchwühlt und geplündert und ein paar Medikamente zusammengerafft hatte (alles, um die Polizei in die Irre zu führen), nachdem er die Tür der Praxis geöffnet und wieder geschlossen hatte und hinter das Lenkrad seines kleinen Flitzers geglitten war, griff er voller Zärtlichkeit nach dem Objekt, dem augenblicklich seine ganze Zuneigung gehörte, einem neuen, aufklappbaren Handy mit Farbdisplay, und wählte die Nummer der Polizei.
Es war Jahre – Jahrzehnte – her, seit er zum letzten Mal jemanden erschossen hatte. Also hatte er sich aus diesem Anlass eine neue Pistole und ein neues Handy zugelegt. Das Handy war teuer gewesen, mit eleganten kleinen Tasten, und er wollte es behalten. Die Pistole dagegen musste er wegwerfen. Deshalb war sie auch nur aus zweiter Hand (einer seiner Söhne hatte sie geklaut). Er betrachtete die Pistole mit betrübter Miene, während er es bei der Polizei läuten ließ.
Als er dann sprechen konnte, klang seine Stimme aufgeregt. Verständlicherweise. Er erklärte ihnen, sein Wagen habe schlappgemacht, in einer düsteren Seitenstraße, die fünf Meilen entfernt auf der anderen Seite der Stadt lag, und als er AAA, den Autoclub, angerufen habe, da hätten sie ihn in einer Warteschleife hängen lassen (durchaus wahrscheinlich). Er verlangte, sie sollten sofort jemanden vorbeischicken, da die Gegend gefährlich war (er wusste, sie würden mindestens zwei Stunden brauchen). Dann warf er die Pistole durch das offene Wagenfenster in ein Gebüsch, ließ das Handy in seinen Schoß plumpsen und betätigte den Zündschlüssel mit einem Schwung, als würde er ein neues, besseres Leben anschalten. Er hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, während er seinem Rendezvous entgegenfuhr – entweder mit der Polizei oder mit der American Automobile Association oder mit keiner von beiden. Wahrscheinlich würde er noch mal anrufen müssen.
Sein Alibi war solide wie ein Ziegenknie.
Selbst wenn die Polizei ihn mit Dr. Smith, der seine Tochter unerlaubterweise gebumst hatte, in Verbindung bringen würde, selbst wenn sämtlichen fünf Angehörigen von Dr. Smiths Familie und sämtlichen zweiundsechzig Mitgliedern von Huseyns Familie sofort klar war, wer den Mord begangen hatte, würde die Polizei doch wissen, dass er unschuldig war. Er war ja nicht dort gewesen, er hatte fünf Meilen entfernt in einem kaputten Auto auf die Polizei gewartet.
Huseyn stimmte einen Triumphgesang an. »Lo, lo, lo«, sang er, »ich habe diesen Esel in einen Stall befördert, wo das Heu anders schmeckt, als er es gewohnt war.« Er sang immer lauter und lauter, und seine Stimmung stieg von Block zu Block. Er probte die Ansprache, die er vor der versammelten Familie halten und in der er sich vor allem an Nuri, seinen ältesten Sohn, wenden würde, den Automechaniker. Ach, ihr Lieben! Die Sünde des Blutes ist getilgt, die Ehre des Clans ist wiederhergestellt, und dem Mädchen soll seine Schandtat verziehen werden, es ist im Schoß der Familie wieder willkommen. Eigentlich, so würde er fortfahren, wäre das ja eine Aufgabe für einen jüngeren Mann gewesen, einen Bruder, aber es war doch so heikel und habe so viel Leidenschaft aufgewühlt, dass er, das Oberhaupt des Clans, gemeint habe, es sei besser, wenn kein Hitzkopf, sondern ein älterer Mann seine Zeit und seine Kraft aufwenden und sich mit seinen älteren, weiseren Gedanken um die Sache kümmern würde. Kurz, seine Wahl sei auf ihn selbst gefallen. In der Fabrik arbeite er ja schon lange nicht mehr, er sei auch schon längst nicht mehr so stark wie Nuri und nicht so gut im Umgang mit technischem Kram und Pistolen – aber er sei eben schlau. Und diesmal sogar ungeheuer schlau!
Seine Stimmung stieg noch immer, während er »Lo, lo, lo« sang. Hatte er sie nicht beide gerettet – seine Tochter vor diesem widerwärtigen Fremden und seinen Sohn ebenfalls? Nuri saß wegen tätlicher Beleidigung in Haft, weil er versucht hatte, seiner Schwester Vernunft einzubläuen, nachdem sie beschlossen hatte, Dr. Smith zu heiraten. Nuri hatte Verantwortungsgefühl – und wenn er erst wieder frei wäre, hätte er es noch mal versucht. Der Clan hatte die Ehe mit einem Außenstehenden, der obendrein noch Christ war, natürlich verboten. Das kam davon, wenn man die Mädchen studieren ließ. Keine Aufsicht. Ein Vetter hatte sie in der Schlange vor einem Kino gesehen, zusammen mit einem blonden Mann. Er stand hinter ihr und hatte die Arme um sie gelegt. Seine Hände waren nur ein paar Zentimeter von ihren Brüsten entfernt gewesen, und bestimmt hatten diese Hände in diesem Augenblick die Wärme ihres Körpers gespürt. Sie hatte den Kopf nach hinten gelegt gegen seine Brust, als wäre er ihr Lieblingskissen. Sie hatte gemerkt, dass sie gesehen worden war, und am nächsten Tag angerufen und von Dr. Smith erzählt. Sie hatte geklungen, als sei sie stolz auf ihn. Seine Eltern, die Smiths, akzeptierten sie voll und ganz und würden sie sogar »Tochter« nennen. Huseyn hatte sie zum Abendessen eingeladen, sie allein. In Bluejeans war sie die Treppe zur Wohnung der Familie heraufgetänzelt, mit wippendem schwarzem Haar und Glanz in den Augen. Sie benutzte neuerdings kein Make-up mehr und sah deshalb noch jünger aus, als sie war. Nachdem sie die versammelten Verwandten geküsst hatte, hatten Huseyn und die Jungen sie zu ihrem Zimmer geleitet und eingesperrt. Sie hatte mit ihrem Handy die Polizei angerufen – und ausnahmsweise waren sie mal schnell gewesen. Die Beamten hatten sie aus dem Zimmer befreit, hatten sie ihren Eltern gestohlen und zu Dr. Smith zurückgebracht. Wie sich herausstellte, war er schon ihr Mann. Nach seinem Autounfall, nachdem Nuri sich die Bremsen seines Wagens vorgenommen hatte, nachdem Dr. Smith überlebt und seinen Verdacht zu Protokoll gegeben hatte, hatte das Paar Polizeischutz bekommen.
Das war alles schrecklich falsch. Aber er, der Vater, hatte alles wieder wunderbar richtig gemacht.
Und Huseyns Erregung wuchs weiter und weiter, während er sich seine Tat noch einmal in Erinnerung rief und wie der Doktor ihn angesehen hatte, als er abdrückte. Huseyn wandte sich an Dr. Smith, der nun kein Abendessen mehr vor sich hatte. »Du Schurke, du hast bekommen, was du verdienst! Vielleicht hätte ich weniger Angst haben sollen. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen können. Ich hätte dich so töten können, dass du mehr davon mitbekommst als nur diesen Bruchteil von einer Sekunde. So viel Rücksicht hast du gar nicht verdient. Ich hätte dich fesseln und dir die Sache erklären und dich ein bisschen zwirbeln sollen. Das hätte mir Spaß gemacht. Aber nein, es hat mir auch so Spaß gemacht. Spaß genug. Dieser Anruf bei der Polizei war meine Idee, eine gute Idee. Mit einem einzigen Schuss und einem einzigen Anruf habe ich die Familie gerettet. Lo, lo, lo.« Und er sang weiter, während er fuhr.
In der schmalen Straße, die er der Polizei genannt hatte, stellte er seinen Wagen so hin, dass es nach einer Panne aussah – wie Nuri ihm geraten hatte, als er ihn im Gefängnis besucht hatte. Huseyn schraubte ein Rad ab und versuchte es zu ersetzen. In diesen Dingen war er nicht besonders geschickt. Sonst half ihm immer Nuri oder einer der Vettern, der auch Automechaniker war. In dieser Familie half jeder jedem. Dieses natürliche Gleichgewicht hatte Dr. Smith durcheinandergebracht.
Die Polizei kam. Die Beamten waren sehr höflich. Einer streckte ihm die Hände entgegen, als wollte er ihn begrüßen. Aber er legte ihm Handschellen an, verschnürte ihn wie ein Huhn auf dem Markt und erklärte ihm dabei seine Rechte. Huseyn hörte sich protestieren. Es klang wie ein Gackern. Einer der Polizisten sah sich das Handy an und lachte. Er hielt es Huseyn unter die Nase und sagte: »Vollidiot. Du hast es nicht abgestellt.« So hatten sie Huseyn gefasst – sie hatten sein Geständnis mit angehört, eine Livesendung aus seinem neuen Handy.
Dr. Smith blieb am Leben. Seine Frau nicht. Eine Woche nachdem ihr Bruder seine Haftstrafe wegen Tätlichkeit abgesessen hatte, schlich er seiner Schwester bis in einen Supermarkt nach und schoss auf sie. Er zielte ihr ins Gesicht. Jetzt sitzt er in der Todeszelle. So verlor Huseyn beide Kinder. Diese Geschichte ist so alt wie die Berge. Trotzdem ist ihre Moral noch immer nicht zu haben.
Die Ballade vom schönen Frank
Jedes Mal wenn Frank jemanden kennenlernte, stellte er sich die Frage: Wie kann dieser Mensch mir nützen?
Meistens war die Antwort klar. Männer konnten ihn bewundern, ihn hofieren, ihn zum Essen einladen, ihm ihre Autos leihen und ihre geräumigen Stadtwohnungen oder ihre Landhäuser überlassen. Frauen ebenso. Er suchte die Gesellschaft reicher Männer und unkonventioneller reicher Frauen und schaffte es tatsächlich ins mittlere Alter, ohne dass er je Miete und Autoversicherung gezahlt und Quittungen für das Finanzamt sortiert hätte und ohne eine Ehe eingegangen zu sein – denn dieses Kompliment wollte er keiner Frau machen. In unseren modernen Zeiten lebte er wie ein Fürst. Wie gelang ihm das?, werden Sie fragen. Worin bestand sein Geheimnis? Wünscht sich nicht jeder von uns ein derart behagliches, sorgenfreies Leben?
Frank war schön. Er hatte faustdickes blondes Haar, dolchblaue Augen, ein fein geschnittenes Gesicht, das immer starken Eindruck machte, und einen hochgewachsenen Körper, der aber nicht ungelenk war, sondern geschmeidig, beweglich, gut geölt. Er war Schauspieler. Kein besonders begabter, aber wegen seines guten Aussehens reichte es für Fernsehserien, und die Leute merkten sich ihn. Die Art, wie er damit rechnete, bewundert zu werden, verdiente tatsächlich Bewunderung – er hatte Charisma und gab gerne den Ton an. Der Teufel interessierte sich für diese Mischung und spielte mit dem Gedanken, ihn in die Politik zu schicken. Frank hatte das Zeug, eine Menge Unheil anzurichten. Aber das hatten andere auch. Zuletzt ließ der Teufel Frank dann doch im Privaten sitzen.
Dort kümmerte sich des Teufels Foltermeisterin, die Zeit, um ihn. Sie schickte andere gut aussehende Gesichter, die an Franks Stelle rückten. Mit vierzig war Frank noch immer eine stattliche Erscheinung, aber nicht mehr die stattlichste. Er hatte weiche Zähne. Beim Publikum geriet er nach und nach in Vergessenheit. Wenn ein Produzent die Wahl hatte, nahm er einen anderen.
Franks Stern sank, aber seine Haltung anderen Menschen gegenüber blieb die gleiche. Als sein Geld knapp wurde, stellte er die Frage – Was habe ich davon? – nur umso dringlicher. Mit dreißig traf er schließlich eine strategische Entscheidung und legte sich eine Freundin zu – Agnes. Agnes kam im Leben gut zurecht. Sie war schon fünfunddreißig, aber eine temperamentvolle Brünette mit akademischer Ausbildung, die er bewunderte. Sie arbeitete in der Verwaltung eines Forschungsinstituts. Sie betete den schönen Frank an, weil er so exotisch war und weil er litt – ein Künstler –, und sie war bereit, dafür zu zahlen. Ein schöner Zug von ihm: Frank war kein Lügner, er sagte ihr nie, dass er sie liebte. Aber er lebte mit ihr in ihrer hübschen Wohnung und schätzte ihre Lebhaftigkeit. Er teilte mit ihr die Freude an einer guten Flasche Wein und einem gefüllten Teller. Er liebte teures Essen, und wenn es aufgetragen wurde, nahm er sich unweigerlich zuerst. In seinem Kleiderschrank sah es aus wie in einer Boutique.
Ein paar Jahre später zog ihn ein Produzent noch einmal in die engere Wahl für eine Fernsehserie. Aber nachdem er ihm schon so viel Hoffnung gemacht hatte, dass Frank Agnes von einem neuen Engagement erzählt und begonnen hatte, seine Garderobe zu erneuern, nahm er dann doch einen anderen. Da beschloss Frank, sich selbstständig zu machen. Von nun an wäre er sein eigener Produzent. Agnes sollte sich um den Papierkram und die Finanzen kümmern – auch um das Geld für neue Kronen auf seinen Schneidezähnen, und zwar bevor es mit den Dreharbeiten losging. Bald hatte er fast sämtliche Ersparnisse von Agnes für seinen Film verbraucht. Die letzten tausend Dollar, die er für einen Spezialeffekt benötigte, wollte sie ihm nicht geben. Ihr alter VW musste repariert werden. Als der Film floppte, schob er es auf ihren Geiz. Sie ihrerseits verlangte nie etwas von ihm, denn sie wusste, er würde Nein sagen. Aber sie nahm, was sie kriegen konnte – sie wurde schwanger. Er war furchtbar wütend, aber sein eigenes Kind umbringen wollte er dann doch nicht. Bald waren es dann schon mehrere Kinder. Frank blieb zu Hause, bei den Kindern und einem Kindermädchen, das er umgarnte und mit seinem strahlenden Lächeln verführte, während Agnes arbeitete und Geld verdiente. Als sie es nicht schaffte, an der Uni eine Stelle zu bekommen, die ihrer Qualifikation entsprach, nahm sie eine geringer bezahlte an. Langsam wurde sie unansehnlich, aber ihm machte das nichts aus – ein schöner Zug: Hässlichkeit bei einer Frau war ihm egal, ihn interessierte sein eigenes Aussehen, nicht das von jemand anderem. Anders verhielt sich die Sache, als Agnes auch ihre schlechtere Stelle verlor und die Situation daheim ungemütlich wurde.
Er lernte Barbara kennen, noch nicht unansehnlich, obwohl zehn Jahre älter als er. Sie war finanziell besser ausgestattet und hatte eine geräumige, elegant eingerichtete Wohnung in einer repräsentativen Straße. Frank verließ seine Familie und zog zu Barbara. Sie hatte eine gut dotierte Stelle, und sie hatte Format, sie war Juraprofessorin. Sie fuhr einen teuren Sportwagen. Sie lebten mit Stil. Er brauchte kein Geld zu verdienen, und für all seine Bedürfnisse wurde gesorgt. Liebend gern nahm ihm Barbara lästige Arbeit ab. Sie schrieb sogar Briefe für ihn, weil er mit dem Computer nicht zurechtkam. Sie fand seine Unbeholfenheit reizend. Er brauchte nicht mal mehr eine Armbanduhr zu tragen oder den Kopf zu heben und auf die Uhr im Zimmer zu sehen – er fragte einfach: »Wie spät ist es, Süße?«, und ihr war es ein Vergnügen, ihm den kleinen Dienst zu erweisen. Mal ehrlich: Das ist doch beneidenswert, oder? Aber eines Tages wurde sie dann doch etwas strenger. Sie weigerte sich, einen Brief für ihn zu schreiben, sagte ihm, er solle es selbst versuchen. Zum Glück war seine frühere Freundin Agnes immer noch so barmherzig, einzuspringen. Also zwängte er sich nun, lang und schlaksig, wie er war, in Barbaras schnittiges Auto und besuchte jedes Mal seine Kinder, wenn er Schreibarbeiten für ihre Mutter hatte. Er schob es auf Agnes’ Gutmütigkeit, dass sie sich die Zeit nahm und ihm half – nach der Arbeit, auch wenn sie gerade beim Putzen war oder sich um die Nachkommen kümmerte. Als Barbaras teure Waschmaschine kaputtging, brachte Frank auch seine Wäsche zu Agnes, die sie in ihrer alten Maschine wusch, zum Trocknen aufhängte und dann auch noch für ihn bügelte. Als er wieder bei Barbara war, sagte er ihr, Agnes sei großzügig. Er wollte damit sagen: großzügiger als du. Die gute Agnes verlangte nicht mal Unterhalt für die Kinder von ihm. Sie lebte von wenig oder nichts, aber sie beklagte sich nie.
So erreichte er das vierzigste Lebensjahr – und sein blondes Haar war immer noch dicht. Die Furchen auf seiner Stirn verliehen ihm eine attraktive Nachdenklichkeit, und noch immer trieb ihn die Frage um: Was können die anderen für mich tun? Barbara hatte ihn aus der Ärmlichkeit seines früheren Zuhauses gerettet, doch nun bemerkte er, dass sie knickerig wurde, ein Charakterzug, der ihm, wie er sagte, völlig fremd sei. Sie machte ihm eine Szene, weil er die Kronen seiner Schneidezähne nicht genügend pflegte und sie noch einmal erneuert werden mussten. Sie wollte nicht bezahlen. Er hatte den Verdacht, dass sie Geld vor ihm versteckte. Das ganze Universum durchlief gerade eine wenig glückliche Phase. Die Nahrungskette war verunreinigt. Mikrowellenherde verursachten Krebs. Er war deprimiert und schlief schlecht. Sein Gesicht war unaufgeräumt, und aus dem Haus ging er nur, um Leute zu treffen, die ihm Bewunderung entgegenbrachten. Er erzählte Barbara von seinen »Fans« – ein Wort, das er liebte. Das Leben bestand für ihn eigentlich nur aus den Episoden, in denen ein »Fan« ihm etwas Anerkennendes sagte. Die Schuld an seiner Faulheit gab er seinem Pech, dem Umstand, dass das Filmgeschäft lahmte, und sein Pech machte ihn wütend. Wenn er keine Fans besuchte, wusch er sich auch nicht, weil Waschen die Haut austrocknet. Es ärgerte ihn, als Barbara anfing, sich nach billigerem Wein umzusehen.
Sie schlug vor, er solle sich eine Arbeit suchen. Sie machte ihm eine große Liebeserklärung: Es sei ihr egal, was er täte, von ihr aus könne er als Hausmeister arbeiten, sie würde ihn trotzdem lieben. Er sagte ihr nicht, dass er sie liebte – weil er es nicht tat. Er war noch immer ehrlich. Wütend machte ihn auch die Missachtung seines Künstlertums, die in der Empfehlung gipfelte, er solle sich irgendeinen Job suchen. Er wusste, dass Barbara in aller Ruhe gutes Geld verdiente, indem sie genau das machte, was sie sowieso gerne tat.
Als die verlassene Agnes ihn eines Tages mit der Bitte um einen Beitrag zum Unterhalt der Kinder überraschte, gab er die Anfrage an Barbara weiter und war empört, als sie es ablehnte, etwas zu zahlen. Er klagte über den leeren Kühlschrank in der Wohnung seiner Kinder, aber sie ließ sich nicht erweichen. Sie sagte: »Such dir eine Arbeit, und mach ihnen den Kühlschrank wieder voll.« Noch einmal sagte er ihr, sie sei geizig – doch nun hatte er es ein Mal zu oft gesagt. Die Klinge seines Tadels war stumpf geworden. Sie hinterließ keinen Schnitt und nicht mal einen Stich, sie ließ Barbara nicht zerknirscht, sondern nur wütend werden, und so ging ihre Beziehung nach und nach in die Brüche. Er fing an, sich nach einer anderen, großzügigeren Frau umzusehen. Die Teufelin Zeit brachte ihn mit Carola zusammen, fünfzehn Jahre älter als er, aber immer noch frisch aussehend, weil sie reich war und sich jede Schönheitskur leisten konnte. Sie war Malerin und tat den ganzen Tag nur das, was ihr Spaß bereitete.