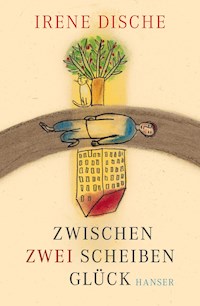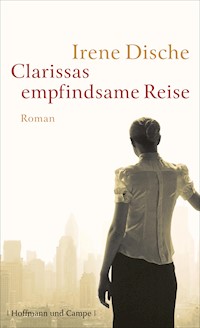9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wer die Bücher von Irene Dische liest, weiß, dass er es mit der Speerspitze der zeitgenössischen Prosa zu tun hat.« The New York Times Manche Geheimnisse sind so groß, dass wir sie nicht nur vor der Welt, sondern auch vor uns selbst verstecken müssen. Es beginnt als Liebesgeschichte. Im New York der frühen 70er Jahre werden Lili und Duke ein Paar: Sie, die Tochter einer weißen Intellektuellen-Familie, mit allen Möglichkeiten aufgewachsen, die sich jedoch für die Arbeit als Krankenschwester entschieden hat und er, der schwarze junge Mann aus dem Süden. Sie leben eine Liebe, die verheerende Zerstörung in Kauf nimmt und doch alles zu verzeihen scheint. Während Duke zu einem gefeierten Weinexperten avanciert, wird die verträumte Lili als Model entdeckt. Ihr gemeinsames Leben entwickelt sich schnell zu einem rasanten Auf und Ab, voller Möglichkeiten, Verführungen, Rückschläge. Ihre Liebe scheint jedoch unzerbrechlich. Erkennt Duke jede noch so kleine Facette eines besonderen Weines, so entgehen ihm meist die Hintergedanken und Manipulationen der Menschen. Ganz anders Lili, die wie gemacht scheint für das Spiel mit der Oberfläche, das die Mode- und Werbewelt beherrscht. Beide verlassen sich aufeinander, doch hinter Lilis Schönheit, ihrem Charme, ihrer Klugheit und Raffinesse, verbirgt sich nicht zuletzt eine mörderische Wut, die alles und jeden zu verschlingen droht. Mit Schwarz und Weiß durchschreitet Irene Dische die letzten drei Jahrzehnte des letzten Jahrtausends, um nichts weniger als unsere Gegenwart auszuleuchten. Was als großartiger, scharfsinniger wie auch scharfzüngiger New York-Roman beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer brillanten Auseinandersetzung mit Projektionen und Heilsversprechen, mit individuellen Träumen und sozialen Realitäten. Ein Roman, der große Fragen stellt, ohne sich der Illusion auf Antworten hinzugeben. »Eine Abrechnung mit dem Amerikanischen Traum und, nebenbei bemerkt, tolle Unterhaltung.« Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Irene Dische
Schwarz und Weiß
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Elisabeth Plessen
Hoffmann und Campe
Im Land der Freien ist vieles streng geregelt, manches aber, obgleich es einfach zu steuern wäre, bleibt dem Zufall überlassen, oder wie immer man die blutige Hand nennen will, welche die Würfel wirft. Schon die Liebe macht das deutlich. Und so geschah es eines Tages: Lili traf Duke.
Ich bin’s. Jo.
Hier bei uns unten im Süden haben die Landstraßen keine schicken Namen wie Broadway oder Park Avenue. Sie tragen Nummern wie die Kettensträflinge, die sie gebaut haben, und sehen genauso freudlos aus. Die Landschaft ringsherum ist auch nicht groß anders. Egal ob Sommer oder Winter, sie ist grün. Grün ist die Farbe der Fruchtbarkeit, heißt es. Kann man mal drüber nachdenken, wenn man sich hier verirrt hat, wie Duke Butler damals. Er war von seiner hohen Position in New York geflohen, Richtung Süden, so weit nach unten, wie es ging, bis er schließlich in Florida, dem dicken Schwanz Amerikas, in der denkbar merkwürdigsten Klemme feststeckte.
Die Butlers waren schwarz und weiß, was hier keine sehr beliebte Farbkombination ist, und die weiße feine Dame trat gerne großspurig auf. Sie kauften zusammen ein normales Eigenheim an einer Landstraße, aber sie musste es aufhübschen. Während ihr schwarzer Mann Geld verdiente, beseitigte die Hausherrin den grünen Schleim auf dem Teich, ein unfassbarer Aufwand, um ihr Spiegelbild darin sehen zu können. Dann schmückte sie das Ufer mit giftigen pinken Orchideen. Dahinter setzte sie Lilien. Die Alligatoren türmten. Sie pflanzte einhundert ausgewachsene Orangenbäume. Ihr süßer Duft verbreitete sich meilenweit, und jeder wusste, woher er kam. Dann strich sie das graue Betonhaus golden an, damit es im Sonnenschein strahlte. Nach Sonnenuntergang leuchtete das Haus im Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos. Und schließlich hängte sie ein schmiedeeisernes Schild mit der Aufschrift »Palace Versailles« über die Einfahrt. Es hatte den gleichen Schwung wie das Eingangsschild über Auschwitz, und reimte sich sogar mit ihm. Außer mir bemerkte das aber niemand.
Alle gratulierten ihr. Trotzdem spürte jeder die merkwürdigen Schwingungen und tuschelte hinter ihrem Rücken, der Ort sei verflucht. Bei der Nummer 1865 an der Country Road 510 mussten sie an den 10. Mai 1865 denken, an den schwarzen Tag, an dem Florida vor den Nordstaaten kapituliert hat. Diese Geschichte liegt hier in der Luft. Der Ärger begann, sagten sie, gleich mit der Ankunft von »Mr. & Mrs. Butler« in Versailles. Sie sprachen den Namen des Ortes falsch aus – »For sales« statt »Verseil«. Gleich in ihrer ersten Nacht fing auch das Sterben an, als Jugendliche aus dem Ort mit ihrem Motorrad gegen die riesige alte Eiche neben der Einfahrt knallten. Die Armen flogen durch die Luft und hingen dann wie Lametta von den Zweigen runter.
Okay, kann jeder Einfahrt passieren. Ein paar Wochen später aber, Lilis Umgestaltungen waren schon in vollem Gang, kam ein Schulbus voller Kinder ins Schlingern, krachte gegen die Eiche und fing Feuer. Der Baum brannte ab, und irgendein Schlaumeier beklagte im Lokalfernsehen den Verlust einer 500 Jahre alten Virginia-Eiche, als wäre das schlimmer als das, was einem Haufen Achtjähriger passiert war. Na ja. Das sind also unnatürlich viele Todesfälle, rechne die überfahrenen Tiere nicht mal mit. Es passte jedenfalls ins Bild, als Duke Butler verhaftet wurde und den Namen »Das Monster von Versailles« verliehen bekam.
Am Tag, als er zum Tode verurteilt wurde, explodierte das goldene Haus der Butlers, und das Sterben hörte endlich auf. Ein »FOR SALE«-Schild tauchte am Straßenrand auf und blieb dort stehen, bis es verrottet war. Aus der Country Road 510 wurde wieder eine langweilige Strecke Teer.
Natürlich wollte niemand, der bei Verstand war, dort wohnen oder auch nur etwas bauen. Es vergingen fünf Jahre. Duke lebte im Todestrakt vor sich hin. Nichts Besonders dabei, in Florida leben dort Hunderte. 2005 kaufte ich Mrs. Butler das überwucherte Grundstück ab – ein Schnäppchen – und schaffte mir einen schönen neuen Wohnwagen an. Das »Palace Versailles«-Schild war verrostet; ein paarmal mit dem Besen draufgehauen, und es fiel runter und wurde von den Sträuchern am Straßenrand verschluckt. Die Natur gibt nichts auf schicke Dinge – Mäuse und Kaninchen hatten die Blumenstauden aufgefressen, die Alligatoren eroberten das Seeufer zurück, und der Boden verschlang die Orangen. Von dem Blockhaus war nichts mehr übrig, von den schlechten Schwingungen auch nicht. Bei mir hätten die eh keine Chance.
Soll ich mich jetzt vorstellen? Mein richtiger Name ist Jutta, Jutta Bolin. Für mein Alter sehe ich phantastisch aus. Ich bin blond, Single, Raucherin und verstehe was von engen Jeans. Mit Cowboystiefeln. Manchmal hört jemand meinen leichten Akzent und fragt, wer ich »wirklich« sei. Wenn ich nicht sage »Verpiss dich«, sage ich: »Griechin.« Eine Notlüge. Bei Deutschen gehen die Leute immer vom Schlimmsten aus.
Tatsache ist, seit ich Alkohol trinken darf, lebe ich auf ein paar wenigen Quadratmeilen im Süden. Hier nennt man mich »JO«, mit einem großen O bitte, oder »Mom«. Hier habe ich Buchhaltung gelernt und auf Gott zu vertrauen – statt auf die Regierung. Hier muss man sich das Glück nur greifen, kostenlos. Alles, was man dafür tun muss, ist »loslassen«. Das ist die Kurzform von »loslassen und auf Gott vertrauen«. Die Leute wissen, dass das ein guter Deal ist, und die meisten sind mit ihrem Schicksal zufrieden. Sie machen das Beste daraus.
Ein Beispiel. Mein Pastor, Pastor Mark Smith, war früher Lastwagenfahrer. Als seine Frau im dritten Monat war, sagte ihr der Arzt, dass das Baby einen genetischen Defekt habe – es werde fünfmal so groß wie normal, aber ohne Gehirn. Wenn sie es nicht abtreiben lasse, werde es sie in Stücke reißen und trotzdem tot auf die Welt kommen. Aber die Smiths wollten keinen Mord an ungeborenem Leben begehen. Sie beteten Tag und Nacht zu Gott, er möge die Ärzte Lügen strafen. Das Baby wuchs und wuchs, und sein Kopf blieb so klein wie ein Smartie. Sie beteten einfach weiter. Man sagte ihnen, es sei ein Junge, und sie waren zuversichtlich. Bei der Geburt riss er Mrs. Smith in Stücke. Ihr Mann begrub das zwanzig Pfund schwere, hirnlose Baby hinter dem Haus, unter einer Gedenktafel, auf der »Unser Engel« stand, während die Mutter im Krankenhaus heilte. Als sie die sechsstellige Krankenhausrechnung nicht bezahlen konnten und ihr Auto und ihr Haus »verloren«, ließen die Smiths trotzdem nicht den Kopf hängen. Sie nahmen an, dass der Herr sich schon was dabei gedacht hatte. Sie sagten »Danke, Jesus!«, zogen in ein Obdachlosenheim und gingen jeden Tag zur Kirche, um sich noch mehr bei Jesus zu bedanken.
Bald darauf ließ Mark das Lastwagenfahren sein, besorgte sich per Post ein Predigerdiplom und machte seine eigene Kirche auf. Jetzt hat er einen Haufen Geld, ein abbezahltes Eigenheim, einen weißen Cadillac und einen Monster-Truck. Glaubt mir: Es tut gut, wenn man alles akzeptiert, was einem passiert. Duke Butler merkte das auch irgendwann und gab den Kampf auf. Versucht es mal, sagt einfach mal »Ich bin glücklich«, ganz egal, was grade passiert. Dein Leben wird sich enorm verbessern.
Zurück zu mir – ich bin hart im Nehmen. Katastrophen machen einen Bogen um mich. Wenn überhaupt, dann versuchen sie, mir einen Gefallen zu tun. So wie der große, böse Wirbelsturm, der mir letzten Monat ein Geschenk vor die Tür gelegt hat. Das war einer dieser trockenen Twister, die auf einen Sprung vorbeikommen, wenn der Sturm in der Ferne vorübergezogen ist und man nicht mehr mit ihm rechnet. Schlich sich in der Nacht an und weckte weder mich noch meinen Hund. Erst am nächsten Morgen, als ich mir auf der Veranda die erste Zigarette anzünden wollte, packte mich die Angst. Das Streichholz brannte ganz herunter und sengte meinen Daumen an. Der komplette Orangenhain war verschwunden, puff!, und der Boden war mit etwas bedeckt, das wie eine hübsche Schneewehe aussah. Mein Hirn sprach zu mir: hey, wir sind nicht mehr in Berlin, kleine Jo, dafür ist es zu heiß, über dreißig Grad, es muss etwas anderes sein.
Ich zündete meine Zigarette an. Die weiße Decke kräuselte sich leicht. Es war Papier. Massen davon. Wären es Dollarscheine gewesen, dann wäre ich jetzt schon reich. Die Blätter waren nummeriert, genau wie Dollarscheine, und weil ich dachte, dass sie wertvoll sein könnten, sammelte ich sie ein. Ich sollte erwähnen, dass ich auch einen rostigen alten Safe gefunden habe; die Tür war abgebrochen und lag ein paar Meter daneben. Den habe ich auch aufgehoben, könnte ja sein, dass jemand den kaufen will. Ansonsten schicke ich ihn Duke Butler ins Gefängnis, als kleinen Scherz.
Während ich darauf wartete, dass der Kaffee kochte, sortierte ich die Blätter. Ja, ich bin sehr ordentlich. Als ich fertig war, war der Kaffee kalt. Ich weckte meinen alten Pitbull, Ulysses, benannt nach meinem ersten Ehemann, gab ihm sein Frühstück, nahm den Kaffee, den Papierstapel und eine Schachtel Newport und machte es mir auf der Holzschaukel gemütlich. Schaukelte ein bisschen. Rauchte ein bisschen. Streichelte den Hund. Fühlte mich sehr wohl. Nahm mir schließlich die Papiere vor. Und gleich auf der ersten Seite ging es um mich.
Die Blätter waren von Lili Butler vollgeschrieben, in einfacher Blockschrift, die Buchstaben nach rechts gebeugt, als ob sie es eilig hätten. Sie hatte über Jahre ein Tagebuch über ihre Ehe geführt, die sie gleich auf der ersten Seite als »wunderbarste und schönste Beziehung seit Pocahontas und John Smith« beschrieb. »Das Schreiben über einen selbst ist wie der Blick in einen Spiegel. Eine Pose. Der Spiegel soll lügen.« Das verstehe ich sehr gut. Man fixiert sein Gesicht, neigt sich etwas zurück, damit die Backen nicht hängen, lächelt mit dem halben Mund, damit der braune Backenzahn nicht sichtbar ist. Und man ist blöde genug, dem Spiegel zu glauben. Aber Lili Butler wollte wieder mal eine Ausnahme sein. Ihr Tagebuch sollte nur die Wahrheit beinhalten. »Keine Posen. Keine Lügen. Ich will Duke und mich so sehen, wie wir wirklich sind.« Die Wahrheit schloss sie in einen Safe. Als ihr Haus in die Luft flog, nahm sie an, dass die Wahrheit auch verbrannt war. Aber da hat sie sich gründlich getäuscht.
Lili hat einen Hochschulabschluss, aber dumm ist sie trotzdem. Jeder, der einen Krieg erlebt hat, wie ich als Kind in Deutschland, weiß, dass bei einer Explosion manchmal alles verbrennt und manchmal nicht. Meine Theorie geht so: Als das goldene Haus der Butlers vor zehn Jahren explodierte, wurde der Safe hinauskatapultiert, bevor ihn die Flammen erfassen konnten, und dann machte das Haus einen Kopfstand. Begrub den Safe unter sich. Niemand kam auf die Idee, die Trümmer wegzuräumen, und die wilde Natur zog wieder ein. Der Tornado von letzter Woche hat alle Sträucher und Bäume weggefegt. Er hat den rostigen Safe ausgegraben und geknackt und seinen Inhalt in die Lüfte gewirbelt. Und dann habe ich diese Blätter auf meinem Stück Land gefunden. Deswegen gehören sie jetzt mir.
Einen Tag später schickte mir Jesus eine »Autorin« aus New York. Ich darf euch jetzt Tilda Johnson vorstellen. Sie ist halb so groß wie ich, sie trägt langweiliges Schwarz, einen Dutt und kein Make-up. Sie wird nicht gerne beobachtet, sie beobachtet lieber. Mein Pitbull hat dafür einen sechsten Sinn – als sie bei mir anklopfte, knirschte er nicht mit den Zähnen, sondern wedelte mit dem Schwanz.
Sie sagte mir ihren Namen und bat um Erlaubnis, »das ehemalige Grundstück der Butlers zu betreten«.
Ich sagte ihr, »nur zu, Miss Tilda. Ich sage schon mal den Alligatoren und den Wasserschlangen Bescheid, dass es gleich etwas Leckeres zu essen gibt. Sie sehen zwar mager aus, aber das ist ja besser als nichts.«
Darüber dachte sie kurz nach und sagte dann: »Sie haben es sich ja wunderschön eingerichtet! Ob ich vielleicht kurz eintreten dürfte?«
Es stellte sich heraus, dass sie gerade Material über die Butlers sammelte. Sie will eine authentische Fernsehserie über Duke und Lili schreiben, »eine Liebesgeschichte zwischen einem Monster und einer Heiligen«. Sie setzte sich an meinen Esstisch. Ein kaltes Bier wollte sie nicht, lieber »eine Flasche Wasser«, aber aus der Leitung wäre auch okay. Dann fiel ihr Blick auf den Stapel Papier auf dem Tisch. »Was ist denn das?« Was für eine Überraschung! Jemand wie ich liest auch noch! Sie wurde wirklich sehr neugierig, deswegen habe ich ihr meinen Schatz kurz gezeigt.
Sie las ein paar Zeilen und fragte dann, ob sie vielleicht die gesamten Aufzeichnungen lesen könne, gleich hier und jetzt, sie würde mich auch nicht stören. Sie raucht nämlich nicht, sondern kaut nur Kaugummi. Sie nahm den Stapel mit auf die Veranda und saß dann einfach da. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so schnell liest. Wie eine Lesemaschine. Am nächsten Tag kam sie wieder. Sie wohnte im Versailles Motor Court und hatte einen Mietwagen mit Navigationssystem. Zwischendurch kam sie rein, ging aufs Klo und trank noch etwas Leitungswasser. Wenn ich rauchte, hustete sie, um zu zeigen, dass mein Rauchen sie stört, aber weil ihr Husten mich nicht störte, rauchte ich weiter. Dann las sie weiter. Am Ende seufzte sie wie jemand, der gerade einen ganzen Teller mit wirklich guten Nudeln restlos aufgegessen hatte.
Sie kam wieder rein und fing an, viele Fragen zu stellen. Meine Antworten schrieb sie auf. So wie sie hat sich noch niemand für mich interessiert. Die meisten Leute lenken das Thema auf sich, wenn man von seinem Leben erzählt, aber sie saß nur still da und hörte zu. So merkte ich gar nicht, dass ich ihr mehr als jedem anderen Menschen erzählte. Zufällig weiß ich nämlich sehr viel über Duke Butler. Sogar mehr als er selbst. Ich bin nämlich seine Mutter.
Nur einmal hat mich Miss Tilda kurz genervt, als sie wissen wollte, ob ich an diesen Ort gezogen sei, um Duke wieder nahe zu sein. »Was ist denn das für eine kranke Scheißidee?«, antwortete ich. Sie erwähnte das Thema dann nie wieder. Aber vielleicht hatte sie recht. Sie sagte auch, dass meine »Enthüllungen« und Lilis Tagebuch ihm vielleicht etwas Trost spenden können. Hoffentlich hat sie damit auch recht. Jedenfalls versprach sie mir, dass ich die Hälfte der Einnahmen kriege, weil ich ja schließlich das Tagebuch gefunden habe. Da seht Ihr, dass Jesus tatsächlich wenigstens eines meiner Gebete erhört hat. Danke, Jesus, endlich werde ich reich.
Dukes Leben begann mit meinem Leben. Seine Geschichte ist also ganz und gar »meine«. Der Rest dazwischen ist schwer zu glauben, aber wahr.
NORDEN
DER REKRUT
Die Siebziger
Der Eintritt
Duke Butlers Leben als New Yorker begann im Juni 1972, an einem jener Tage, an denen die Bewohner der Stadt ihr die sadistischen Winterspielchen verziehen. Man stelle sich die Wirkung auf einen Neuankömmling vor, der die Schrecken nicht kennt – seidiger Sonnenschein, der Himmel so blau wie das Kleid der Madonna, eine verführerische und dennoch kühle Straße, ein Baum, der geduldig darauf wartet, Schatten zu spenden, das verheißungsvolle Läuten des Eisverkäufers. Selbst jemand, der die Wahrheit über New York kennt, gerät wegen eines solchen Augenblicks der Juniseligkeit ins Schwärmen.
Es war Sonntag. Die Geschäfte hatten geschlossen, Computer kosteten zwanzigtausend Dollar plus Steuern (da sie mehrere Kubikmeter groß waren, gab es sie aber sowieso nur in Laboren), die Leute benutzten Telefone mit Wählscheiben und fassten sich kurz, um die Kosten niedrig zu halten, sie trafen sich zum Rauchen und zum Trinken oder um auf irgendeiner Droge das Gaga-Land zu erkunden. Manche priesen die »Werte« im Unterschied zu den »Wertgegenständen« (Erstere waren unbeständig), der Widerstand gegen das politische Establishment hatte an Elan verloren, die sexuelle Revolution hatte ihre Kinder noch nicht gefressen. Patriotismus, die Religion des Abschaums, war in Manhattan noch immer verpönt.
Duke Butler, in einer prächtigen Armeeuniform in Olivgrün, ganze einundzwanzig Jahre alt, mit dunkelbrauner Haut, die ihn als »Schwarzen« kenntlich machte, stieg am Port Authority Terminal mit einem kleinen Gummikoffer aus dem Flughafenbus.
In seiner Hand war ein Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer, zwei Silben und sieben Ziffern, eine Inschrift auf dem Grabstein seiner Zukunft. Die Größe des Moments war ihm nicht klar, als er vor einem Münzfernsprecher stehenblieb. Ein Polizist starrte ihn an. Duke Butler, der unwillkürlich bemerkte, dass auch der Polizist dunkelhäutig war, überlegte, ob er irgendwas falsch gemacht hatte. Da er sich keiner Schuld bewusst war, bewahrte er die Ruhe. Er nahm die Brille ab, um die hingekritzelten Zahlen zu entziffern, steckte ein Zehncentstück in den Schlitz und wählte. Er sprach leise, mit Südstaatenakzent:
»Lili? Ich bin’s, Duke.«
Lili konnte ihre Freude nicht verbergen, als sie Dukes Stimme hörte. Er solle in ein Taxi springen und zu ihrer Wohnung auf der Upper West Side fahren – die Kosten zu erwähnen, kam ihr nicht in den Sinn. Sie sagte nicht »zur Wohnung meiner Eltern«, sondern »zu meiner Wohnung« – sie war ein Einzelkind.
Der Polizist wandte sich ab und studierte weiter die allgemeine Szenerie; einige Jahrzehnte später würden seine Kollegen mit Handschellen zurück sein.
Im Plastikportemonnaie aus Armeebeständen, das in Duke Butlers Uniformtasche steckte, befanden sich nur drei Dollar. Ein Taxi zog er also nicht in Betracht. Er marschierte fünfzig Blocks gen Norden und erschrak über die Rebellen, die bei Rot über die Straße rannten. Er selbst wartete an jeder Ecke und fühlte sich als Herr seines Schicksals, weil ihn seine eigenen Beine trugen. Er hatte Vertrauen in seine Füße, die den permanenten Vorwärtsdrang bestimmten, während sein Oberkörper in der eng sitzenden Jacke, der nackte, aufgerichtete Adamsapfel und die scharf geschnittene Nase stetig in die ihnen befohlene Richtung wiesen. Seine Füße in den glänzenden grauen Halbschuhen waren der Kopf der Operation.
100 Riverside Drive lag in einer Seitenstraße, am Fuß eines Hügels, an der Stadtgrenze – er sah die filigranen Bäume des Nordens auf der gegenüberliegenden Straßenseite und dahinter den breiten Rücken eines Stromes, auf dem das Sonnenlicht funkelte und Boote tanzten, und in der Ferne das ruhige, ländliche New Jersey. Das Gebäude an der Straßenecke wurde von einem uniformierten Mann bewacht. Er hatte einen Dienstgrad, den der Neuankömmling nicht kannte. Der Concierge wiederum traute weder der Uniform des Besuchers noch seiner Rasse. Er bestand darauf, die Erlaubnis der Stones einzuholen, bevor er – »Wie war der Name?« – einen »Gefreiten Butler« nach oben ließ. Duke hörte Lilis Stimme – »ja!« – durch die Gegensprechanlage. Er betrat die Lobby. Auf dem Marmorboden hallten seine Schritte, und kurz fragte er sich, ob er aus Versehen in einer Bank gelandet war.
Lili öffnete die Tür. Vlado und Bucky, ihre Eltern, waren gerade von einer Europareise zurückgekehrt. Als der Summer ertönte, baten sie die Tochter des Hauses, die leidigen Freunde zu verscheuchen. Vlado musste sich erholen. Ihm blieb nur noch eine Stunde bis zu seinem Ersatztermin bei seinem Analytiker. Lili war in dem Glauben aufgewachsen, dass die Leute nach Europa reisten, so wie sie die U-Bahn nahmen, und das Gejammer darüber langweilte sie, aber jetzt war die Müdigkeit ihrer Eltern ein Himmelsgeschenk. Sie versprach, alle Besucher abzuwimmeln, und verschwieg, dass dieser Gast in Wahrheit ihrer war.
Leider stand Bucky doch auf, als sie die seltsam leise Stimme hörte, und fand ihr einziges Kind allein mit einem großen schwarzen Mann in Uniform in der Diele vor. Ein flüchtiger Blick genügte, um die Gefahr zu erkennen, bei einem zweiten stellte sich die Umarmung jedoch als einvernehmlich heraus. Der genügende Abstand zwischen beiden Körpern belegte die freundschaftliche Natur des Körperkontakts. Bucky ging zurück und riss ihren Mann aus dem Schlaf. Dann drängten sie sich gemeinsam ins Bild.
Lili überließ ihren Gast den Eltern. Sie starrte durch ihre Brillengläser wie durch ein Mikroskop, das die winzigsten Details vergrößerte, wie die Älteren die Hand des jungen Soldaten schüttelten: nicht so, wie sie den Keime tragenden Handteller eines weißen Fremden angefasst hätten, einfach so nämlich, sondern mit zaghafter Vorsicht, wie es einer von zweihundert Jahren amerikanischer Geschichte, Sklaverei und später dann mit Rache befleckten Faust zustand. Duke nahm nur sein eigenes Unbehagen wahr und erwiderte ihre verkrampften Bemühungen mit Südstaaten-Höflichkeit, die einem durch Gespräche mit den merkwürdigsten Leuten helfen kann.
Sie führten ihn gleich in die Küche, deren Wände voller Bücher waren. Nachdem sie ihm den neuen Swiss Mocha angeboten hatten, den er ablehnte, weil er Kaffee noch nie gemocht hatte, und nachdem sie den Kaffee weggeschüttet und ihm ein Bier angeboten hatten, das er ablehnte, und nachdem sie ihm Beuteltee in der Kaffeetasse vorgesetzt und ihm mit breitem Lächeln gezeigt hatten, dass sie ihn als ihresgleichen betrachteten, wurde er ihnen umgehend sympathisch. Zu ihrer Verwunderung war ihm weder bekannt noch interessierte es ihn sonderlich, dass Angela Davis kürzlich von einer zu Unrecht erhobenen Mordanklage freigesprochen worden war, doch sie nahmen es hin. Sie waren sich ohnehin unsicher, was seine Hautfarbe anging, und selbst »Amerikas gefährlichstes Mundwerk«, Bucky, war so rücksichtsvoll, keine Erkundigungen über seinen Hintergrund einzuholen.
Duke wiederum wusste nichts über Lilis Hintergrund. Als er sie kennengelernt hatte, zwei Jahre zuvor, hatte ihr Nachname ihm nichts gesagt. Er kannte die Nationalgarde und die Ehrengarde, von der Avantgarde aber hatte er noch nie gehört. Und er wusste es an diesem Juninachmittag auch nicht zu schätzen, dass die Stones ihn, ungeachtet ihrer herausragenden Stellung in der New Yorker Kunstszene, freundlich und warmherzig behandelten. Er reagierte darauf, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Er lächelte zu oft. Wie wenig wusste er von New York! Es kam ihm auch nicht in den Sinn, dass das berühmte Paar den gesellschaftlichen Unterschied zwischen ihnen fürchtete. Oder den Rassenunterschied. Vom Altersunterschied ganz zu schweigen.
Die Stones fanden die Bescheidenheit ihres Gastes irritierend. Als sie ihn baten, doch Platz zu nehmen, schaute der junge Mann sich um und entschied sich für einen wackligen Lehnstuhl, den jeder mied. Reparaturen bedürfen der Planung, und die verschwendete man nicht an unbelebte Objekte. Duke setzte sich furchtlos hin, allen stockte der Atem, aber der Stuhl hielt stand, ein wahres Wunder, denn Duke war kein winziger, knochenloser Gelehrter. Aus dieser günstigen Position sah er Lili an, während seine Hand die weich gepolsterte Lehne streichelte. Die Therapeuten, die ständig im Bewusstseinsäther der Stones herumschwebten, hätten gespöttelt, dass Duke in Wirklichkeit ihre Tochter streichelte. Es schien eindeutig, dass nichts am Besuch des seltsamen jungen Mannes normal war, dass er nicht einfach nur ein weiterer interessanter Gast war, der in 100 Riverside Drive einkehrte. Zum ersten Mal waren Bucky und Vlado von der Freundeswahl ihrer Tochter beeindruckt. Die Stones hofften, dass die beiden sich in Harvard kennengelernt hatten oder in Cambridge; es gab auch andere Bildungseinrichtungen, die in Betracht kamen.
Aber Bucky stellte andere Fragen: »Wann sind Sie eingezogen worden? Waren Sie in Vietnam?«
Er beantwortete die Frage, ohne zu ahnen, wie geradezu abwegig ihre Einstellung war: »Ich bin nicht eingezogen worden, ich habe mich freiwillig gemeldet. Mein Vater hat in Korea gekämpft. Er war Sergeant. Mein älterer Cousin Carl ist auch Offizier, bei der vierten Infanterie in Nam. Ich wollte immer Soldat werden und meinem Land dienen. Aber in der ersten Stunde der Grundausbildung wurde mir klar, dass ich dafür nicht geeignet bin.«
Er hielt inne. Niemand sagte etwas. In bescheidenem Ton fuhr er fort.
»Es gab kein Zurück. Ich wurde ausgebildet und mit dem Rest meiner Einheit nach Vietnam geschickt. Vierte Infanterie, wie mein Cousin.«
»Sie waren also mitten im Krieg?«, fragte Bucky begierig.
»Nein, Ma’am«, sagte er. »Nein, war ich nicht.«
Er zögerte und schlug beschämt die Augen nieder. »Ich konnte einfach nicht auf Menschen schießen. Ich konnte überhaupt nicht schießen. Colonel Pickens, meinem befehlshabenden Offizier, habe ich gesagt: ›Ich glaube, ich bin ein Kriegsdienstverweigerer. Ich lehne es aus Gewissensgründen ab. Es ist, wie Gott sagt: du sollst nicht töten‹.«
»Oh!« – »Unglaublich!« – »Erzählen Sie weiter!«
Der Soldat saß kerzengerade da, als wäre er dazu abkommandiert worden. »Der Colonel hat mich in ein Verhörzimmer gebracht, und da hat er mich halbtot geprügelt. Ja, das kann man so sagen. Manchmal legte er eine Pause ein und fragte mich: ›So. Bist du immer noch ein Kriegsdienstverweigerer?‹ Und ich habe gesagt: ›Ja, Sir, immer noch.‹ Das Problem war: Der Colonel und ich, wir kannten uns von zu Hause. Das hat ihn noch wütender gemacht. Ich selbst war nicht wütend. Irgendwie hatte ich diese Strafe ja verdient. Nach einer Weile war ich so erschöpft von seinen Schlägen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich aufwachte, war ich im LBJ. Kennen Sie das Long Binh Militärgefängnis? Ich kam in Einzelhaft, das war mein Glück, weil es im übrigen Gefängnis Aufstände gab. Ich bin zu einem Jahr Haft verurteilt worden, aber nach einem Tag bekam ich eine neue Chance.«
Er blickte in die Runde, um sicherzugehen, dass niemand sich von seiner Geschichte genervt fühlte. Doch sie saßen wie gebannt da, mit aufgerissenen Augen, voller Anteilnahme. Die Rassenunruhen im LBJ hatten landesweit für Schlagzeilen gesorgt. So viele tote schwarze Soldaten. »Am zweiten Tag kam der Aufseher zu mir und sagte: ›Der Sergeant Major weiß über dich Bescheid.‹ Ich wusste überhaupt nicht, warum, aber ich wurde vorgeladen. Das war, als hätte mich der König einbestellt. Er war in voller Montur, stand an einem langen Tisch, auf dem eine Karte von Vietnam lag. Er hat auf die Karte geguckt, während ich die Orden an seiner Brust gezählt habe. Er hatte achtzehn Orden, und ich war achtzehn Jahre alt. Er war aus Texas. Meine Ehre sei ihm ziemlich egal, hat er gesagt, aber nicht das Ansehen seiner Einheit, und er habe gehört, dass ich Trompete spiele.«
»Trompete!«, rief Vlado erfreut dazwischen.
»Na ja, das stimmte überhaupt nicht«, sagte Duke. »Aber er glaubte es eben. In meiner Akte stand aus irgendeinem Grund, dass ich Trompeter bin, und da ich Duke heiße, schien ihm die Sache klar zu sein. Die Divisionskapelle war sein Steckenpferd. Ich habe mich natürlich bereit erklärt mitzuspielen, und er war bereit, meine Strafe aufzuheben. Ich bin in der Armee geblieben und tue jetzt schon ein Jahr lang so, als könnte ich Trompete spielen. Ich halte sie ganz fest an meinen geschlossenen Mund und blase die Backen auf. Niemand hat je etwas bemerkt. Ich bin in ganz Vietnam aufgetreten und zwar vor den richtigen Goldfasanen. Die, die wirklich den Ton angeben.«
Die Stones brauchten eine Minute, um den Witz zu kapieren.
»Man hat mich sogar befördert. Ich bin jetzt Obergefreiter!«
Familie Stone war baff. Der Besucher hatte eine erstaunliche Geschichte erzählt, ohne ihren hohen Unterhaltungswert zu erkennen. Der Rest seines Berichts erwies sich als profaner. Dukes Vater war unten im Süden auf die Intensivstation eingeliefert worden – »Was hat er denn?« – »Irgendwas mit dem Herzen, glaube ich« –, man rechnete mit seinem Tod, und der Obergefreite bekam eine Woche Heimaturlaub, damit er um die halbe Erde reisen konnte, um Abschied zu nehmen.
Er war in einem Militärflugzeug bis Frankfurt geflogen und dort in ein Verkehrsflugzeug nach New York umgestiegen, wo er sechs Stunden Aufenthalt hatte, ein weiterer Glücksfall. Und noch einer: Der alte Mann hatte sich unverhofft erholt. Duke standen jetzt einfach ein paar Urlaubstage zu Hause bevor. Er sah auf die Uhr und erhob sich. Er musste zurück zum Flughafen, um seinen Anschluss nach Hause nicht zu verpassen.
Als Lili hörte, dass er wieder gehen wollte, malte sich plötzlich tiefer Kummer auf ihr junges, rundes Gesicht – die reine Unschuld und das Fehlen einer klar konturierten Persönlichkeit (wie ihre Mutter sinnierte). Bucky machte große Augen. Der junge schwarze Mann war interessant, exotisch, von der falschen Straßenseite, aber integer. Er musste ziemlich intelligent sein. Vlado kam auch nicht aus dem akademischen Hochadel. Duke hatte Lili bezirzt, und Bucky war davon überzeugt, dass ihr Kind – in einem kurzen Kornblumenkleid, das ihren langen weißen Nacken frei ließ und ihre geschmeidigen schlanken Arme und ihre geschmeidigen runden Knie – den Gast bezirzt hatte. Was für ein schönes Paar! Sie wären ein Symbol für Entspannung zwischen den Rassen, und ihre Kinder und Kindeskinder würden die Welt erobern.
Wie schrecklich für die beiden, dachte Bucky, deren Herz für die gesamte Menschheit schlug, nur ein paar gemeinsame Stunden, wie in einer altmodischen Romanze, und noch schrecklicher: die Rückkehr eines jeden Einzelnen dieser unschuldigen Männer zur militärischen Pflicht. Ein Rettungseinsatz war vonnöten.
In New York hilft man niemandem, ohne vorher eine Gegenleistung zu vereinbaren. Doch Bucky folgte oft ihren Impulsen und brach diese Regel schamlos. Um dieses Betragen zu entschuldigen, hatte sie über die Bedürftigen und die Gebenden eine Theorie aufgestellt – »normalerweise sind sie austauschbar« –, die sie in regelmäßigen Abständen überprüfte. Jetzt ergab sich eine weitere Gelegenheit. Dieser benachteiligte junge Mann musste aus der Militärkaste in die erhabene Sphäre der Stones verpflanzt werden.
Bucky dachte scharf nach. Mr. Perkins kam ihr in den Sinn. Erst vor kurzem hatte sie bei einem Empfang die Bekanntschaft des schwerfälligen, scheuen Weinhändlers gemacht. Seine unaufgefordert vorgetragene Klage hatte sie fasziniert; er sprach davon, dass die Preise für alten Bordeaux jäh gestiegen seien, seit irgendein Jungspund, der reich geerbt hatte, sich immer öfter auf Weinauktionen blicken ließ. Am Ende hatte der Bursche mehr als fünfhundert Dollar für eine Flasche 1865er Lafite gezahlt, es mit dieser Protzerei in die Abendnachrichten geschafft und Deppen aus Memphis und Dallas auf die Idee gebracht, dass ihnen zu ihrem Glück doch noch etwas fehlte. Sie eilten zur nächsten Auktion und boten mit, und über Nacht stiegen die Preise für alten Bordeaux auf hohe fünfstellige Summen. Das große Geld war der Feind. Mr. Perkins sagte, er träume davon, einen Wolfsjungen feinste Weine verkosten zu lassen, und wenn es den nicht gebe, dann eine, wie er es nannte, »Weinjungfrau«, einen Menschen, der nie zuvor Wein getrunken hatte, einen Nichtraucher mit einem »reinen Mund« und sensiblen Geschmacksknospen. So jemanden würde er sofort gegen Bezahlung einstellen und seine Reaktionen aufzeichnen.
Jetzt konnte Mr. Perkins seine Worte wahrmachen. Sie rief ihn in seinem Laden an. Sie habe jemanden gefunden, der nicht mal Kaffee trinke. Er werde sich umgehend vorstellen. Als Nächstes musste der Flug storniert werden. Und dann würde sie sich um die »Fahnenfluchtgeschichte« kümmern. Ein Soldat weniger für Uncle Sam, das war doch eine gute Sache. Sie würde ihre Beziehungen spielen lassen.
»Duke, kann ich bitte Ihr Flugticket sehen?«
Während Lili Duke die Wohnung zeigte, stand Vlado hinter Bucky in der Küche, als sie telefonisch die Strippen zog. In Gesellschaft hielt er seinen Kopf geneigt, um neugierigen Blicken auszuweichen. Oft betrachtete er Buckys Füße, ihre geschwollenen Knöchel, wie der Bund ihrer schwarzen Socken darüber spannte; ihre Hose war zu kurz. Bucky war mal ein »heißer Feger« gewesen, Vlado hatte von ihren außergewöhnlich schönen Beinen geschwärmt, die ihren fehlenden Sinn für Mode mehr als wettmachten. Buckys Geheimwaffe war ihr schlauer, anzüglicher Blick, der sie für schlaue, anzügliche Männer schon als Teenager unwiderstehlich gemacht hatte. Und auch heute noch, Jahrzehnte später, konnte ihre intellektuelle Hochnäsigkeit auch in brisanten gesellschaftlichen Situationen potenzielle Feinde lähmen, den eigenen Ehemann eingeschlossen.
Lange nachdem ihre langen Beine klobig geworden waren und sie den ältlichen Matronen aus Brooklyn glich, die Vlado in seiner Jugend herumkommandiert hatten, entzückte ihn die reine Freude, die sie an ihrem Grips hatte. Ihr Übergewicht störte ihn nicht, denn er selbst hatte damit nie ein Problem gehabt. Obwohl er jede körperliche Anstrengung vermied – in seinen Augen: brain drain –, war er noch immer gut in Form, auch sein Haar war noch voll. Als Einziger in der Familie brauchte er keine Brille, aber seine Gesichtszüge blieben den Blicken verborgen, weil ihr Ausdruck so abweisend war und weil der Rauchvorhang seiner Camel sie verschleierte. Diese Wolke hüllte jetzt auch Bucky ein, als sie den Hörer auflegte, einmal hustete und dann posaunte: »Duke. Du hast einen Job!«
Als Duke zwei Stunden später wieder ging, hatte Bucky sowohl seinen Heimflug verschoben als auch seine Rückkehr nach Vietnam. Der Hausarzt tippte einfach unbesehen ein ärztliches Attest, das Dukes Verbleib in New York für einen Monat sicherte. Die Stones gaben Duke einen Wohnungsschlüssel – ein Magnet, der weiteres Glück anziehen würde. Er hatte die Aussicht auf den Hudson aus drei verschiedenen Zimmern bewundert, die 1,19-Dollar-Kekse gekostet, die aus einem berühmten Delikatessengeschäft stammten, von dem er noch nie gehört hatte, und einen schüchternen Blick ins Gästezimmer geworfen. Lilis Eltern mussten berühmt sein, weltberühmt, das hatte er inzwischen gemerkt, doch bislang kümmerte ihn das nicht; für ihn spielte es eine größere Rolle, dass sie vermögend waren, vermögender als sämtliche Menschen, denen er je begegnet war.
Kurz nachdem sich die Tür hinter Duke geschlossen hatte, merkte Vlado, dass er gerade seine Therapiesitzung verpasste. Er rief den Analytiker an, sagte ihm, dass er nach fünfzigtausend Dollar jetzt endlich »durch« sei mit der Therapie, und knallte den Hörer auf, bevor Dr. Friedberg widersprechen konnte. Er legte sich auf das Doppelbett, nach so vielen Jahren Ehe eher eine Gartenliege als ein Liebesnest, und wurde in den Schlaf gewiegt von Buckys Singsang aus dem Wohnzimmer, wo sie mit ihren Höflingen, Redakteuren, Verlegern und Busenfreundinnen telefonierte und von ihrer Neuerwerbung schwärmte: »Ein Soldat, aus dem tiefsten Süden. Ganz in Uniform. Aber in Wahrheit Pazifist. Was für eine Mischung! Er ist sehr intelligent, das merkt man einfach. Ihm entgeht nichts. Vor uns ist er sehr schüchtern. Kaut einem ein Ohr ab oder sagt gar nichts. Hat aber sehr spannende Dinge zu berichten. Übrigens ein Mulatte. Nein, nicht nur wegen der Hautfarbe. Ja, dunkel, vielleicht sogar noch dunkler durch das Leben in Vietnam – auch Schwarze werden bekanntlich von der Sonne gebräunt. Sein Haar ist kraus. Glaube ich. Er hat einen, wie sagt man, einen Militärhaarschnitt. Die Nase breit, aber wie gemeißelt – ein aristokratisches Profil, wirklich! Aber seine Augen. Seine Augen sind blau. Sensationell, ein ägyptisches Blau, genau genommen die Farbe einer Vase aus dem Neuen Reich, circa 1300 vor Christus!
Vlado unterbrach sie und rief rein: »Sie sind unheimlich. Wie ein Eisblock aus der Urzeit – was in dem alles eingefroren sein könnte!«
Bucky kicherte und erzählte weiter: »Man sieht sie gar nicht wirklich. Er trägt eine dicke Brille, genau wie Lili. Das haben sie gemeinsam.«
Sie hatten mehr gemeinsam, als Bucky ahnte. Einer stillschweigenden Übereinkunft zufolge, die der aufdringlichen Anteilnahme der Stones Grenzen setzen sollte, hatte keiner von ihnen Einzelheiten ihrer ersten Begegnung vor zwei Sommern im fernen Ostafrika ausgeplaudert. Früher gab es die Freundschaftsform der »Reisegefährten«, eine ungeplante, unromantische Beziehung, die zwei Fremde, wenngleich nur für kurze Zeit, so intensiv aneinanderband wie ein Ehepaar. Das Ende der Reise bedeutete auch das Ende der Beziehung. Nach vierundzwanzig gemeinsamen Stunden in einem fremden Land waren Lili und Duke auseinandergegangen. Sie schrieb ihre Telefonnummer auf, er seine Adresse, weil Anrufe so teuer waren. Sie machten keine Pläne für eine erneute Zusammenkunft. Duke war heimgereist, in den Süden, und in die Armee eingerückt, und Lili war nach Cambridge gegangen, aufs College. Dukes plötzliche Wiederkehr passte zur Spontaneität ihrer früheren Partnerschaft und kam für Lili nicht überraschend. Was sie überraschte, war ihr brennender Wunsch, ihn in New York zu behalten, wohinter sich der Wunsch verbarg, ihn ganz und gar zu behalten. Sie musste sich dafür irgendeine Erklärung zurechtlegen. Anfangs nahm sie an, dass sie, wie ihre Mutter Bucky, schlicht hilfsbereit war. Sie würde ihn durch dieses Land der extremen Raffinesse führen. Als der feindselige Concierge zögerte, dem Soldaten die Tür zu öffnen, und Duke selbst nach der Klinke griff, kreischte Lili: »Das macht hier der Concierge!«
»Oh, tut mir leid.« Duke ließ die Tür los.
Sie fuhren mit der U-Bahn zu Mr. Perkins’ Laden, der Wagen laut wie ein Kriegsgefecht und heiß wie der Dschungel. Während sie schwankend nebeneinanderstanden, die Haltestange fest in den Händen, runzelte Duke die Stirn: Lilis Haut schien ihm weißer als in seiner Erinnerung, ihr Haar blonder. In Afrika war er hellhäutig gewesen, genau wie Lili, in New York aber war er ein Farbiger. Es war ihm unangenehm, mit ihr gesehen zu werden.
Als sie ihr Ziel erreicht hatten und Lili die Treppe hochrannte, sich auf der obersten Stufe zu ihm umdrehte und »du Trantüte« rief, vergaß er, was sie voneinander trennte, und eilte zu ihr.
Perkins Spirits and Fine Wines war ein Zweihundert-Dollar-im-Monat-Laden in einer schäbigen Gegend gleich bei der Houston Street, wo die Stadt gewaltige Neubauten hochzog. Während Duke den Laden betrat, besah sich Lili ihr Spiegelbild in der dreckigen Fensterscheibe. Der Laden versorgte notgedrungen Laufkundschaften und Gourmets. Im Eingangsbereich stand der Fusel. Weiter hinten im Laden, durch sorgsam geschichtete Kisten abgeschirmt, lagerten exklusive Weine aus ganz Europa. Mr. Perkins war kühn; er empfing Kundschaft auch an Sonntagen. Er kaufte Weine aus Übersee, von denen man in New York noch nie gehört hatte, nicht einmal im Jetset: Grünen Veltliner aus Österreich, Bondolas aus der Schweiz, Riesling aus dem Elsass. Mr. Perkins, der vor ewigen Zeiten in der Upper East Side aufgewachsen war, als Manieren noch etwas galten, ließ sich sein Erstaunen nicht anmerken, als Duke Butler in voller militärischer Montur bei ihm vorstellig wurde. »Die Stones haben immer interessante Bekannte«, sagte er und bat den Soldaten herein. »Und Sie haben wirklich noch nie einen Schluck Wein getrunken?«
»Nein, in meinem ganzen Leben nicht«, versicherte ihm Duke. »Wo ich herkomme, trinkt man härteres Zeug. Das hat mich nie gereizt.«
Mr. Perkins’ Gesicht schien wie das alte Porträt eines Gutsherrn. Nur die Zeit hatte sich daran zu schaffen gemacht und die weiße Haut mit feinen Linien überzogen. Die dichten grauen Augenbrauen verharrten in der ihnen zugewiesenen Wölbung, der kleine rosa Mund war durch Nahrungsaufnahme oder Sprechweise in seinem Ernst nicht entstellt. Doch durch die großen braunen Augen kam Leben in das Porträt. Weil sie als Gefangene einer angeborenen Krankheit namens »Tanzende Augen« in ihren Höhlen kreisten, richtete Mr. Perkins seinen Blick nur selten direkt auf einen anderen Menschen, weil er es nicht konnte. Schon als kleinen Jungen hatte man ihn vom Sport befreit, weswegen sein Körper schon früh größer und schwerer als die der anderen gewesen war. Er war also längst an seine Parameter gewöhnt und konnte flott um seine Flaschen herumkurven, eine aussuchen und seinem Gast ein wohlgefülltes Glas Gallo Burgunder für 1,50 Dollar vorsetzen. Er sah seinem Gast beim Trinken zu. »Was halten Sie davon?«
»Ich weiß nicht, was ich davon halte«, sagte Duke, der nur nicht wusste, was er sagen sollte.
Mr. Perkins wandte enttäuscht seine Wackelaugen ab, und da sagte Duke die Wahrheit: »Es ist merkwürdig, Sir. Es flitzt einem im ganzen Mund herum, und dann glitscht es einem wie eine Eidechse durch die Kehle und rollt sich im Magen ein …« Er betrachtete die Tropfen in seinem Glas, legte die Nase daran und schnupperte. Als Duke einen weiteren Schluck nehmen wollte, riss Mr. Perkins ihm das Glas aus der Hand und ließ wenige Tropfen eines siebzehn Dollar teuren 1956er Bordeaux Château Haut-Brion Pessac-Leognan in ein anderes Glas rinnen. »Und der hier?«, fragte er.
»Anders«, antwortete Duke so erschüttert, dass seine schwarze Brille ein Stück herabrutschte. »Das Blut Jesu. Nur feuriger.«
Der Weinhändler engagierte Duke für einen Probemonat. Er sollte Weine verkosten und würde fünfzig Dollar die Woche verdienen. Rausgeschmissenes Geld, aber so ist das nun mal mit dem Vergnügen. »Haben Sie etwas anderes anzuziehen?«, fragte Mr. Perkins zaghaft.
Ziviles Durcheinander
An diesem Abend nahm Duke leise seinen Koffer aus der Diele und wanderte an den Felswänden von Bücherregalen vorbei zum Gästezimmer. Eine Stunde verging, in der die Stones dem Ticken ihrer Armbanduhren lauschten. Das Telefon wollte nicht klingeln. Ihr Gast machte nicht das leiseste Geräusch. Sie ließen sich im Wohnzimmer nieder und schlugen Bücher auf, doch die bedruckten Seiten kamen nicht an gegen das Kampfgetümmel des wirklichen Lebens. Die Stones waren, was selten vorkam, gelangweilt.
Eine wichtige Information für Nicht-New-Yorker: Eine dreiköpfige Familie wie die Stones hat nicht drei, sondern sechs Mitglieder, weil jedes Mitglied rund um die Uhr von einem unsichtbaren Therapeuten begleitet wird, einem Vertrauten, auf den man sich beruft und den man zitiert und der so an allem beteiligt ist, an jedem Zerwürfnis, jedem Kuss und jedem Gespräch. An Dukes erstem Abend in New York war Vlados Therapeut nicht mehr anwesend, da Vlado ihn gefeuert hatte. Die Einheit war instabil. Duke konnte sie festigen. Doch wieso kam er nicht zum Essen?
Schließlich stürmte Lili ins Gästezimmer. Die unbewachte Tür sprang auf, und Lili fand ihren Gast in der Mitte des Zimmers, vor Anker gegangen, den Blick auf das offene Fenster gerichtet, das den Hudson einrahmte und den grünen Horizont von New Jersey. Für eine so malerische Aussicht, die von den Gästen ausnahmslos gerühmt wurde, musste man schon damals viel Geld hinblättern.
»Wie gefällt dir die Aussicht?«, fragte Lili scheu.
Er drehte sich prompt zu ihr um, als hätte er nur auf diese Frage gewartet, und Lili sah, dass er noch nicht ausgepackt hatte.
»O nein!«, schluchzte sie. »Du bleibst nicht? Gefällt es dir nicht?« Derart dramatische Töne hatte sie sich noch nie erlaubt. Das Zimmer war ihr immer gleichgültig gewesen, wie alle anderen Zimmer auch, aber Dukes Anwesenheit hatte es in einen erhabenen Raum verwandelt: Bald würde er auf dem altmodischen Einzelbett liegen. Der rustikale Schreibtisch konnte ausgetauscht und sofort zum Müllplatz gekarrt werden, falls er Duke nicht gefiele. Das Chintzsofa wiederum war wie für sie beide gemacht. Überquellende Bücherregale bedeckten die Wände – dort standen die anspruchslosen Bücher, die Bucky aus den anderen Zimmern verbannt hatte, aber durch Dukes Anwesenheit verwandelten sie sich in einen hübschen Zimmerschmuck.
»Nein, es gefällt mir«, versicherte er. »Aber ich sollte nicht hierbleiben. So ein Quartier wird doch gebraucht.«
Er gab nicht zu, dass er am liebsten gleich gehen wollte, um nicht noch weitere derart exotische Situationen zu erleben. Sie wären bloß schmerzhaft. Er gehörte nicht hierher.
»So etwas Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ja, dieses ›Quartier‹ wird gebraucht. Du brauchst so was.« Das Wort »du« war auf einmal kostbar, und ihre Stimme vibrierte vor Zuneigung. Sie wollte es immer wieder sagen. »Du«, »du«, »du«, aber stattdessen sagte sie: »Komm, essen wir was. Bucky hat sich richtig ins Zeug gelegt.«
Essen aus dem Deli. Bucky hatte den Tisch gedeckt und das Tafelsilber in der Mitte verstreut. Duke ging um den Tisch herum, um es ordentlich hinzulegen, während die Stones, die schon Platz genommen hatten, ihre Teller beluden. Ihre glühenden Zigaretten verstärkten die Lagerfeueratmosphäre. Duke setzte sich und nahm eine kleine Portion. Das Wortgefecht begann.
»Steve wird Johns und Yokos neues Album verreißen«, verkündete Bucky. »Er sagt, es ist monumentaler, selbstherrlicher Kitsch. Texte auf dem Niveau von Kinderliedern. Nächste Woche sind wir zusammen mit den Lennons auf einer Party. Niemand wird ihnen in die Augen schauen können«, stöhnte sie.
»Wir können doch Lili hinschicken!«, schlug Vlado vor. »Dann fühlen sie sich gleich entspannter.«
Lili reagierte nicht darauf. Duke lächelte.
Bucky erklärte es ihrem Gast: »Lili ist unsere Spezialistin für Süßholz und Smalltalk.«
Dukes Lächeln war wie festgezurrt.
Bucky fuhr fort. »Gestern hat sie den neuen Concierge gefragt, wie viele Kinder er hat. Wir waren in Eile. Warum diese Frage? Warum? Ich wusste, jede Antwort hätte sie begeistert. Sie hätte seine Weisheit gelobt, keine Kinder zu haben, oder die Weitsicht, nur eins, oder das sagenhafte Glück, der Vater von fünfen zu sein.«
Lili aß ungerührt weiter.
»Und jetzt kommt’s«, sagte Bucky. »Er hatte sein Portemonnaie rausgeholt und zeigte uns die Fotos, die Leute klingelten nach dem Aufzug und mussten warten, während Lili die Fotos bewunderte.«
Lili erwachte zu Leben. »Nächste Woche tritt Elvis in New York auf«, sagte sie zu Duke.
Seine Augen leuchteten auf, endlich verstand er etwas.
»Noch ein Musiker, der auch in der Armee war«, sagte Lili und nickte Duke zu.
»Da höre ich lieber Dukes Trompete«, bemerkte Bucky. Allgemeines Gelächter. Lili drehte sich von Duke weg.
»Elvis’ Musik ist so viel einflussreicher als deine!«, sagte Lili Vlado brutal auf den Kopf zu. »Und viel interessanter. Deine Musik langweilt mich. Und ein einziger guter Comic begeistert viel mehr Menschen als alle Bücher von Bucky zusammen.«
Die Stones konzentrierten sich auf den überraschenden Angriff. Sie kauten und rauchten nicht einmal mehr. Sie hatten keine Verteidigungsstrategie. Schließlich sprang Bucky auf und rief: »Wir haben keine Gläser.« (Sie fand ein paar im Bücherregal.) Duke lächelte den abgetretenen Perserteppich unter dem Tisch an.
Bucky setzte sich wieder hin, weil ihr ein Gegenangriff eingefallen war. »Lili, wenn du nach der Beliebtheit gehst – die Met ist fast immer ausverkauft, bei viertausend Plätzen.«
»Die New York Mets spielen vor fünfzigtausend«, sagte Lili gelassen.
Duke schaute jetzt wieder auf und lächelte noch immer. Vlado versteckte sich hinter seinem Rauchvorhang.
»Schluss jetzt«, sagte Bucky. »Ich habe eine Idee. Ihr beide könntet doch morgen Abend in die Oper gehen. Ich habe zwei Karten für Turandot. Ist seit sechs Monaten ausverkauft.«
»Duke war noch nie in der Oper«, warnte Lili. »Stimmt doch, oder? Höchstens in der Grand Ole Opry?«
In diesem Moment sah Vlado Duke zum ersten Mal an. »Wirklich wahr?«
»Wirklich wahr?«, fragte Bucky.
Duke schüttelte den Kopf. »Nein. Noch nie.« Er schämte sich etwas.
»Ich beneide Sie«, sagte Vlado. »Die Ruhe, der Frieden …«
»Ich beneide Sie«, sagte Bucky. »Sie werden überwältigt sein. Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen tauschen, ehrlich. So was zum ersten Mal zu hören! Und zwar als reifer Erwachsener, nicht als dummes kleines Kind. Das hätten wir mit Lili auch machen müssen. Wir haben dich völlig falsch erzogen!«
Lili war ganz ihrer Meinung.
Eine der Tragödien im Leben der Reichen und Berühmten ist es, dass sie nicht begreifen, wie sehr ihr gesellschaftlicher Rang ihre Kinder belastet. Die Armen wissen es, die Unterdrückten wissen es: Sie verstellen sich vor ihrem Nachwuchs und tun so, als gehörten sie zur Mittelschicht. Die Reichen und Berühmten sollten ihrem Beispiel folgen. Als Tochter der Stones war Lili ernstlich benachteiligt. Einer ihrer liebsten Tagträume als Kind war der, dass Daddy ein Lehrer wäre oder ein Handwerker und Mommy eine Hausfrau mit Lockenwicklern im Haar und Fertigessen im Backofen. Tatsächlich nannte Lili ihre Eltern seit dem Kindergartenalter Bucky und Vlado, weil sie gemerkt hatte, dass sie auf »Mommy« und »Daddy« nicht reagierten. In Lilis Phantasie konnten sie nur Englisch sprechen. Und ihr Familienname war wirklich einfach Stone, nicht Sztejn.
Lili hatte ihre Eltern ebenfalls enttäuscht. Sie hatten ihren Intellekt als selbstverständlich vorausgesetzt, während sie mit dem eigenen beschäftigt waren. Keine Frage, dass ein zartes blondes Mädchen im Alter von drei Jahren lesen und schreiben konnte. So wie es bei ihnen selbst gewesen war. Mit vier kam Lili in einen teuren Kindergarten und lernte die Grundlagen des Schachspiels; mit fünf schlug sie ihren Vater, was ihn tatsächlich sehr ärgerte. Mit sechs traktierte sie ihre Eltern so lange, bis sie ihr einen Wellensittich kauften. Sie nannte ihn »Mommy« und weigerte sich, die Namenswahl zu erklären. Es folgten Mäuse, Rennmäuse, Hamster, Kaninchen, die sie alle »Mommy« oder »Daddy« taufte. Die Tiere schenkten Lili stets ihre ungeteilte und unkritische Aufmerksamkeit, sie waren weich, flauschig, dumm und immer für sie da. Und sie vermehrten sich. Das stumme chinesische Hausmädchen Wei Wei munterte sich selbst mit Liedern, alles Hymnen aus der Kulturrevolution, auf, wenn sie Lilis Zimmer sauber machen musste. Einmal die Woche schlug sich ein Psychiater mit ihrem Unterbewusstsein herum.
Lili passierte die üblichen Meilensteine weit vor der Zeit und wurde mit vierzehn auf dem Parkplatz einer amerikanischen Pubertät abgestellt. Sie wurde pummlig und picklig. Die Tiere starben nach und nach, und die Stones waren froh, dass sie die Viecher wieder los waren. Sie erwarteten, dass Lili mit dem Komponieren oder dem Schreiben anfing oder sich für Politik interessierte – Vlado hatte sie nach Lili Boulanger benannt, die sich allen drei gewidmet hatte und jung gestorben war. Lilis verheißungsvoller Name gab ihm das Gefühl, alles in seiner Macht Stehende für sie getan zu haben.
Schönheit war keine Tugend, die man in der Familie Stone erwartete oder erhoffte, aber Hässlichkeit war dann doch noch einmal eine ganz andere Sache. Die Tatsache, dass Lili so unattraktiv war, verunsicherte ihre Eltern. Sie sprachen mit ihren Therapeuten darüber und sondierten Fragen verletzter Eitelkeit – schließlich war es ihnen nicht gelungen, ein Wesen nach ihrem Bilde zu schaffen. Nur ihr Haar war schön, voll und blond. Doch auf wohlmeinende Komplimente von Erwachsenen in diese Richtung reagierte sie drastisch. Vor dem Badezimmerspiegel stutzte sie sich selbst die Haare. Missfiel ihr eine Strähne, schnitt sie gleich noch ein paar mehr ab. Als feststand, dass sie kurzsichtig war, suchte sie sich die klobigste und hässlichste Männerbrille aus, die sie finden konnte. Die Gläser bedeckten ihr halbes Gesicht; sie sah albern damit aus. Die Stones beschwichtigten sich selbst: immerhin war sie belesen und klug.
Eines Tages kam Lili aus der Schule und erklärte, ihr sei jetzt endlich klar, was sie einmal werden wolle. Mutter und Vater und ein Haufen desinteressierter Besucher hörten mit halbem Ohr hin; na, was denn – eine Intellektuelle wie Mom oder ein Künstler wie Dad?
»U-Bahn-Fahrerin!«, rief sie begeistert und verwandte nun ihre Intelligenz darauf, sich das Liniennetz von New York einzuprägen. Lili Stone wurde eine virtuose Kilometerfresserin. Sie konnte einem wie aus der Pistole geschossen den allerumständlichsten Weg zu jedem beliebigen Ziel beschreiben. Ihre Studien führten sie durch sämtliche Bezirke. Ihre Beziehung zu Wei Wei intensivierte sich.
Auf dem Weg zum Psychiater versicherte Wei Wei Lili, dass in ihrem Kopf nichts in Unordnung sei, was ein paar Wochen Arbeitslager nicht beheben könnten. Als sie einmal zusammen einkaufen gingen, murrte Wei Wei über den gestiegenen Preis für ein Pfund Hühnerfleisch (einunddreißig Cent) und ließ ein ganzes Huhn in ihrer Handtasche verschwinden. »Ein Schnäppchen«, lobte sie sich beim Auspacken in der Küche selbst. »Gratis.« Lili stellte sich vor, dass die schlichte, unauffällige Chinesin in Wirklichkeit ihre Mutter sei und Bucky unfruchtbar. Als ihr klar war, dass Wei Wei einen Sohn hatte, zu dem sie jeden Abend nach Hause fuhr, glaubte Lili, dass Wei Wei zwar mit dem blöden biologischen Balg festsaß, aber in Wirklichkeit sie bevorzugte.
Dr. MacBride stand auf verlorenem Posten, denn für fünfundzwanzig Dollar die Stunde, inzwischen zweimal die Woche, erzählte Lili ihm ausschließlich von Liniennetzen, Popmusik und Wei Weis Überlegenheit. Öfter als über die eigenen Eltern sprach sie über Wei Weis; sie waren reiche Kapitalisten gewesen und hatten ihren letzten Yuan geopfert, damit ihre minderjährige Tochter nach Hongkong fliehen konnte, bevor sie selbst zur Umerziehung in die Laogai-Arbeitslager geschickt wurden, wo sie sich an den Händen fassten und gemeinsam in einen Mähdrescher sprangen. Das war Liebe, das war Courage.
In der Schule gab Lili sich alle Mühe, keine guten Noten zu bekommen. Sie weigerte sich, ihre Hausaufgaben zu machen; ihre Lehrer weigerten sich, sie durchfallen zu lassen, zum Teil, weil Lili ihre eigenen wohlkalkulierten Pläne sabotierte. Als sie in Mathe einmal in einem Archie-Comic blätterte, packte der Lehrer sie von hinten, doch Lili musste nur kurz zur Tafel gucken, um die Gleichung zu lösen, ehe sie sich wieder ihrem Comic zuwandte. Die Rektorin durchschaute Lili und forderte sie auf, schon mit fünfzehn am Hochschultauglichkeitstest teilzunehmen. Lili wollte ihre Antworten nach dem Zufallsprinzip verteilen, aber die kniffligen Fragen weckten ihre Neugier und brachten sie dermaßen aus dem Konzept, dass sie die höchste Punktzahl erreichte. Sie wurde mit Briefen der Ivy League-Colleges überhäuft, die allesamt um ihre Gunst buhlten. Lili warf sie in den Mülleimer. Wei Wei fischte die Briefe heraus und überreichte sie Bucky, die Antwortschreiben aufsetzte, in denen sie die Einladungen zum Vorstellungsgespräch annahm.
Die drei Therapeuten der Stones brüteten über dem Problem, doch am Ende stellten Vlado und Bucky selbst die Diagnose – Lili ging es zu gut; ihr fehlte die schmerzliche Erfahrung ihrer Eltern, die während der Wirtschaftskrise aufgewachsen waren. Sie ließen ihre Beziehungen spielen und verschafften Lili einen Sommerjob in Ostafrika. Schocktherapie. Das wahre Leid kennenlernen und aufhören, über ihre eigene kümmerliche Version davon zu grübeln. Sie assistierte bei einem Forschungsprojekt über Bilharziose und verbrachte Zeit mit den Verdammten dieser Erde. Sie nahm ab. Die Stones ahnten nicht, wie schief das Ganze gehen würde. Im September kam Lili zurück, endlich mit Normalfigur, wortkarg, brav, und schrieb sich am College für Chemie ein.
In Harvard konnte sie allein schon durch Nennung ihres Namens Freunde gewinnen. Lili Stone. Irgendwie mit dem Komponisten verwandt? Ihr Vater. Irgendwie mit der Essayistin verwandt, die man auf den Schutzumschlägen ihrer Bücher zur »Mutter Empörung« salbte? Ihre leibliche Mutter. Lili hasste diese Verbindungen und hielt sich getreulich an diejenigen, die aufrichtig an ihr interessiert zu sein schienen und nicht an ihrer Familie – ihre einzigen Freunde waren kleine College-Angestellte. Sie war viel jünger als die anderen Studenten und wirkte auch so, mit ihrem kindlichen Gesicht, ihrer sehr flachen Brust. Ihre schwere schwarze Brille baumelte auf der Nase. Ihre monotone, sackartige Kleidung aus dickeren Tagen machte sie fast unsichtbar. Ein Witzbold gab ihr den Spitznamen Gray Girl. Nur ihre sehr guten akademischen Leistungen übersah niemand.
Sie war viel stolzer auf ihre anderen Heldentaten: Sie konnte sich jeden Geburtstag merken und konnte die ganze Nacht mit der Bibliotheksgehilfin palavern und ein psychisches Problem lösen, indem sie es mit Gerede aufpumpte, bis es platzte wie ein Eiterbläschen.
Als sie zu Besuch nach New York kam, wurde sie von Wei Wei geknuddelt. Ihre Eltern stichelten: für Naturwissenschaften, so hatten beide beschlossen, brauche man keine Phantasie. Lili verschrieb sich eine doppelte Arbeitslast aus Hochschulseminaren und Ferienkursen, damit sie in zwei Jahren das Examen machen konnte, kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag. Als bei der Examensfeier in Harvard ihr Familienname aufgerufen wurde, weil sonst niemand in Chemie mit summa cum laude abgeschlossen hatte, hielt sie sich die Hand vor den Mund und kicherte.
Während der ganzen Zeit in Harvard fühlte sie sich von etwas angezogen, das die Einheimischen »das echte Leben« nannten. Sie tauschte ihr Examen und ihre Talente gegen einen Platz in einer New Yorker Schwesternschule ein und lebte wieder zu Hause. Lilis Krankenhausgeschichten waren unterhaltsam, sofern sie die abstoßenden Details aussparte. Pflege erschien ihr nicht das Richtige zu sein. Sie beschloss, sich auf Notfallversorgung zu spezialisieren, und schrieb ein Referat mit dem Titel »Die Effizienz von TLC für die Patientengenesungsquote«. Bucky bat sie, ein anderes Wort als »Effizienz« zu nehmen; es sei so hässlich.
»Und gegen TLC hast du nichts?«, fragte Lili überraschend spitz beim Frühstück. »Das bedeutet nämlich ›Tender Loving Care‹ und ist kein Medikament. Dr. MacBride meint, genau davon hätte ich in meinem sogenannten Zuhause nicht genug bekommen. Wei Wei einmal ausgenommen.«
Der Rabatz hörte auf, als Lilis Vater das Thema wechselte und die Partitur zerriss, die er zum Porridge hatte lesen wollen. Vlado brachte immer Arbeit zum Essen mit, für den Fall, dass Bucky ihm auf die Nerven ging und er sich retten musste. Doch jetzt, da Duke mit am Familientisch saß, dachte Vlado nicht mehr an seine Hilfsmittel. Er war neugierig.
Das Abendessen verlief störungsfrei; die Stones waren froh, Wei Weis freien Tag gemeistert zu haben. Das chinesische Hausmädchen schützte sie seit Lilis Geburt vor den kleinen Belästigungen des täglichen Lebens, aber an den Wochenenden, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ließ sie die Familie in ihrem Elend sitzen. Das Wochenende war ein Fluch. Mahlzeiten aus dem Restaurant oder dem Feinkostladen waren nur ein schwacher Trost.
Duke schmeckte das Essen gut. Er bat um Nachschlag. Was in seiner Heimat als Kompliment galt, war in New York schlicht unpassend. Was sollten Komplimente, wenn man gar nicht selbst gekocht hatte? Essensreste waren eine Lebensversicherung. Lili sprang Duke zur Seite und bat ebenfalls um Nachschlag. Er bemerkte seinen Fauxpas nicht, und Bucky entspannte sich. Der Abend war amüsant. Niemand kam auf den Krieg in Kambodscha zu sprechen; auch dafür war später noch Zeit.
Als Bucky einen abschließenden Kaffee servierte, bat Duke stattdessen um ein Glas Milch. Dieser Wunsch ließ ihn nicht kindisch erscheinen, sondern wie einen schwitzenden und erschöpften Arbeiter, der sich jetzt Kalorien reinschütten musste. Aber Duke schüttete nichts. Er nippte an der Milch, als sei sie heiliger Nektar. Die anderen rauchten und warteten, dass der Kaffee abkühlte. Ein Teller Löffelbiskuit wurde am Tisch herumgereicht, nach einer Runde stand Duke auf und bedankte sich entschlossen für »das wunderbare Essen«. Dann drehte er sich um. Er hatte angenommen, dass das Dessert gleichzeitig das Ende des Abends darstellte und es Zeit war, ins Bett zu gehen.
Lili füllte die von ihm hinterlassene Leerstelle, indem sie über ihn sprach. Sie wollte den gelangweilten Blick aus den Augen ihrer Eltern vertreiben. Er sei der Urururenkel von Thomas Jefferson, sagte sie und glaubte es selbst. »Wirklich!«, riefen ihre Eltern aus und beugten sich vor. Sie warnte, dass man das Thema nicht ansprechen dürfe, weil Duke der Niedergang seiner Familie sehr belaste. Die Familie habe hoch im Norden gelebt und sei mit jeder Generation weiter nach Süden gezogen, bis zu Dukes Geburt in Florida. Er sei in großer Armut aufgewachsen, ohne Schuhe und immer hungrig zu Bett. Die Verbindung zu Jefferson beschämte ihn nur. Aber eines Tages, prophezeite sie, würde er stolz darauf sein. Er müsste vorher nur einen Grund dafür finden.
Der Neuling wird befördert
Einige Nächte vor Ablauf der ärztlich verordneten Schonfrist träumte Duke, er sei wieder in Saigon. Er war inmitten einer Gruppe pöbelnder Soldaten gefangen, die eben an Mr. Perkins’ Weinhandlung vorbeikamen. In einem peinlichen Ansturm uniformierter Rohheit drangen die Männer in den Weinladen ein. Sie wollten Fusel kaufen. Duke drängelte sich zum Tresen vor, aber Mr. Perkins erkannte ihn nicht. »Ich hätte gern den 1959er Domaine Leroy, Richebourg, Côte de Nuits, den Sie mir gestern gezeigt haben«, sagte Duke in der Hoffnung, dass Mr. Perkins sich dann an ihn erinnere. Der Weinhändler sah ihm trotzdem nicht in die Augen. Er stellte die Flasche auf den Tresen und tippte den Betrag in die Kasse. Zweihundertfünfundzwanzig Dollar. Das konnte Duke sich nie und nimmer leisten! An der Front würde er nie wieder Wein trinken können. Er schrak aus dem Schlaf auf.
An diesem Abend tauchte Dr. Gorokin, der Hausarzt der Familie, mit seiner kostbaren pillengefüllten Aktentasche auf. Seine Besuche fielen oft mit der Essenszeit zusammen. Was Gavrijl Gorokin dazu qualifizierte, ein Freund der Familie zu sein, war der Umstand, dass er Pharmaka verschreiben konnte und ein russischer Aristokrat war – im Rang gleich unter einem Prinzen –, der seine Jugend in einem Schloss verbracht hatte und bittere Anekdoten über die Kollaboration seiner Familie mit Stalin erzählen konnte.
Dr. Gorokin war zart und kränklich, sein früh ergrautes Haar wie eine mottenzerfressene Pracht, sein Gesicht faltig, wie nach langer Lagerung eben ausgepackt und ausgerollt, seine dreiteiligen Anzüge eine Art Bretterverschalung. Er war wohlerzogen und auch von entlegeneren Körperteilen niemals angewidert. Bei Hausbesuchen benahm er sich ganz ungezwungen; er reinigte den verstopften Anus praeter eines Kranken, mit dem er anschließend Kaffee trank. Wei Wei hasste ihn, auf ihre stille, zurückhaltende Art, weil er aus einem kommunistischen Land stammte, und ließ sich nicht einmal ein Aspirin von ihm geben. Seine Anwesenheit verursachte ohrenbetäubendes Geschirrspülen und Topfklappern. Dr. Gorokin nahm Wei Weis Feindseligkeit gnädig hin, wusste er doch, dass sie beide am Hof koexistieren konnten.
Nachdem Wei Wei die Teller abgeräumt hatte, packte er seinen Schreibblock auf den Tisch, und alle schauten ihm über die Schulter, während seine Spinnenfinger ein zweites Schreiben aufsetzten, aus dem hervorging, dass die akute Pyelonephritis des Patienten auf die Medikamente nicht angesprochen habe.
Dr. Gorokin verordnete zwei Monate Bettruhe. Der Patient konnte seinen Sommerjob behalten. Duke bedankte sich, aber er war verwirrt. Zwar freute er sich, dass er länger in New York bleiben konnte, doch das Attest entstammte irgendwie nicht seinem eigenen Entschluss. Sein Vater wäre angeekelt, würde er die Wahrheit erfahren. Duke fragte sich, ob er ihn anlügen könne.
Statt Dr. Gorokin darüber aufzuklären, entschuldigte sich Duke für einen Moment und stattete seiner Uniform im Gästezimmer einen Besuch ab. Er schüttelte den leeren Ärmel. Dass er länger in New York bleibe, sei nicht mehr als ein Kavaliersdelikt, ein Akt der Höflichkeit seinen Gastgebern gegenüber. Der Anzug protestierte nicht.
In den folgenden Wochen gewöhnte sich Duke an die einheimische Tracht: Jeans und sorgfältig gebügelte T-Shirts oder Hemden mit Button-Down-Kragen und hochgekrempelten Ärmeln, alle geerbt aus Vlados Bestand alter Alltagskleidung. Den guten Stoff auf der Haut zu spüren, war äußerst angenehm, und da er sein schwindelerregend hohes Gehalt von fünfzig Dollar die Woche kaum ausgeben konnte, fiel ihm ein, dass er sich bald selbst ausstaffieren könnte. In Vietnam verdiente er weniger als fünfzig Dollar im Monat.
Nach nur einem Monat hatte Mr. Perkins einen blutigen Laien in einen jungen Experten verwandelt. Der pummelige Gentleman mit dem Flatterblick war gleichermaßen gerührt und erstaunt, wie dieser Junge alles in sich aufsaugte – er konnte sich Namen, Marken, Rebsorten und Silben merken, die er überhaupt nicht aussprechen konnte, aber der Wein war ihm so wichtig, dass sein Gedächtnis jeden damit zusammenhängenden Laut behielt. Duke war nie in Europa gewesen und wusste nichts über europäische Geschichte. Mr. Perkins war nicht viel in Amerika herumgekommen und einem solchen Bildungsmangel noch nie begegnet. So einem Talent allerdings auch nicht. Er amüsierte sich gut.