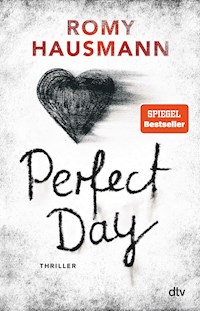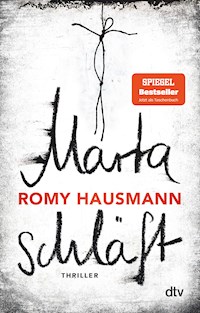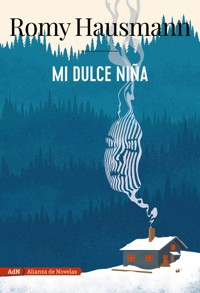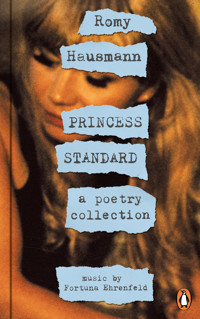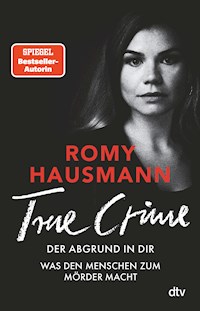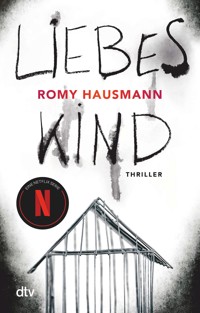
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller zur Netflix-Serie – dieser Thriller beginnt, wo andere enden Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Der Vater versorgt seine Familie mit Nahrung, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder eine Mutter haben – koste es, was es wolle. Doch eines Tages gelingt dieser die Flucht. Und nun geht der Albtraum richtig los. Denn vieles scheint darauf hinzudeuten, dass sich der Vater mit aller Macht zurückholen will, was ihm gehört. Wahn oder Wirklichkeit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen »Zirkulationsapparat«. Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht – und der Albtraum geht weiter. Denn vieles deutet darauf hin, dass er sich nun zurückholen will, was ihm gehört.
In ihrem emotional schockierenden und zugleich tief berührenden Thriller entrollt Romy Hausmann Stück für Stück das Panorama eines Grauens, das jegliche Vorstellungskraft übersteigt.
Von Romy Hausmann sind bei dtv außerdem erschienen:
Marta schläft
Perfect Day
Romy Hausmann
Liebes Kind
Thriller
Für Caterina, natürlich.
»Nichts ist trauriger als der Tod einer Illusion.« Arthur Koestler
Studentin (23) in München vermisst
München (LR) – Die Polizei München sucht nach Hinweisen auf den Verbleib von Lena Beck (23) aus München-Haidhausen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besuchte die Studentin laut Zeugenangaben bis ca. 5 Uhr eine Party im Stadtteil Maxvorstadt. Auf dem Heimweg telefonierte sie noch mit einer Freundin. Seitdem ist ihr Handy ausgeschaltet. Eine Suche der Polizei im Stadtgebiet München verlief am Freitag erfolglos. Lena Beck ist 1,65 Meter groß, zierlich und hat blondes, schulterlanges Haar. Sie trug zuletzt ein silbernes Oberteil, schwarze Jeans, schwarze Stiefel und einen dunkelblauen Mantel.
Am ersten Tag verliere ich mein Zeitgefühl, meine Würde und einen Backenzahn. Dafür habe ich jetzt zwei Kinder und eine Katze. Ihre Namen habe ich vergessen, bis auf den der Katze, Fräulein Tinky. Ich habe auch einen Mann. Er ist groß, hat kurzes, dunkles Haar und graue Augen. Ich betrachte ihn aus dem Augenwinkel, während ich dicht neben ihm auf dem abgewetzten Sofa sitze. Unter seiner Umarmung pulsieren die Verletzungen, die sich von meinem oberen Rücken nach unten ziehen, als hätte jede einzelne davon einen eigenen Herzschlag. Auf meiner Stirn brennt ein Schnitt. Ab und an wird mir schwarz vor Augen oder ich sehe weiße Blitze. Dann versuche ich einfach nur zu atmen.
Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich Abend ist, oder ob er das einfach so entschieden hat. Die Fenster sind mit Dämmplatten verschraubt. Er macht den Tag und die Nacht. Wie Gott. Ich versuche mir einzureden, ich hätte das Schlimmste bereits überstanden, nur ahne ich, dass wir bald zusammen ins Bett gehen werden. Die Kinder haben schon ihre Schlafanzüge angezogen. Der des Jungen ist schon etwas zu klein, während die Ärmel des Mädchens noch weit über die Handgelenke reichen. Die Kinder knien ein paar Schritte vom Sofa entfernt auf dem Boden und halten ihre Handflächen der Restwärme des Holzofens entgegen. Das Feuer ist zu einem schwarzen Haufen heruntergebrannt, durch den sich nur noch einzeln leuchtend rote Glutvenen ziehen. In die ganze Abartigkeit der Situation mischen sich die hellen Kinderstimmchen mit fröhlichem Geplapper. Was genau sie sagen, verstehe ich nicht. Ich höre sie wie durch Watte, während ich darüber nachdenke, wie ich ihren Vater töten werde.
Die Unfallnacht
Hannah
Am Anfang ist es leicht. Ich drücke meinen Rücken gerade und atme tief durch. Ich klettere in den Krankenwagen und fahre mit. Ich sage den Männern in den orangefarbenen Jacken Mamas Namen und dass sie Blutgruppe AB negativ hat. AB negativ ist die seltenste Blutgruppe und zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Antikörper gegen die Blutgruppen A und B besitzt. Das bedeutet, dass Mama das Blut aller anderen Blutgruppen bekommen kann. Das weiß ich, weil wir im Unterricht schon über Blutgruppen geredet haben. Und weil es im dicken Buch steht. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Erst, als ich aus Versehen an meinen Bruder denke, fängt mein Knie an zu zittern, das rechte. Jonathan wird sich bestimmt fürchten ohne mich.
Konzentrier dich, Hannah. Du bist doch schon ein großes Mädchen.
Nein, heute bin ich klein und dumm. Es ist kalt, es ist zu hell, es piept. Ich frage, woher das Piepen kommt, und einer der Männer in den orangefarbenen Jacken sagt: »Das ist das Herz deiner Mutter.«
Es hat noch nie gepiept, das Herz meiner Mutter.
Konzentrier dich, Hannah.
Die Fahrt ist wackelig, ich mache die Augen zu. Das Herz meiner Mutter piept.
Sie hat geschrien, es hat geknallt. Wenn das Herz meiner Mutter jetzt aufhört zu piepen, dann wird das das Letzte sein, was ich von ihr gehört habe, einen Schrei und einen Knall. Und sie hätte mir nicht mal Gute Nacht gesagt.
Der Krankenwagen macht einen kleinen Hüpfer, dann steht er.
»Wir sind da«, sagt der Mann. Er meint, beim Krankenhaus.
Ein Krankenhaus ist ein Gebäude, in dem durch ärztliche Hilfeleistung Krankheiten oder Verletzungen behandelt werden.
Der Mann sagt: »Nun komm schon, Mädchen.«
Meine Beine laufen wie automatisch und so schnell, dass ich gar nicht mehr mitkomme, meine Schritte zu zählen. Ich folge den Männern, die die ratternde Trage durch eine große Glastür unter einem grell beleuchteten Schild mit der Schrift »Notaufnahme« schieben, und dann weiter über einen langen Flur. Wie auf Kommando schwärmen von rechts und links Helfer heran, und viele Stimmen reden aufgeregt durcheinander.
»Du kannst hier nicht mit rein«, sagt ein dicker Mann in einem grünen Kittel und schubst mich ein bisschen zur Seite, als wir bei einer weiteren großen Tür am Ende des langen Flurs angelangt sind. »Wir schicken jemanden, der sich um dich kümmert.« Sein Zeigefinger fliegt in Richtung einer Stuhlreihe an der Wand. »Setz dich solange da hin.«
Ich will was sagen, aber die Worte kommen nicht raus, und der Mann hat sich sowieso schon längst umgedreht, um mit den anderen Helfern durch die Tür zu verschwinden. Ich zähle die Stühle an der Wand – sieben. Er hat nicht dazugesagt, auf welchen Stuhl ich mich setzen soll, der dicke Mann im grünen Kittel. Ohne es zu merken, habe ich angefangen, an meinem Daumennagel rumzukauen. Konzentrier dich, Hannah. Du bist doch schon ein großes Mädchen.
Ich sitze mit angezogenen Knien auf dem Stuhl in der Mitte und zupfe Tannennadeln und kleine braune Rindenplättchen aus dem Rock meines Kleides. Ich bin ziemlich schmutzig geworden heute Abend. Jonathan fällt mir wieder ein. Der arme kleine Jonathan, der zu Hause geblieben ist und saubermachen muss. Ich stelle mir vor, dass er weint, weil er nicht weiß, wie er die Flecken aus dem Teppich im Wohnzimmer rausbekommen soll. Ich bin mir sicher, dass wir im Vorratsraum die richtigen Putzmittel haben, nur hat Papa die Tür mit zwei Schlössern gesichert. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie wir viele davon haben müssen. Man muss immer vorsichtig sein.
»Hallo?«, eine Frauenstimme.
Ich springe von meinem Stuhl auf.
»Ich bin Schwester Ruth«, lächelt die Frau und greift nach meiner Hand, um sie zu schütteln. Ich sage ihr, dass ich Hannah heiße und dass Hannah ein Palindrom ist. Ein Palindrom ist ein Wort, das vorwärts und rückwärts gelesen das Gleiche ergibt. Zum Beweis buchstabiere ich ihr meinen Namen, erst von vorn und dann von hinten. Schwester Ruth lächelt immer noch und sagt: »Verstehe.«
Sie ist älter als Mama, sie hat schon graue Haare, und sie ist ein bisschen rund. Über ihrem hellgelben Kittel trägt sie eine bunte Strickjacke, die schön warm aussieht und an der ein Anstecker mit einem Pandabärengesicht befestigt ist. »Be happy« steht da. Das ist Englisch und heißt »Sei glücklich«. Meine Mundwinkel zucken.
»Du hast ja gar keine Schuhe an, Kind«, bemerkt Schwester Ruth, und ich wackele mit dem linken großen Zeh durch das Loch in meiner Strumpfhose. An einem ihrer guten Tage hat Mama die Stelle schon mal gestopft. Sie würde bestimmt schimpfen, wenn sie wüsste, dass ich meine Strumpfhose schon wieder kaputtgemacht habe.
Schwester Ruth zieht ein Taschentuch aus ihrer Kitteltasche, weil sie denkt, dass ich weine. Wegen dem Loch in meiner Strumpfhose oder wegen Mama. Ich sage ihr nicht, dass es eigentlich nur am viel zu hellen Licht der Röhrenlampen an der Decke liegt, das mich blendet, sondern: »Danke, das ist sehr aufmerksam von Ihnen.« Man muss immer höflich sein. Man muss immer bitte und danke sagen. Mein Bruder und ich sagen immer danke, wenn Mama uns einen Riegel gibt, obwohl wir die Riegel nicht leiden können. Sie schmecken uns nicht. Aber sie sind wichtig wegen der Vitamine. Calcium und Kalium und Magnesium und B-Vitamine für den Stoffwechsel und die Blutbildung. Wir essen jeden Tag drei, es sei denn, unser Vorrat ist aufgebraucht. Dann wünschen wir uns, dass Papa bald nach Hause kommt und unterwegs eingekauft hat.
Ich nehme das Taschentuch, tupfe über meine Augen und putze mir trötend die Nase, dann gebe ich es Schwester Ruth zurück. Man darf nichts behalten, was einem nicht gehört. Das ist Diebstahl. Schwester Ruth lacht und steckt das Taschentuch wieder in ihren Kittel. Ich frage natürlich auch nach Mama, aber Schwester Ruth sagt nur: »Sie ist in den besten Händen.« Ich weiß, dass das eigentlich keine Antwort ist, ich bin ja nicht blöd.
»Wann kann ich zu ihr?«, frage ich, aber auch darauf kriege ich keine Antwort.
Stattdessen sagt Schwester Ruth, dass sie mich in den Pausenraum mitnehmen will, um nachzuschauen, ob es dort ein paar Schlappen gibt, die ich anziehen könnte. Schlappen sind so was wie Hausschuhe. Jonathan und ich sollen zu Hause auch Hausschuhe anziehen, weil der Boden sich schlecht aufheizt, aber meistens vergessen wir es und machen unsere Strümpfe dreckig. Mama schimpft dann, weil noch gar nicht Wäschetag ist, und Papa schimpft, weil Mama den Boden nicht richtig sauber gemacht hat. Sauberkeit ist wichtig.
Der Pausenraum ist ein großes Zimmer, mindestens fünfzig Messschritte von der Tür bis zur gegenüberliegenden Seite. In der Mitte sind drei Tische mit jeweils vier Stühlen angeordnet. Dreimal vier macht zwölf. Einer der Stühle steht schräg. Da hat wohl jemand gesessen und dann nicht wieder richtig aufgeräumt, als er gegangen ist. Hoffentlich hat er dafür Ärger bekommen. Ordnung ist nämlich auch wichtig. Die linke Wand des Raums wird ausgefüllt von einem Metallschrank mit vielen einzelnen abschließbaren Fächern, an denen aber fast überall kleine Schlüssel stecken, und einem Hochbett, auch aus Metall. Geradeaus sind zwei große Fenster, durch die man die Nacht sehen kann. Schwarz und ohne Sterne. Rechts ist eine Küchenzeile. Da steht sogar ein Wasserkocher offen auf der Arbeitsfläche rum. Dabei kann heißes Wasser sehr gefährlich sein. Ab einer Temperatur von 45 Grad verschmort die Haut. Ab 60 Grad stockt das Eiweiß in den Hautzellen, wodurch sie absterben. Im Wasserkocher wird das Wasser auf hundert Grad erhitzt. Wir haben auch einen Wasserkocher zu Hause, aber wir sperren ihn weg.
Schwester Ruth sagt: »Setz dich ruhig.«
Drei mal vier macht zwölf. Zwölf Stühle, ich muss nachdenken. Die sternenlose Schwärze hinter den Fensterscheiben lenkt mich ab.
Konzentrier dich, Hannah.
Schwester Ruth geht zum Schrank und schließt ein Fach nach dem anderen auf und wieder zu. Sie macht ein paarmal langgezogen »hmmm«, dazwischen klappern die Metalltüren. Schwester Ruth sieht über ihre Schulter in meine Richtung und sagt noch mal: »Ja, setz dich doch ruhig, Kind.«
Erst denke ich, ich sollte vielleicht den Stuhl nehmen, der sowieso schräg steht. Aber das wäre nicht gerecht. Jeder muss für sich selbst aufräumen. Verantwortung übernehmen. Du bist ein großes Mädchen, Hannah. Ich nicke ins Leere und zähle heimlich ab, ene mene miste. Übrig bleibt ein Stuhl, von dem aus ich die Tür gut im Blick habe und den ich später natürlich auch wieder ordentlich an den Tisch rücken werde, wenn Schwester Ruth sagt, dass ich fertig bin mit Sitzen.
»Na, also«, lächelt sie, als sie sich mit einem Paar pinkfarbener Gummilatschen in der Hand zu mir umdreht. »Die sind zwar ein bisschen groß, aber besser als nichts.« Sie stellt mir die Schuhe vor die Füße und wartet, bis ich reingeschlüpft bin.
»Hör mal, Hannah«, sagt sie dann, während sie gleichzeitig ihre Strickjacke auszieht. »Deine Mama hatte keine Handtasche dabei, als der Unfall passiert ist. Das heißt, wir haben keinen Ausweis von ihr gefunden und auch sonst keine Papiere.«
Sie greift nach meinem Arm, hält ihn gestreckt und fummelt das Ärmelloch ihrer Strickjacke über meine Hand.
»Jetzt haben wir keinen Namen und keine Adresse. Und leider auch keinen Notfallkontakt.«
»Sie heißt Lena«, helfe ich weiter, wie auch schon vorhin im Krankenwagen. Man muss immer hilfsbereit sein. Mein Bruder und ich helfen Mama immer, wenn ihre Finger zittrig sind. Oder wenn sie wieder Sachen vergisst, unsere Namen zum Beispiel oder wann es Zeit ist, auf die Toilette zu gehen. Wir begleiten sie dann ins Bad, damit sie nicht vom Toilettensitz kippt oder andere Dummheiten macht.
Schwester Ruth ist inzwischen beim zweiten Ärmel angelangt. Auf meinem Rücken breitet sich angenehm die Restwärme aus, die noch in der Strickjacke steckt.
»Ja«, sagt sie. »Lena, wunderbar. Eine Lena ohne Nachnamen. So hat der Rettungsassistent das auch schon notiert.« Als sie seufzt, kann ich ihren Atem riechen. Er riecht nach Zahnpasta. Sie zerrt an meinem Stuhl, der über den Boden scharrt, bis ich so sitze, dass sie vor mir in die Hocke gehen kann, ohne sich dabei den Kopf an der Tischkante zu stoßen. Eine Tischkante kann sehr gefährlich sein. Mama hat sich schon oft den Kopf an der Tischkante gestoßen, wenn sie mal wieder einen Anfall hatte.
Schwester Ruth beginnt, mir die Strickjacke zuzuknöpfen. Mein Zeigefinger überträgt das Zickzackmuster ihres Scheitels auf meinen Oberschenkel. Zacke nach rechts, gerade, Zacke nach links, gerade, Zacke noch mal nach links, wie ein krummer Blitz. Als hätte Schwester Ruth meinen Blick auf ihrer Kopfhaut gespürt, sieht sie plötzlich auf.
»Gibt es jemanden, den wir anrufen können, Hannah? Deinen Papa vielleicht? Kennst du eure Telefonnummer auswendig?«
Ich schüttele den Kopf.
»Du hast doch einen Papa?«
Ich nicke.
»Und er wohnt auch bei euch? Bei dir und deiner Mama?«
Ich nicke noch mal.
»Wollen wir ihn nicht anrufen? Er muss doch wissen, dass deine Mama einen Unfall hatte und ihr hier im Krankenhaus seid. Er macht sich bestimmt Sorgen, wenn ihr nicht nach Hause kommt.«
Zacke nach rechts, gerade, Zacke nach links, gerade, Zacke noch mal nach links, wie ein krummer Blitz.
»Sag mal, Hannah, warst du eigentlich schon mal in einem Krankenhaus? Oder war deine Mama schon mal in einem Krankenhaus, vielleicht sogar hier in diesem? Dann könnten wir in unserem superschlauen Computer nach eurer Telefonnummer gucken.«
Ich schüttele den Kopf.
»Offene Wunden können notfalls auch mit Urin sterilisiert werden. Das wirkt desinfizierend, eiweißgerinnend und schmerzlindernd, Ende.«
Schwester Ruth greift nach meinen Händen. »Na gut, weißt du was, Hannah? Ich koche uns jetzt einen Tee und dann quatschen wir ein bisschen, du und ich. Was meinst du?«
»Worüber denn quatschen?«
Hannah
Ich soll was von meiner Mama erzählen, aha, aber erst mal fällt mir gar nichts ein. Ich denke nur dauernd an den großen Knall, als das Auto Mama erfasst hat, und wie sie beim nächsten Mal Blinzeln da lag im Lichtkegel des Autoscheinwerfers auf dem kalten, harten Boden, mit ganz verdrehten Armen und Beinen. Ihre Haut war viel zu weiß und das Blut, das aus den vielen kleinen Schnitten in ihrem Gesicht quoll, viel zu rot. Karminrot. Das Glas der Scheinwerfer war beim Aufprall zersplittert, mitten in Mamas Gesicht hinein. Ich habe mich an den Straßenrand gesetzt, meine Augen zugemacht und nur ab und zu mal heimlich geblinzelt, bis das blaue Blinken in der Dunkelheit auftauchte, der Krankenwagen.
Aber all das muss ich Schwester Ruth eigentlich gar nicht erzählen. Sie weiß ja längst, dass meine Mama einen Unfall hatte. Sonst wäre meine Mama ja auch gar nicht hier. Schwester Ruth glotzt. Ich zucke mit den Schultern und puste eine zitternde Mulde in meinen Tee hinein. Hagebutte, hat Schwester Ruth gesagt, und dass ihre Tochter Hagebuttentee am liebsten mochte, als sie noch klein war. »Und immer mit einem großen Löffel Honig darin. Sie war ein richtiger Süßschnabel.« Süßschnabel. Ich glaube nicht, dass es das Wort wirklich gibt, aber es gefällt mir.
»Meine Tochter heißt Nina«, sagt Schwester Ruth. »Wie Nina Simone, eine sehr berühmte Jazzsängerin. My baby don’t care for shows«, beginnt sie zu singen, nicht besonders schön. »My baby don’t care for clothes. My baby just cares for me. Schon mal gehört?«
Ich schüttele den Kopf.
»Das hätte ich mir denken können«, lacht sie. »Solche Musik hört man wohl in deinem Alter noch nicht. Oder ich singe einfach zu schlecht. Na, jedenfalls, als meine Nina so klein war wie du, sind wir fast jeden Tag auf den Spielplatz gegangen, wenn das Wetter einigermaßen war. Und wenn nicht, dann haben wir zu Hause Puzzle gelegt oder Plätzchen gebacken. Ach Gott, sie hat den Teig am liebsten direkt aus der Schüssel gegessen. Und meistens so viel davon, dass gerade noch genug für ein halbes Blech Plätzchen übriggeblieben ist.« Schwester Ruth lacht immer noch. Ich glaube, sie hat ihre Tochter sehr lieb.
»Puzzle machen wir auch«, sage ich. »Aber Plätzchen backen wir nicht. Meine Mama ist nämlich manchmal so ein Tollpatsch, deswegen lässt sie besser die Finger vom Herd.«
Erschrocken reiße ich mir die Hand vor den Mund. Ich soll Mama nicht immer einen Tollpatsch nennen.
»Hannah?«
Man muss immer Respekt haben vor seinen Eltern.
»Ich finde, wir sollten wirklich dringend mit deinem Papa sprechen«, sagt Schwester Ruth. »Denk mal nach, vielleicht fällt dir ja doch die Telefonnummer von zu Hause ein.«
»Wir haben kein Telefon.«
»Dann wenigstens eure Adresse? Der Name der Straße, in der ihr wohnt? Dann könnten wir jemanden vorbeischicken, der deinen Papa holt.«
Ich schüttele den Kopf, ganz langsam. Schwester Ruth kapiert es einfach nicht.
»Wir dürfen doch nicht gefunden werden«, flüstere ich.
Lena
Die Luft direkt nach einem Regen. Das erste und das letzte Stück einer Schokoladentafel, die immer am besten schmecken. Der Duft von Freesien. Das »Low«-Album von David Bowie. Currywurst nach einer langen Nacht. Eine lange Nacht. Das Summen einer dicken Hummel. Alles, was die Sonne macht, egal ob sie auf- oder untergeht oder einfach nur scheint. Ein blauer Himmel. Ein grauer Himmel. Ein schwarzer Himmel. Irgendein Himmel. Die Art, wie meine Mutter die Augen verdreht, wenn sie spontan zu Besuch kommt und der Abwasch nicht gemacht ist. Die alte Hollywoodschaukel im Garten meiner Großeltern, wie sie quietscht, und es klingt, als sänge sie ein schräges Lied, wenn man darauf vor- und zurückschwingt. Diese albernen Tischdeckenbeschwerer, die aussehen wie Erdbeeren und Zitronen. Sommerwind, auf dem Gesicht und im Haar. Das Meer, sein Rauschen. Feiner weißer Sand zwischen den Zehen …
»Ich liebe dich«, stöhnt er und wälzt seinen klebrigen Körper von meinem.
»Ich liebe dich auch«, sage ich leise und krümme mich zusammen wie ein sterbendes Reh.
»… Rippenserienfraktur links mit Beteiligung der 2. bis 4. Rippe. Subperiostale Hämatome …«
Hannah
»Du meinst, du willst mir nicht verraten, wo ihr wohnt.«
Schwester Ruth lächelt, aber es ist kein richtiges Lächeln, eher ein halbes mit nur einem Mundwinkel, dem rechten.
»Meine Tochter hat solche Spielchen auch geliebt, als sie noch klein war.«
»Nina«, sage ich, damit Schwester Ruth merkt, dass ich gut zugehört habe. Man muss immer gut zuhören. »Der Süßschnabel.«
»Genau, der Süßschnabel«, nickt sie, schiebt ihre Teetasse zur Seite und lehnt sich ein Stückchen weiter über den Tisch. »Und solche Spiele sind natürlich auch lustig. Aber weißt du, Hannah, manchmal ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für so was, leider. Weil die Dinge dann ernst sind. Wenn ein Mensch einen Unfall hatte und ins Krankenhaus kommt, dann müssen wir seine Angehörigen verständigen. Das ist unsere Pflicht.«
Ich versuche, nicht zu blinzeln, als sie mich jetzt auf diese ganz bestimmte Art ansieht. Ich will, dass sie zuerst blinzelt. Dann hat sie nämlich verloren.
»Manchmal, wenn jemand schwer verletzt ist, so wie deine Mama, dann müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden.«
Wer zuerst blinzelt, verliert; so geht das Spiel.
»Entscheidungen, die der oder die Verletzte eben im Moment nicht selber treffen kann. Verstehst du das, Hannah?«
Schwester Ruth hat verloren.
»Na schön«, seufzt sie.
Ich nehme die Hand vor den Mund und zupfe an meiner Unterlippe, damit sie nicht merkt, dass ich grinse. Man soll eigentlich niemanden auslachen, nicht mal, wenn er beim Blinzelwettbewerb verloren hat.
»Ich dachte ja nur, dass wir uns ein bisschen unterhalten können, bis die Polizei kommt.«
Die Polizei ist ein Exekutivorgan des Staates. Ihre Aufgabe ist es, strafbare und ordnungswidrige Handlungen zu erforschen. Und manchmal kommt sie, um Kinder von ihren Eltern wegzuholen. Oder Eltern von ihren Kindern.
»Die Polizei kommt?«
»Das ist ganz normal. Man muss ja irgendwie klären, wie es zu dem Unfall kam, bei dem deine Mama verletzt wurde. Weißt du schon, was das Wort ›Fahrerflucht‹ bedeutet, Hannah?«
»Das Wort ›Fahrerflucht‹ beschreibt das unerlaubte Sich-Entfernen eines Verkehrsteilnehmers vom Unfallort nach einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall, Ende.«
Schwester Ruth nickt. »Das ist ein Verbrechen, dem die Polizei nachgehen muss.«
»Kriegt der Mann, der da war, dann Ärger?«
Schwester Ruth kneift ihre Augen klein. »Ein Mann war es also, der das Auto gefahren hat, ja? Warum fragst du das, Hannah?«
»Weil er nett war. Er hat sich um alles gekümmert und den Notruf verständigt. Er hat gesagt, dass alles wieder gut wird. Und er hat mir eine Jacke gegeben, als mir kalt war, während wir auf den Krankenwagen gewartet haben. Er ist auch wirklich erst gegangen, kurz bevor der Krankenwagen gekommen ist. Ich glaube, er hat sich genauso erschreckt wie Mama und ich.«
Ich will Schwester Ruth jetzt nicht mehr ansehen.
»Und sowieso war es ja auch gar nicht seine Schuld, dass der Unfall passiert ist«, sage ich mit meiner Mäusestimme. Papa hat die Mäusestimme für Mamas schlechte Tage erfunden, weil er dachte, es würde sie aufregen, wenn wir uns zu laut unterhielten. »Mama braucht ihre Ruhe«, hat er dann immer gesagt. »Mama geht es heute nicht so gut.«
»Wie meinst du das, Hannah?« Schwester Ruth scheint die Mäusestimme auch zu kennen, sie spricht jetzt nämlich genauso. »Wessen Schuld war es denn?«
Ich muss überlegen, wie ich es sage.
Konzentrier dich, Hannah. Du bist ein großes Mädchen.
»Meine Mama hat schon mal aus Versehen dumme Sachen gemacht.«
Schwester Ruth sieht überrascht aus. Überraschung ist, wenn man etwas Unerwartetes hört oder erlebt. Das kann etwas Schönes sein, wie ein Geschenk, das man bekommt, obwohl man gar nicht Geburtstag hat. Meine Katze Fräulein Tinky war so eine Überraschung. Als Papa damals nach Hause kam und sagte, dass er mir was mitgebracht hat, dachte ich an ein neues Buch oder an ein Brettspiel, das ich mit Jonathan spielen kann. Doch dann zeigte er mir Fräulein Tinky. Die seitdem für immer nur mir gehört, ganz allein.
Eine Überraschung kann aber auch was Schlechtes sein. Mama, die mitten in der Nacht aus dem Haus rennt, sehr schlecht. Ich denke lieber schnell wieder an was Schönes. An Fräulein Tinky und ihr weiches, rot getigertes Fell, das sich immer so schön aufheizt, wenn wir zusammen auf dem Boden vor dem Holzofen sitzen, sie auf meinem Schoß, meine Hände, die ihr Fell befühlen, meine kalte Nase, die sich in ihren warmen Nacken drückt, ihre süßen kleinen Pfötchen.
»Hannah?«
Ich will nicht. Ich will an Fräulein Tinky denken.
»Hast du Probleme zu Hause, Hannah?«
Mama kann Fräulein Tinky nicht besonders gut leiden. Sie hat sogar schon mal nach ihr getreten.
»Hast du vielleicht Probleme mit deiner Mama?«
Und sie ist ein Tollpatsch, egal was Papa sagt. Ohne seine Hilfe schafft sie es ja nicht mal, den Ofen anzufeuern.
»Hannah?«
Einmal, da ist es sogar über eine Woche lang kalt gewesen bei uns im Haus und wir haben so gefroren, dass wir nur noch müde waren. Aber sie ist nun mal meine Mama. Und wenn ich an sie denke, dann weiß ich, dass ich sie lieb habe. Liebe, das ist so ähnlich wie Glück. Ein Gefühl, das sehr warm ist und das einen lachen lässt, einfach so, obwohl niemand einen Witz gemacht hat. So wie Schwester Ruth lacht, wenn sie über Nina spricht. Den Süßschnabel.
»Kind, rede doch bitte mit mir!«
»Ich will nicht, dass die Polizei kommt und meine Mama mitnimmt!« Das war meine Löwenstimme.
Lena
Er wolle drei, sagt er, während er mit einer Zwiebel hantiert. Seelenruhig zieht er ihr die Schale vom Körper, es klingt wie ein Pflaster, das man von der Haut abreißt. Das Geräusch schmerzt mich. Ich stehe direkt neben ihm in der Küche und starre auf das Messer in seiner Hand. Ein Schnitzmesser, dünne kleingezackte Klinge, scharf genug.
»Hörst du mir zu, Lena?«
»Natürlich«, antwortet die Frau, die ich beginne, mit allem, was ich habe, zu hassen. Er bekommt alles von ihr, greift beherzt zu und hat sich auch schon reichlich bedient. Von ihrem Körper, ihrem Stolz, ihrer Würde. Und trotzdem lächelt sie ihm ins Gesicht. Sie macht mich krank, diese Frau. »Du willst drei.«
»Wollte ich schon immer. Und du?«
Die Frau wollte auch schon immer drei. Ich habe nie welche gewollt, aber meine Meinung zählt nicht. An manchen Tagen wünsche ich mir, mich daran gewöhnen zu können. An anderen weiß ich, dass das niemals geschehen darf. Ich klaube letzte Reserven zusammen, kleinteilige Scherben eines gebrochenen Willens, Erinnerungen und Gründe, und verstecke sie an einem sicheren Ort. Wie ein Eichhörnchen, das Vorräte für den Winter vergräbt. Ich kann nur hoffen, dass keiner, weder er noch die schwache Frau, mein Versteck je entdeckt. Den geheimen Ort, an dem es einen Himmel gibt und kitschige Tischdeckenbeschwerer.
»Möchtest du ein Glas Wein?« Er legt das Messer, mit dem er die Zwiebel gerade in Viertel geteilt hat, neben das Holzbrett und wendet sich mir zu. Das Messer und wie es da liegt. Eine halbe Armlänge, ein Griff. Ich muss mich zwingen, meinen Blick davon zu lösen. Ihm wieder ins Gesicht zu sehen mit dem dümmlichen Lächeln der schwachen Frau auf den Lippen.
»Ja, sehr gerne.«
»Wunderbar«, lächelt er zurück, dann tritt er einen Schritt auf den Esstisch zu, auf dem immer noch unausgeräumt die beiden braunen Papiertüten mit dem Einkauf stehen. »Rot oder weiß? Ich habe einfach beides mitgebracht, weil ich nicht wusste, was dir zu den Spaghetti lieber wäre.«
Wie er da steht, leicht gebeugt über den Tüten, mir halb den Rücken zugewandt, die rechte Hand bereits in eine der Tüten versenkt. Wie das Messer neben dem Holzbrett liegt, nur eine halbe Armlänge, nur ein Griff. Jetzt!, schreien die inneren Stimmen.
»Lena?« Die Papiertüte raschelt, als er die erste Flasche herauszieht. Jetzt!
»Gerne Rot, wenn ich wählen darf.«
»Ja, ist mir auch lieber.« Zufrieden und mit der Flasche in der Hand dreht er sich wieder um. An der Arbeitsplatte stützt sich die schwache Frau ab. Ein Finger zuckt erbärmlich nach dem Messer. Dazwischen liegen nur ein paar Zentimeter und doch eine Unmöglichkeit. Er kocht für mich. Wir essen zusammen und stoßen mit Rotwein darauf an, dass ich möglichst bald schwanger werde. Er will drei Kinder. Wir werden eine sehr glückliche Familie sein.
»Vorhofflimmern!«
Hannah
Schwester Ruth ist aus dem Zimmer gegangen, so schnell, dass sie sogar kurz gestolpert ist. Sie hat gesagt, ich soll schön sitzenbleiben und auf sie warten, also bewege ich mich nicht. Man soll immer machen, was die Erwachsenen sagen, auch wenn man selber schlau ist, so wie ich. Ich hätte Lust, das Zimmer abzumessen, aber ich muss ja sitzenbleiben, also fange ich einfach an zu zählen. Ich zähle gerne, wenn ich mich nicht bewegen soll und mir sonst nichts einfällt, über das ich nachdenken könnte. Dann vergeht die Zeit besser. Mein Bruder summt immer ein Lied, wenn ihm langweilig ist, aber das ist erst recht langweilig, finde ich, weil er immer nur das gleiche Lied summt. Das Spannende beim Zählen ist, dass man nie weiß, bis zu welcher Zahl man kommen wird, ehe die Zeit vorbei ist.
Ich habe bis 1128 gezählt, als Schwester Ruth zurückkommt, und darüber fast versäumt, aufzustehen. Man muss immer aufstehen, wenn die Türe geht, und seine Hände vorzeigen. Die Fingernägel müssen sauber sein und man darf nichts in der Hand verstecken, womit man sich selbst oder einen anderen verletzen könnte. Schwester Ruth hat aber gar nicht richtig hingeschaut und sagt nur, ich soll mich wieder setzen. Sie hat einen Malblock und spitze Stifte dabei und sagt: »Ich habe eine gute Idee, Hannah.«
Ich soll was malen, aha. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die Idee wirklich so gut ist. Die Stifte haben schöne Farben, das schon. Rot und gelb und blau und schwarz und lila und orange und pink und braun und grün. Aber die Minen sind wirklich spitz. Ich nehme den roten Stift und fahre vorsichtig mit dem Daumen über seine Mine – ja, wirklich sehr spitz. Zu Hause malen wir auch, aber mit Wachsstiften. Wir schreiben auch mit Wachsstiften.
»Warum soll ich denn was malen?«
Schwester Ruth zuckt mit den Schultern. »Na, zum einen können wir uns so die Zeit vertreiben, bis du zu deiner Mama darfst, und zum anderen können wir sagen, dass wir gerade sehr beschäftigt sind, wenn die Polizei kommt und dusslige Fragen stellen will. Was meinst du?«
»Und was soll ich malen?«
Schwester Ruth zuckt noch mal mit den Schultern. »Hm, vielleicht malst du einfach, was du heute erlebt hast, bevor du mit deiner Mama hergekommen bist.«
Ohne es zu merken, habe ich angefangen, am Stiftende rumzukauen. Jetzt haben sich winzig kleine Holzspäne gelöst, die auf meiner Zunge kleben. Ich lecke über meinen Handrücken, um sie loszuwerden.
»Nein«, sage ich dann. »Ich weiß was Besseres. Ich male ein Bild für meine Mama. Das kann ich ihr nachher schenken.«
»Okay, gut. Und hast du auch schon eine Idee, was du für sie malen möchtest?«
»Ja, vielleicht schon«, überlege ich. »Etwas, von dem ich weiß, dass es sie fröhlich machen wird.«
Schwester Ruth ist jetzt gespannt. Das sagt sie und das sieht man auch. Ihre Augen sind ganz rund und sie hat die Augenbrauen so weit hochgezogen, dass ihre Stirn faltig geworden ist. Ich lege den roten Stift beiseite und nehme mir den blauen. Vorsichtig setze ich ihn an. Spitze Minen können sehr gefährlich sein. Zuerst male ich das Gesicht meiner Mama. Schwester Ruth fragt, warum es blau ist. Ich mache ein Schnalzgeräusch und verdrehe die Augen. Manchmal ist Schwester Ruth wohl auch ein kleiner Trottel, so wie mein Bruder. »Weil ich doch keinen weißen Stift habe. Und weil man den weißen Stift doch sowieso nicht sehen würde auf dem weißen Papier«, erkläre ich ihr.
Als Nächstes male ich Mamas Körper, der in einem schönen langen Kleid steckt, auch in Blau, obwohl es eigentlich weiß sein müsste, dann ihre schönen langen Haare in Gelb und danach die schwarzen Bäume mit Ästen wie verknöcherte Monsterfinger, die versuchen, nach meiner Mama zu greifen.
»Das sieht ja gefährlich aus, Hannah«, sagt Schwester Ruth. »Erzähl mir doch mal was über das Bild.«
»Also, das ist die Geschichte von meiner Mama und meinem Papa und wie sie sich verliebt haben. Meine Mama war spät in der Nacht draußen im Wald unterwegs. Sehen Sie, wie schön das Mondlicht ihre Haare zum Glänzen bringt?«
»Ja, sie sieht wirklich sehr hübsch aus, Hannah. War sie alleine im Wald unterwegs?«
»Ja, und sie hatte schreckliche Angst, deswegen lacht ihr Mund auch nicht, sehen Sie?«
»Wovor hatte sie denn solche Angst?«
»Sie hatte sich verlaufen. Aber dann …«
Jetzt male ich meinen Papa, der hinter einem der Bäume hervortritt.
»Dann kommt mein Papa und findet sie. Das ist die beste Stelle in der Geschichte. Er steht da, wie aus dem Nichts, und rettet sie.« Ich korrigiere den Mund meiner Mama so, dass sie jetzt lacht. Ganz dick, wie eine dicke rote Banane sieht ihr Lächeln jetzt aus. »Und sie verlieben sich im allerersten Moment.«
Zufrieden lege ich den roten Stift neben das Papier, mit dem ich gerade noch ein paar Herzchen gemalt habe. Ein rotes Herz ist ein gängiges Symbol für die Liebe. Ich habe sechs rote Herzen gemalt, für noch mehr Liebe.
»Wow«, staunt Schwester Ruth. »Das klingt ja fast wie ein Märchen.«
»Nein. Das ist kein Märchen, das ist eine wahre Geschichte. Genau so wie meine Mama sie immer erzählt. Wenn es ein Märchen wäre, müsste sie doch zuerst »Es war einmal« sagen. »Es war einmal« ist die gebräuchliche Einleitung für Märchen, Sagen und Legenden. Ich frage sie oft nach der Geschichte, besonders wenn ich merke, dass sie traurig ist. Wenn sie mir die Geschichte erzählt, dann lächelt sie immer so schön.« Zum Beweis tippe ich mit dem Zeigefinger auf Mamas dicken roten Bananenmund.
Schwester Ruth beugt sich ein Stück weiter über den Tisch.
»Und was hat dein Papa da in der Hand?«
»Das ist ein Tuch, mit dem er ihr gleich die Augen verbindet, weil er sie überraschen will. Sie soll doch noch nicht wissen, wohin sie jetzt gehen werden.«
»Wohin werden sie denn gehen, Hannah?«
»Na, nach Hause«, sage ich. »In die Hütte.«
Lena
Sei dankbar.
Gott hat dich gesegnet.
Du hast ein schönes Zuhause.
Du hast eine Familie.
Du hast alles, was du dir immer gewünscht hast.
Die Stimme in meinem Kopf kratzt nur an der Oberfläche. In meinem Magen brennt es, Leere. Leere kann nicht brennen. Und wie sie brennen kann, diese Leere. Mein Kiefer spannt vor Anstrengung, als ich mich mit zittrigen Fingern am Deckel der Kakaodose zu schaffen mache. Der klemmt. Der verdammt noch mal klemmt. Ich spüre, wie sich der Schweiß unterhalb meines Haaransatzes sammelt und die Narbe auf meiner Stirn zum Brennen bringt. Auf der Arbeitsfläche stehen neben der Milchpackung zwei Tassen bereit, eine rote und eine blaue, beide mit weißen Pünktchen, beide bruchsicher aus Melamin. Die Kinder müssen frühstücken, jetzt. Sieben Uhr dreißig Frühstück. Was ist daran so schwer zu verstehen? Die Kinder brauchen einen geregelten Alltag. Die Kinder brauchen ein ausgewogenes Frühstück.
Was bist du nur für eine Mutter, Lena?
Was bist du für ein Monster?
In meinem Rücken höre ich sie toben, wild – bitte, Kinder nicht so laut! Die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer gehen direkt ineinander über. Ihr Gequieke schießt von einer Ecke zur nächsten wie ein außer Kontrolle geratener Flummi, während sie sich gegenseitig durch den Raum jagen – bitte, seid doch endlich ruhig! Ab und an springt eines von ihnen über die Armlehne des Sofas und lässt sich auf die Sitzfläche plumpsen, ein Geräusch wie ein lauter, schwerer Seufzer, immer wieder – ich will, dass ihr aufhört! Mein Schädel scheint zu bersten, der Druck in meinem Kopf wird unerträglich. Der Deckel klemmt. Der verdammte Deckel klemmt.
»Mama?«
Ich zucke zusammen. Plötzlich steht meine Tochter neben mir und schiebt interessiert ihr Kinn über die Kante der Arbeitsfläche. Wie klein sie doch ist. Ein winziges zartes Mädchen mit dünnen blonden Löckchen und einer sehr weißen Haut. Wie ein kleiner Engel. Aber keiner von den properen, rotbäckigen Cherubim, die meine Mutter in Porzellanform auf der Anrichte in ihrem Esszimmer sammelt. Eher ein Engel, mit dem irgendetwas nicht stimmt. Der fast und doch nicht ganz geglückte Probelauf.
»Hannah«, sage ich. Es klingt wie eine Feststellung, überhaupt nicht liebevoll.
»Soll ich dir helfen, Mama?« Ihre kugelrunden blassblauen Augen zeugen davon, dass sie mir meinen kalten Ton nicht übelnimmt oder ihn mir einfach nicht übelnehmen will. Ich nicke matt und schiebe die Kakaodose in ihre Richtung. Sie öffnet sie mit gekonntem Griff innerhalb von Sekunden und strahlt: »Ta-da!«
»Danke«, presse ich hervor.
Hannah will sich gerade abwenden, um weiterzuspielen, als ich ihren Arm packe, bestimmt zu fest, sie ist doch so klein und zerbrechlich. Augenblicklich lasse ich sie wieder los. »Tut mir leid. Hab ich dir wehgetan?«
Sie runzelt die Stirn und verzieht den Mund, als hätte ich gerade etwas sehr Dummes gesagt.
»Nein, natürlich nicht. Du würdest mir doch niemals wehtun, Mama.«
Kurzfristig legt sich ein Gefühl über meine innere Leere wie eine schwere, warme Decke. Ich versuche zu lächeln.
»Vielleicht könntest du mir noch ein bisschen weiterhelfen?« Wie zum Beweis halte ich meine zitternden Hände nach oben, aber Hannah hat ohnehin längst genickt, sich auf die Zehenspitzen geschoben und nach dem neongrünen Plastiklöffel gegrabscht, der ebenfalls auf der Arbeitsfläche bereitliegt. Sie misst jeweils zwei Löffel Kakao für jede Tasse ab, gießt das Pulver vorsichtig mit der Milch auf und verrührt es, während sie dabei bedächtig und mit monotoner Stimme die Runden zählt, die der Löffel klackernd in der Tasse dreht.
»Eins, zwei, drei …«
Die Zahlen, das Geklacker. Die Stimme in meinem Kopf, die beständig weiter an der Oberfläche kratzt, bis sich die erste Kerbe bildet. Die Stimme, die sagt: Sie ist deine Tochter und du musst sie lieben. Ob du willst oder nicht.
»… sieben, acht …«
Das Atmen fällt mir zunehmend schwerer. Meine Knie werden weich. Ich fasse nach der Kante der Arbeitsfläche, nach Halt, finde nichts.
»… dreizehn, vierzehn …«
In Zeitlupe kippt die Zimmerdecke, der Boden kräuselt sich, ich versinke in meiner Schwäche, gleite fast gemächlich ins erlösende Schwarz, danke.
»Papa!«, höre ich Hannah wie unter Wasser. »Mama hat wieder einen Anfall!«
»Kreislauf stabilisieren!«
Hannah
Schwester Ruth fragt mich, was ich mit einer »Hütte« meine.
Erst will ich ihren Kopf hauen, damit sie mal selber überlegt, aber dann denke ich, dass ich ihr lieber helfen sollte. Man muss immer hilfsbereit sein.
»Eine Hütte ist ein kleines Haus aus Holz. Im Wald.«
Schwester Ruth nickt, als habe sie es verstanden, aber ihre Augenbrauen sind zusammengezogen und ihr Kiefer hängt ein Stückchen tiefer als vorhin, so als wäre er irgendwie aus seiner Verankerung gerutscht. Man kann sehr viel in einem Gesicht sehen, wenn man schlau ist.
»Du willst sagen, ihr wohnt im Wald? In einer Hütte?«
Ich nicke ganz langsam und sage: »Sehr gut.« Ich werde auch gerne gelobt, wenn Mama mich beim Lernen abfragt und ich etwas richtig gewusst habe. Sie sagt dann auch immer: »Sehr gut, Hannah«, und dann macht mir das Nachdenken gleich viel mehr Spaß. Vielleicht geht es Schwester Ruth ja auch so.
»Hast du schon mal woanders gewohnt, Hannah? In einem richtigen Haus?«
»Eine Hütte ist ein richtiges Haus! Mein Papa hat sie doch extra so gebaut für uns. Wir haben auch richtige Luft. Nur zwei- oder dreimal hat der Zirkulationsapparat einen kleinen Schaden gehabt. Er muss immer ganz leise brummen, sonst stimmt was nicht. Zum Glück habe ich ein feines Gehör. Ich merke sofort, wenn was nicht stimmt mit dem Zirkulationsapparat, schon lange bevor wir Kopfschmerzen bekommen. Aber mein Papa hat ihn ja gleich repariert. Er hat gesagt, es war nur ein kleiner Wackler in der Technik, nichts Schlimmes. Er ist ein ziemlich guter Handwerker.«
Schwester Ruth blinzelt sehr oft. »Was«, sagt sie, und dann erst mal nichts weiter. Ich sage auch nichts, weil ich glaube, sie hat jetzt endlich verstanden, dass sie auch mal selbst ihren Kopf anstrengen muss. Mama wartet auch immer erst mal ab, wenn mir die richtigen Antworten beim Lernen nicht gleich einfallen. Sie sagt: »Es bringt nichts, wenn ich dir alle Lösungen immer gleich verrate. Du musst dir angewöhnen, deinen eigenen Kopf zu benutzen. Denk nach, Hannah. Konzentrier dich. Du kannst es.«
»Was«, sagt Schwester Ruth noch mal. »Was ist ein Zirku…, ein Zirku…?«
»Zirkulationsapparat, ein schweres Wort, oder? Wissen Sie, was ich mache, wenn ein Wort sehr schwer ist?«
Schwester Ruth sagt wieder nichts.
»Ich sage mir das schwere Wort im Kopf so oft hintereinander auf, bis ich es abgespeichert habe. So lerne ich auch viel besser Vokabeln als Jonathan. Manchmal reicht es, wenn ich mir das Wort zweimal leise im Kopf aufsage, aber manchmal brauche ich auch zehn Mal.«
Schwester Ruth sagt immer noch nichts. Vielleicht probiert sie ja grade meinen Trick aus und übt das schwere Wort im Kopf.
Jetzt passiert endlich wieder was, ihr Mund bewegt sich.
»Und verrätst du mir nun auch, was das ist, ein …« – sie holt extra Luft für das schwere Wort – »Zirkulationsapparat?«
»Sehr gut«, lobe ich sie noch mal und freue mich, über Schwester Ruths Fortschritte und über mich selbst. Ich bin eine gute Lehrerin. Das habe ich von meiner Mama. »Der Zirkulationsapparat macht die Luft für uns«, erkläre ich und bemühe mich, möglichst langsam zu sprechen, um Schwester Ruth nicht zu überfordern. »Ohne Sauerstoff kann ein Mensch nicht leben. Er muss täglich zwischen zehn- und zwanzigtausend Liter Luft ein- und ausatmen. Das ist von der Menge her ungefähr zehn- bis zwanzigtausendmal so viel, wie in eine Milchpackung reingeht. Eingeatmete Luft enthält ungefähr einundzwanzig Prozent Sauerstoff und null Komma null drei Prozent Kohlendioxid. Ausgeatmete Luft enthält ungefähr siebzehn Prozent Sauerstoff und vier Prozent Kohlendioxid, Ende. Der Zirkulationsapparat sorgt dafür, dass die gute Luft zu uns in die Hütte reinkommt und die schlechte abtransportiert wird. Sonst würden wir ja ersticken.«
Schwester Ruth hält sich die Hand vor den Mund. Ich kann sehen, dass sie ein bisschen zittert. Nicht nur die Hand, sondern die ganze Schwester Ruth.
»Warum macht ihr nicht einfach das Fenster auf, wenn ihr Luft braucht, Hannah.« Ich glaube, das ist eine Frage, aber es klingt nicht so. Eigentlich muss man mit der Stimme am Satzende nach oben gehen, wenn man etwas fragen will. Ich fange an, die Stifte vor mir zu sortieren, in einer langen, ganz geraden Linie, von hell nach dunkel, beginnend mit Gelb, Schwarz kommt an den Schluss.
»Hannah?« Schwester Ruth ist mit der Stimme nach oben gegangen, aha. Ich sehe von meiner Stiftelinie auf, in ihr Gesicht.
»Verrätst du mir wenigstens, wer Jonathan ist?«
»Na, mein Bruder.«
»Und Jonathan lebt auch in der Hütte? Mit dir und euren Eltern?«
»Ja, natürlich. Er hat doch nichts falsch gemacht. Wieso sollten wir ihn wegschicken?«
»Erzähl mir von den Flecken im Teppich.« Schwester Ruth sieht jetzt ganz streng aus und gewinnt sogar den Blinzelwettbewerb. Das liegt aber nur daran, dass meine Augen wieder angefangen haben zu tränen. Das Licht ist schuld und die Müdigkeit.
»Hannah? Du hast doch vorhin gesagt, dass Jonathan sich um die Flecken im Teppich kümmert. Welche Flecken, Hannah?«
Ich schüttele den Kopf und sage: »Ich bin müde. Und ich will zu meiner Mama.«
Schwester Ruth greift über den Tisch nach meiner Hand. Unter ihrer Bewegung verschieben sich zwei Stifte aus meiner Stiftelinie, der blaue und der grüne.
»Ich weiß. Aber glaub mir, die Ärzte werden uns wirklich sofort Bescheid geben, wenn du zu ihr kannst. Möchtest du so lange vielleicht noch ein Bild malen? Schau mal, wie dick der ist.« Sie lässt meine Hand los und tippt mit dem Finger auf den Malblock. »Du hast noch ganz viele leere Blätter.«
Ich zucke mit den Schultern. Eigentlich habe ich keine Lust mehr zu malen.
Schwester Ruth macht ein Grübelgesicht mit klein gekniffenen Augen und gespitzten Lippen.
»Wie wär’s, wenn du ein Bild von eurer ganzen Familie malen würdest? Eins, auf dem auch dein Bruder drauf ist. Jonathan«, lächelt sie. Sie hat gut zugehört und sich seinen Namen gemerkt. »Versteht ihr euch gut, du und Jonathan? Oder zankt ihr manchmal?«
»Wir zanken nur, wenn er mal wieder ein Trottel ist.«
Schwester Ruth macht ein kurzes Lachgeräusch.
»Verstehe. Und sag mal, ist dein Bruder älter oder jünger als du?«
Ich reiße das Bild von Mama und Papa im Wald vom Block und lege es beiseite. Dann nehme ich den blauen Stift zur Hand und setze auf einem neuen Blatt an, Jonathans Gesicht zu malen.
»Jünger«, sage ich. »Zwei Jahre.«
»Okay, nichts sagen, lass mich raten. Dann ist er …«, fängt Schwester Ruth an und scheint zu überlegen. »Tja, schwierig. Ich schätze, dann ist er … sechs?«
Ich sehe von meinem Blatt auf. So eine arme, dumme Schwester Ruth, die anscheinend gar nicht gut rechnen kann.
»Dreizehn minus zwei«, versuche ich ihr zu helfen, aber sie glotzt nur.
»Er ist natürlich elf«, löse ich auf. Schwester Ruth muss wirklich noch viel lernen in ihrem Leben.
Hannah
Lernen ist wichtig. Man darf nicht dumm sein. Mir fällt das Lernen leichter als Jonathan, das war schon immer so. Er hat erst mit vier Jahren anständig Lesen gelernt. Wir wissen natürlich, was eine Schule ist. Eine Schule ist eine Institution, die Kindern und Jugendlichen Bildung vermittelt. Aber zum Glück müssen wir dort nicht hingehen. Der Weg ist sehr gefährlich. Wir könnten uns verlaufen oder überfallen werden. Und überhaupt müssen nur die richtig dummen Kinder in die Schule, die, die von alleine nicht lernen können. Ich denke, dass Schwester Ruth auch in die Schule musste, als sie noch klein war, aber es stimmt wohl, was ich mir schon lange gedacht habe: Die Schule tut nur so, als würde sie den Kindern wichtige Sachen beibringen. In Wirklichkeit bleiben sie dumm. Das merkt man ja an Schwester Ruth. So eine einfache Rechnung, dreizehn minus zwei. Ich denke auch, dass sich Schwester Ruth jetzt dafür schämt, dass sie so eine leichte Aufgabe nicht lösen konnte. Sie fragt sogar, ob das wirklich alles stimmt, was ich ihr gesagt habe. Also höre ich auf, an Jonathans Hose zu malen, drehe mein Blatt um und zeichne dreizehn Striche auf die Rückseite. Zwei davon streiche ich wieder weg und zähle dann langsam und deutlich die restlichen Striche für sie ab. Natürlich komme ich dabei auf elf übriggebliebene Striche. Dreizehn minus zwei ist nun mal elf. Und überhaupt finde ich es nicht schön, dass sie denkt, ich lüge, nur weil sie ein bisschen dumm ist. Ich würde nie lügen. Man darf nicht lügen. Das sage ich ihr auch, denn wahrscheinlich weiß sie auch das nicht, die arme dumme Schwester Ruth.
»Hannah.« Jetzt klingt sie, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »Die Hütte. Und der Zirku, Zirku …«
»Zirkulationsapparat!«, sage ich mit meiner Löwenstimme.
Schwester Ruth zuckt zusammen. Schreck, schon wieder. Große Augen und blitzrote Wangen. Aber diesmal tut sie mir nicht leid. Sie will sich einfach nicht anstrengen. »Ich dulde das nicht!«, macht meine Löwenstimme weiter, und meine Hand schlägt flach auf den Tisch. Die Stifte hopsen, der grüne Stift kullert sogar über die Tischkante und klackert auf den Boden. Man darf sich nicht absichtlich blöd anstellen. Ich bücke mich unter den Tisch nach dem grünen Stift, und als ich wieder auftauche, entschuldigt sie sich. Wenigstens das. Man muss sich immer entschuldigen, wenn man was falsch gemacht hat.
»Ich wollte dich nicht aufregen, Hannah«, sagt sie. »Das ist bestimmt eine anstrengende Situation für dich. Ich verstehe das. Aber weißt du, ich möchte auch den Rest verstehen. Ich würde so gerne wissen, wie das bei euch zu Hause ist. Ich kenne sonst niemanden, der in einer Hütte im Wald lebt.«
Ich drehe mein Blatt wieder um und male an Jonathans Hose weiter. Es ist seine Lieblingshose, die blaue, die er immer nur sonntags anziehen darf.
»Hannah?«
Ich blicke auf.
»Verzeihst du mir, ja?«
Ich nicke, dann kümmere ich mich gleich wieder um mein Bild. Jonathan hat auch sein rotes Lieblings-T-Shirt von mir bekommen. Als es noch neu war, hat es richtig geleuchtet. Ich glaube, er würde sich freuen, wenn er wüsste, dass er auf meinem Bild seine Lieblingssachen trägt. Am Schluss male ich noch seine Kringelhaare. Sie sind fast schwarz, so wie die von Papa. Direkt neben ihm, auf Höhe von Jonathans Schulter, fange ich dann mit meinem Gesicht an. Ich werde mir auch mein Lieblingskleid anziehen, das weiße mit den Blümchen. Wir werden alle sehr hübsch aussehen auf meinem Bild.
»Ihr könnt zu Hause kein Fenster aufmachen, oder, Hannah? Deswegen braucht ihr diesen Apparat.«
»Zirkulationsapparat«, murmele ich.
»Hat die Hütte keine Fenster?«
»Doch, natürlich.« Für meine Kringelhaare brauche ich den gelben Stift.
»Aber ihr macht die Fenster nicht auf? Warum nicht, Hannah?«
»Zu gefährlich. Deswegen haben wir sie auch mit Platten verschraubt.« Ich überlege, ob es eine Lüge wäre, wenn ich mir ein rotes Haarband malen würde. Ich habe gar kein rotes Haarband, nur ein dunkelblaues. Aber ein rotes würde viel besser zu den Blümchen auf meinem Kleid passen.
»Hat das dein Papa gemacht, Hannah? Du hattest ja gesagt, dass er ein guter Handwerker ist.«
»Ja.« Ganz, ganz vorsichtig nähert sich meine Hand dem roten Stift. Ich sehe Schwester Ruth dabei ins Gesicht. Sie kann ja eigentlich nicht wissen, dass ich kein rotes Haarband habe, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass man es in meinem Gesicht sieht, dass ich schummeln will. Sorge ist nicht richtig Angst, aber auch nicht so richtig gut. Sorge ist eher so was wie Übelkeit, wie wenn man Bauchschmerzen hat und nicht weiß, ob man sich übergeben muss oder nicht.
Mein Papa hat sich schon mal große Sorgen gemacht, als Mama weg gewesen ist. Er hat uns gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob sie wieder zu uns zurückkommen wird, und dann hat er geweint. Mein Papa hatte noch nie geweint. Ich habe die Hand nach seinem Gesicht ausgestreckt und das klebrige Tränenrinnchen befühlt. Er hat es nicht gesagt, aber ich wusste sofort, dass es auch meine Schuld war, dass Mama überhaupt weggegangen ist, wegen der Sache mit Sara. Jonathan hat es auch gewusst. Er hat mich nur angestarrt und ein paar Tage lang nicht mehr mit mir geredet, bis ich ihn daran erinnert habe, dass er Sara auch nicht besonders gut leiden konnte.
»Weißt du, Hannah, ich überlege gerade. Du hast dir so viel Mühe gegeben, deinen Bruder zu malen. Daran kann man richtig sehen, wie gerne du ihn hast. Sollen wir vielleicht jemanden zu euch nach Hause schicken, um nachzusehen, wie er mit dem Teppich vorankommt? Oder um ihm dabei zu helfen?«
Ich schnappe nach dem roten Stift, ohne Schwester Ruth aus den Augen zu lassen. Aber es scheint sie nicht zu stören, dass ich mit der Farbe schummeln will.
»Oder«, fährt sie unbeeindruckt fort, »wir könnten ihn herholen, zu dir. Dann könntet ihr zusammen auf eure Mama warten. Manche Dinge fühlen sich gleich viel weniger schlimm an, wenn man jemanden bei sich hat, der einem wichtig ist.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob es Jonathan hier gefallen würde«, sage ich. Mein erfundenes rotes Haarband sieht wirklich schön aus zu meinem Blümchenkleid. »Ich glaube, er würde anfangen zu zittern, wenn er hier sein müsste.«
»Aber du bist doch auch tapfer und zitterst nicht.«
»Ja, stimmt schon«, sage ich. »Aber ich bin vielleicht einfach mutiger als Jonathan. Weil ich älter bin oder ein bisschen schlauer oder beides. Er hat sich auch viel mehr vor dem Blut erschreckt als ich. Und vor dem Geräusch ja auch.«
»Welches Geräusch?«
»Na, woher, glauben Sie, kommen die schlimmen Flecken auf dem Teppich überhaupt?«
Schwester Ruth sieht aus, als würde sie überlegen, aber ich weiß ja inzwischen, dass sie darin nicht besonders gut ist. »Wie wenn man eine Wassermelone auf den Boden fallen lässt«, erkläre ich also, um ihr eine weitere Peinlichkeit zu ersparen. »So hört es sich an, wenn man jemandem was auf den Schädel haut. »Pamm!«, sage ich mit meiner Löwenstimme, und dann wieder normal: »Und danach ist es erst mal ganz still.«
Matthias
4825 Tage.
Ich habe jeden einzelnen gezählt und verflucht. Mein Haar ist noch grauer geworden, mein Herzschlag holprig. Im ersten Jahr bin ich täglich ihren letzten Weg abgefahren. Ich habe Flugblätter gedruckt und keinen Laternenpfahl ausgelassen, sie aufzuhängen. Ich befragte auf eigene Faust angebliche Freunde und rückte ein paar Köpfe zurecht. Ich rief mehrmals am Tag bei meinem langjährigen Freund Gerd an, Gerd Brühling, der als Polizeihauptkommissar und Leiter der Ermittlungsgruppe nach ihr suchte. Ich kündigte Herrn Brühling die Freundschaft, als er sie einfach nicht fand. Irgendwann, als ich anfing, mir nutzlos vorzukommen, wollte ich wenigstens dafür sorgen, dass die Lügen aufhörten. Ich gab zahlreiche Interviews, fünfzig oder mehr.
Lena ist verschwunden, seit 4825 Tagen. Und Nächten. Das sind fast vierzehn Jahre. Vierzehn Jahre, in denen jedes Telefonklingeln die eine, die einzige Nachricht hätte bedeuten können, die alles verändert. Man hätte unsere Tochter entführt und verlangte nun Lösegeld. Man hätte unsere Tochter aus der Isar gefischt, blau und bis zur Unkenntlichkeit aufgequollen. Man hätte sie gefunden, vergewaltigt, abgeschlachtet und weggeworfen wie Müll, vielleicht im Ausland, irgendwo Richtung Ostblock.
»Matthias? Bist du noch dran?« Gerds Stimme krächzt vor Aufregung.
Ich antworte nicht, versuche einfach nur zu atmen. Der Telefonhörer zittert in meiner schweißnassen rechten Hand. Mit der linken taste ich nach Halt an der Flurkommode. Der Raum, die Diele unseres Hauses, verliert an Feste, die Treppe, der Teppich, der Garderobenschrank scheinen auf mich zuzuschwappen, wie von Wellen gepackt. Der Boden unter meinen Füßen ist weich. Neben mir steht Karin, die sich schlaftrunken die Treppe vom oberen Stockwerk nach unten geschleppt hat, als ich nicht ins Schlafzimmer zurückgekehrt bin. Sie nestelt nervös am Bindegürtel ihres cremefarbenen Frotteebademantels herum und zischt: »Was ist denn, Matthias? Was ist denn?«
Ich schlucke schwer, an dem Kloß in meinem Hals, an der Nachricht und ihrer Bedeutung, an fast vierzehn verdammten Jahren. Hunderte Male hatten Karin und ich Lena in unserer Vorstellung auf schrecklichste Art und Weise sterben lassen, hatten uns durch tausende Möglichkeiten gequält. Nur eine hatten wir bei unseren Überlegungen irgendwann zu vernachlässigen begonnen: Was, wenn das Telefon klingelt und man uns sagt, man habe sie lebend gefunden?
»Lena«, keuche ich.
Karin schließt die Augen und macht ein paar unbestimmte Schritte nach hinten, bis sie mit dem Rücken gegen die Wand stößt und daran hinabsinkt. Sie nimmt die Hände vors Gesicht und fängt an zu schluchzen, nicht laut und dramatisch, das nicht. Zu viel Zeit ist wohl vergangen, 4825 Tage, zu wenig Hoffnung haben sie übriggelassen. Es sind eher kleine Hickser, die sie macht, wie ein trauriger, kraftloser Schluckauf.
»Nein, nein«, schaffe ich endlich erste Worte und strecke die Hand nach ihr aus.
»Matthias?« Gerd, am Telefon.
»Was: nein, nein?« Karin, an der Wand.
»Sie glauben, dass sie entführt worden ist. Aber sie haben sie. Sie lebt«, sage ich mit einer Stimme, die mich selbst kaum erreicht. Und noch mal: »Sie lebt.«
»Was?« Karin rappelt sich ungeschickt auf. Ich greife nach ihrem Arm, als sie auf ihren wackligen Beinen erneut den Halt zu verlieren droht.
»Ja«, sagt der krächzende Gerd am anderen Ende der Leitung. Die Informationen, die er mir gerade gegeben hat, sind vage. Ich weiß nicht, ob er mir nicht mehr sagen kann, will oder darf. Nur so viel: Der Abgleich mit der Vermisstendatenbank habe Ähnlichkeiten ergeben. Er werde am Morgen gleich losfahren, nach Cham an der tschechischen Grenze, zum Krankenhaus, um Lenas Identität zu bestätigen. Cham, nur zweieinhalb Stunden von München entfernt, so nah. Lena ist so nah, war vielleicht die ganze Zeit so nah. Und ich habe sie nicht gefunden.
»Ich komme mit«, poltere ich. »Fahren wir. Nicht morgen früh, jetzt gleich.«
»Nee, Matthias, das geht nicht«, sagt Gerd im Ton eines Erwachsenen, der versucht, ein störrisches Kind zu besänftigen. »Das ist so nicht üblich …«
»Ist mir egal«, bockt das Kind. »Ist mir sogar scheißegal! Ich zieh mich an. Hol mich ab.«
Ich höre Gerd durch die Leitung seufzen.
»Das bist du mir schuldig«, schiebe ich noch hinterher, bevor er ansetzen kann, mir unnötig ausführlich den üblichen Dienstweg zu erklären. »Fahren wir.«