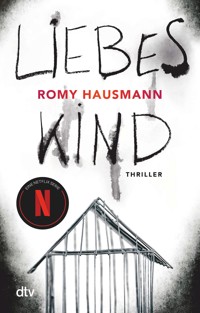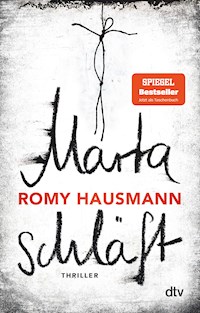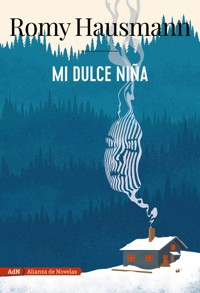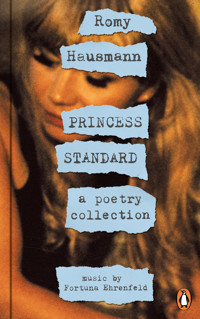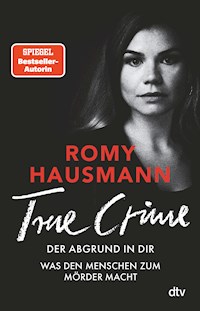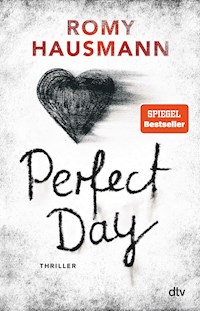
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Macht der Gefühle kann tröstlich sein. Oder tödlich. Meine kleine Prinzessin. So allein. Du zitterst ja, du armes Ding. Komm mit mir, hab' keine Angst. Bei mir bist du sicher. Ich bringe dich an einen geheimen Ort, mein Herz, aber vorher müssen wir hier im Wald noch ein paar rote Schleifen verteilen, schau ... Seit vierzehn Jahren verschwinden Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Rote Schleifenbänder weisen der Polizei den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter fehlt seit vierzehn Jahren jede Spur. Eines Abends wird der international renommierte Philosophieprofessor und Anthropologe Walter Lesniak im Beisein seiner Tochter Ann verhaftet. Die Anklage: zehn Morde an jungen Mädchen. "Professor Tod" titelt die Boulevardpresse. Doch Ann wird die Unschuld ihres Vaters beweisen. Für sie und die LeserInnen beginnt eine Reise in die dunkelsten Räume der menschlichen Seele … »Romy Hausmann ist eine der besten Thriller-Autor*innen Deutschlands« The Sunday Times Bei dtv sind außerdem »Liebes Kind« und »Marta schläft« sowie das Sachbuch »TRUE CRIME. Der Abgrund in dir« erschienen. - Kennt man seine Eltern jemals wirklich? Ein raffiniert konstruierter Psychothriller über Vertrauen, Verrat und die Macht der Gefühle - ›Liebes Kind‹ von Romy Hausmann wurde als große Netflix-Serie verfilmt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Romy Hausmann
Perfect Day
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für dich, Papa.
Für deinen Humor und deine Stärke.
Du bist Iron Man.
Die Macht der Fantasie kann tröstlich sein.
Oder tödlich.
Ann stirbt an einem Donnerstag, sie verreckt ganz jämmerlich. Sie liegt auf dem Rücken, die Beine steif ausgestreckt, die Hände presst sie zitternd auf die klaffende Wunde in ihrem Brustkorb. Die Männer haben ihr Herz mitgenommen, sie haben es ihr aus dem Körper geschnitten und einfach mitgenommen. Sie will schreien, aber das geht nicht, aus ihrer Kehle drängen schon andere Töne, sie gurgelt, sie fiept. Gleichzeitig explodieren Lichter auf ihrer Netzhaut, und das ist anstrengend, so schrecklich anstrengend, und sie wünscht sich, es wäre einfach vorbei, sie kann nicht mehr. Also lässt sie los, lässt sich fallen, schließt die Augen, bereit. Es ist besser dort, hinter ihren geschlossenen Lidern. Dort glitzert die Sonne und der Himmel ist blau, und sie, sie sitzt auf den Schultern ihres Vaters und bewegt die Arme, als könnte sie fliegen. Viele Jahre ist das her, sie ist sieben und Papa nennt sie sein »Käferchen«. Er hält sie fest und sicher an den Beinen, sie muss sich keine Sorgen machen, nie mehr.
So ist das also, konstatiert sie. So ist der Tod.
Und so schnell kann das gehen.
Vor einem Fingerschnippen noch war dieser Donnerstag bloß ein Donnerstag. Sie warteten auf ihr Abendessen, die Pizzalieferung von Casa Mamma. Papa hatte Musik aufgelegt, eine Platte von Lou Reed aus den Siebzigern, als es Ann noch nicht gab, nur die törichte, ungestüme Jugend ihres Vaters. Sie grinste, wenn er so etwas sagte. Sie fand die Vorstellung absonderlich: Papa und töricht – niemals! Aber die Platte, die mochte sie trotzdem. Es gab wahrscheinlich keine, die er öfter spielte; Anns gesamte Kindheit klang danach. Im Kamin knackte Holz, und es roch, als hätte Papa zum Anzünden Altpapier verwendet. Ann hasste den Geruch, er hatte etwas akut Gefährliches. So als könnte gleich in der nächsten Sekunde das ganze Haus in Flammen stehen.
»Wo bleibt das Essen?« Diese Ann-typische Quengelei, und Papa, der sich darüber lustig machte. »Du kannst dich mit etwas Sinnvollem ablenken und noch ein bisschen Feuerholz holen«, sagte er und streckte ihr den Holzkorb entgegen. Ann verzog das Gesicht. Wenn sie Hunger hatte, war sie nicht zu Späßen aufgelegt.
Im Garten hatte der November Gebilde geschaffen, die im Zwielicht von Dunkelheit und Terrassenbeleuchtung nur umso seltsamer wirkten. Die Sträucher, die sich unter der Schneelast krümmten wie bucklige Alte, schienen auf den Berg zuzustreben, unter dem sich ihr altes Trampolin versteckte. Ann stapfte zum Holzverschlag, warf ein paar Scheite in ihren Korb und ging zurück zum Haus.
Und da begann es, das Sterben.
Zuerst das Licht, das von der anderen Seite des Hauses, der Vorderfront, durch die Fenster fiel. Blaue Kreise, die plötzlich durch den Raum tanzten. Ann, die irritiert mit dem Holzkorb dastand, und ihr Vater, der scherzhaft darüber spekulierte, ob ihre Pizza nun per Express und mit Blaulicht angeliefert würde, weil der Lieferdienst gespürt hätte, wie ungemütlich sein Käferchen werden konnte, wenn es hungrig war.
Doch dann.
Die Haustür, die aufsprang, und die Männer, die hineindrangen. Die sich auf Papa stürzten und ihn zu Boden rangen. Offenbar gab es jede Menge Geschrei, denn Ann sah aufgerissene Münder. Aber sie hörte nichts; alle schrien stumm unter dem hohen Ton, der ihren Schädel besetzte wie ein Tinnitus. Die Männer zerrten an ihrem Vater, zerrten ihn auf die Füße, zerrten ihn in Richtung Tür. Ann klammerte sich an ihren Holzkorb. Sie sah, wie Papa eine ruckartige Bewegung machte und sich noch einmal zu ihr umdrehte. Sein völlig leeres Gesicht. Dann schafften sie ihn fort, hinaus in die Nacht. Zwei der Männer blieben im Haus und versuchten ihr zu erklären, was da gerade geschehen war. Ihre Worte schnitten in Anns Brust, sie stießen tiefer und tiefer in sie hinein, bis sie schließlich auf ihr Herz trafen. Ihr Kreislauf sackte weg. Der Korb fiel zu Boden. Erst schlugen die Holzscheite dumpf auf, dann ihr Schädel. Ihr Körper begann zu krampfen, zu zucken, sie röchelte, fiepte, und es war schlimm, bis sie hierhergelangte: in die Welt hinter ihren geschlossenen Lidern, wo ihr Herz noch intakt ist, wo es Sommer ist und sie mit Papas Hilfe fliegen kann. Sie ist sieben Jahre alt und sein »Käferchen«, und Lou Reed singt von einem perfekten Tag …
»Wir brauchen einen Sani!« Von irgendwoher stört eine fremde Stimme, die zunehmend lauter wird. Dass Ann atmen soll, befiehlt ihr die Stimme – einatmen auf eins, ausatmen auf zwei, und vor allem ruhig, ganz ruhig.
»Hier, das Asthmaspray!«
Sie spürt, wie ihr Kopf bewegt wird. Grobe Finger reißen ihr den Mund auf und schieben etwas Hartes hinein. Ihr Rachen wird kalt, ihr Brustkorb entkrampft. Träge schlägt sie die Augen auf. Jemand beugt sich über sie.
»Schön, dass Sie wieder da sind«, sagt der glückliche Idiot, der keine Ahnung von der Hölle hat.
Neue Spur im Fall der Berliner Schleifenmorde: 55-Jähriger nach dreizehnjähriger Fahndung in Haft
Berlin (JW) Im spektakulären Fall der seit 2004 andauernden Mordserie an neun Mädchen hat die Kriminalpolizei am Donnerstagabend einen 55-Jährigen festgenommen. Der Mann sei dringend tatverdächtig, die sechs- bis zehnjährigen Opfer zunächst an unterschiedliche abgelegene Orte im Berliner Umland entführt und anschließend getötet zu haben. Um die Auffindung der Leichen sicherzustellen, hinterließ der mutmaßliche Täter rote Schleifenbänder. So wurde zuletzt die Leiche der Schülerin Sophie K. (†7) in einer Hütte im Königswald entdeckt. Das Mädchen war in der Woche zuvor von einem Spielplatz in Berlin-Schmargendorf verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugenaussage auf die Spur des 55-Jährigen geführt.
Ann
Berlin, 24.12.2017
(sechs Wochen später)
Die Stadt ist wie leergefegt, kein Auto zu sehen, kein Mensch, nicht mal ein herrenloser Hund. Die Schaufenster sind schwarz, die Ladeneingänge mit Rollgittern verrammelt. Berlin ist tot, alle sind es. Bis auf mich. Die letzte Überlebende, die einzig Übriggebliebene nach dem Ende der Welt. Nur ich und Berlin und die allerorts aufgehängte Festtagsbeleuchtung, die in trügerischem Rhythmus blinkt, so als hätte die Stadt eben doch noch einen Herzschlag, einen letzten Rest Leben in sich.
Ich bin in Eile, meine Schritte sind schnell und plump. Schneematsch spritzt mir bis hoch zum Knie. Egal, meine Hose gehört sowieso längst in die Wäsche. Früher war ich eitel, aber das ist vorbei. Zoe hat das Schloss an unserer Wohnungstür austauschen lassen und nur eine kleine Reisetasche für mich im Treppenhaus deponiert. Ab und zu stelle ich mir vor, wie sie in meinen dunkelroten Samtjeans in der Uni sitzt oder bei einem Date mein goldenes Paillettentop trägt. Es ist okay, oder einfach so, wie der Vater von Saskia E. kürzlich in einem Interview gesagt hat: Die Schmerzgrenze verschiebt sich. Dinge, die sich früher wie eine Fleischwunde anfühlten, empfindet man irgendwann nur noch als einen Kratzer. Saskia E. war Opfer Nummer 7, ermordet vor drei Jahren, an Weihnachten 2014.
Ich steigere mein Tempo, hetze Schatten und Schritten davon, die es gar nicht gibt. Manchmal spritzt Blut statt Schnee. Auch das hat Saskias Vater in dem Interview richtig erfasst: Man wird ganz unausweichlich ein bisschen verrückt. Er lenkt sich ab, indem er durch sämtliche Medien tingelt; ich lenke mich auch ab, aber mit der Arbeit. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer sich ausgerechnet heute in einen schmuddeligen Fast-Food-Schuppen wie das Big Murphy’s verirren sollte – das müssen schon sehr, sehr einsame Menschen sein. Die Wahrheit ist: Die Stadt ist nicht tot. Sie lebt noch, natürlich, und wie. Sie hat sich nur zurückgezogen in ihre warmen, liebevoll geschmückten Wohnzimmer. Sie sitzt an reichlich gedeckten Esstischen, auf denen gefaltete Servietten ausliegen und das gute Besteck. Sie überreicht einander Geschenke und erfreut sich an leuchtenden Augen. Sie ist glücklich, diese Stadt, und wer heute übrigbleibt, ist nichts anderes als ganz unten. Es ist Sonntag. Und Heiligabend.
»Da bist du ja endlich!« Hinter der Kassentheke rudert Antony mit den Armen. Er ist Kubaner, gerade einundzwanzig und seit zwei Jahren in Berlin, ganz allein, ohne seine Eltern und die vier Geschwister, die immer noch in Moa leben, einer Industriestadt an der Nordostküste Kubas. Er braucht das Geld, das er bei Big Murphy’s verdient, um sein Studium und sein WG-Zimmer zu finanzieren, aber hauptsächlich für die Überweisung, die er monatlich per Western Union nach Hause tätigt.
Ich drücke die gläserne Eingangstür hinter mir zu und blicke mich um. Bloß ein einziger Tisch ist besetzt, von einem alten Mann, dessen Gesicht nur aus Augen und Bartwuchs zu bestehen scheint. Er trägt einen schmutzigen braunen Mantel, und ich erkenne löcherige Fingerstulpen, als er in diesem Moment in einen schlappen Burger beißt. Ketchup tropft aus dem Brötchen wie dicke, rote Tränen.
»Ja, zum Glück, bei dem Andrang«, murmele ich im Vorbeigehen und verschwinde in die Umkleide.
Meine Uniform besteht aus einem kurzärmeligen, grünen Polyestershirt und einer braunen Hose, die sich an den Seiten öffnen lässt; Belüftungsschlitze, die man zu schätzen weiß, wenn in der engen Küche des Fast-Food-Restaurants in fünf Fritteusen gleichzeitig 180 Grad heißes Öl sprudelt.
Es ist nicht der beste Job, aber einer, der fast sträflich leicht zu bekommen war. Keine schriftliche Bewerbung, keine Zeugnisse, kein Lebenslauf. Nur ein Anruf und am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch unter dem Mädchennamen meiner toten Mutter. Die Managerin mochte mich sofort, ich machte einen unkomplizierten Eindruck. Arbeitszeiten, Überstunden, selbst die Vergütung: egal. Mich interessierte nur, ob es möglich war, mir meinen Lohn in bar auszuzahlen. War es, solange ich den Erhalt mit meiner Unterschrift quittierte. Nach einer Schulung in Hygienerichtlinien und Infektionsschutz und noch einer weiteren in Sachen Unfallverhütung wurde ich direkt eingearbeitet.
Heute sind wir nur zu dritt im Laden: Antony, der sich um die Kasse und die Getränke kümmert, Michelle, die in der Küche die Burger zubereitet, und ich, die ihr nebenbei assistiert, weil beim Drive-in, für den ich zuständig bin, sowieso niemand vorfährt. Natürlich nicht, es ist schließlich Heiligabend.
»Ann? Geht’s dir gut? Du bist so still heute.« Liebe, süße, einfache Michelle. Wie besorgt sie klingt. Sie ist Mitte vierzig, mit gelbstichig gefärbten Haaren und immer stark geschminkt, was sie zu Beginn ihrer Schicht mindestens fünf Jahre jünger aussehen lässt, später aber, wenn sich ihr Make-up in den Augenfältchen abgesetzt hat, genau den gegenteiligen Effekt hat.
»Klar, alles prima«, sage ich und fingere grundlos in dem Behälter mit den Tomaten herum.
Michelle knufft mich aufmunternd in die Seite. »Ich finde Weihnachten auch deprimierend, falls es das ist, was dir zu schaffen macht. Drei Tage lang tun alle so, als wäre die Welt in Ordnung, Liebe-Frieden-Lichtlein-an. Als ob.« Michelle ist alleinerziehende Mutter von zwei halbwüchsigen Söhnen und einer erwachsenen Tochter. Ihre Große feiere schon seit Ewigkeiten kein Weihnachten mehr mit ihr, und auch die Jungs seien dieses Jahr bei ihrem Vater. »Und deine?«
Sie meint meine Tochter. Ich hatte sie, weil mir auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen war, Diana genannt, nach der römischen Göttin der Jagd – nicht, wie Michelle glaubt, nach der toten Prinzessin. Aber im Grunde ist es auch egal, wie meine Tochter heißt. Sie ist mir passiert, als ich gerade achtzehn war, sorglos und naiv, eben eins von diesen jungen, dummen Dingern, die einfach nicht aufpassen können. Jetzt bin ich vierundzwanzig und muss Geld für sie verdienen, so wie alle hier bei Big Murphy’s für irgendjemanden Geld verdienen müssen. Ich sage nur: »Auch bei ihrem Vater«, und fummele weiter an den Tomaten herum. Ich will Michelle nicht ansehen.
»Was schenkst du ihr?«, fragt sie als Nächstes, und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist: »Ein Trampolin.«
So wie das Trampolin, das ich zu Weihnachten bekommen habe, als ich in Dianas Alter war. Der Karton, der das Gestänge enthielt, war braun und so riesig, dass man mehrere Rollen Geschenkpapier benötigt hätte, um ihn einzuschlagen. Mein Vater hatte deshalb einfach nur eine große, rote Schleife darumgebunden. Sobald es Frühling wäre und die Sonne die letzte Schneenässe aus dem Boden gesogen hätte, würde er es im Garten aufbauen, mit seinen beiden linken Händen, dem rührenden Ungeschick eines Akademikers. Er würde es so aufstellen, dass er, wenn er in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch säße, nur aus dem Fenster zu blicken bräuchte, um mich springen zu sehen. Mir gefiel mein Geschenk, das schon. Nur konnte ich jetzt, im tiefsten Winter, nichts damit anfangen. Also bat ich ihn, die Metallstangen aus dem Karton zu entfernen. Und dann legte ich mich hinein und klappte den Deckel zu. Das fand mein Vater interessant, erstaunlich, eigenartig. Mit diesem Blick, der immer alles analysieren will, fragte er mich, was ich mir dabei vorstellte, wenn ich mucksmäuschenstill, mit geschlossenen Augen und reglosen Gliedern in meinem Karton lag. Er dachte, es hätte vielleicht etwas mit meiner Mutter zu tun. Dass ich ausprobieren wollte, wie es sich so lag, in einem Sarg. Ich entgegnete: »Aber Papa. Das ist doch kein Sarg. Es ist einfach nur ein Karton und ich liege drin.«
»Toll!« Michelle wirkt aufrichtig begeistert, bevor ihr Gesicht in der nächsten Sekunde etwas Trauriges annimmt. Ich weiß, dass sie Angst hat, ihre Söhne könnten nach ihrem Ex schlagen, der wegen Körperverletzung schon zweimal im Gefängnis saß. »Genieß es, solange deine Diana noch klein ist.« Seufzend wischt sie sich mit dem Handrücken über die schweißglänzende Stirn. »Kaum sind sie älter als zwölf, bist du abgeschrieben und sie klauen dir Geld aus dem Portemonnaie, um sich Gras zu kaufen.« Als sie die Hand wieder aus dem Gesicht nimmt, sind braune Spuren daran erkennbar und ihre linke Augenbraue ist etwas farbloser als zuvor. Jetzt lacht sie wieder, so wie sie immer lacht, wenn sie feststellt, dass es offenbar kein besseres Abschminkmittel gibt als Bratfett. Vielleicht lacht sie auch nur, um nicht zu weinen. Ich kenne das Gefühl, aber ich schäme mich trotzdem. So viele Lügen. Vielleicht würde Michelle es ja sogar verstehen, wenn ich es ihr erklärte. Vielleicht würde sie mich gar nicht verurteilen, sie ist ein guter Mensch. Andererseits hatte ich das von Zoe auch gedacht.
»Erde an Ann! Ann, bitte kommen!« Michelle spricht mit verstellter Stimme in ihre geballte Faust hinein wie in ein Funkgerät. Mütter sind wohl einfach so. Wenn ihre Kinder klein sind, gewöhnen sie sich irgendwelche Albernheiten an, die sie nie wieder loswerden.
»Sorry, ich war in Gedanken.«
»Hab ich gemerkt.« Schmunzelnd deutet sie auf den Monitor, der das Bild aus dem Drive-in überträgt. Gerade ist ein Auto vorgefahren. »Kundschaft.«
Ich stülpe mir eilig das Headset über den Kopf und atme noch einmal tief, bevor ich den Knopf drücke, der das Mikrofon mit der Sprechanlage im Außenbereich verbindet. »Frohe Weihnachten und willkommen bei Big Murphy’s Burgers and Fries.« Ich kann nicht fassen, wie freundlich ich klinge, wie unbeeindruckt. Dass ich anscheinend auch so einen Knopf habe, genau wie mein Headset – einen inneren Knopf, der mich, wenn ich ihn nur fest genug drücke, in einen anderen Modus versetzt. Man funktioniert eben, hat der Vater von Saskia E. in der Zeitung gesagt, und es stimmt. »Ihre Bestellung, bitte.«
Zuerst rauscht nur die Leitung.
»Hallo?«
Irritiert recke ich den Hals aus dem Ausgabefenster. Die Sprechanlage liegt fünf oder sechs Meter davon entfernt; erst nachdem sie ihre Bestellungen aufgegeben haben, fahren die Kunden weiter bis zur Ausgabe vor. Auf diese Entfernung jedoch sehe ich nur den Schemen eines Wagens und wie die Scheinwerfer zwei grelle Kreise ins Dunkel des späten Nachmittags stanzen.
Da verstummt das Rauschen, und die Stimme eines Mannes knarzt: »Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du mir so leicht davonkommst?«
Schrekk. (Ann, 7 Jahre alt)
ein Schrekk ist wie wenn der Mensch innen drin einen Strohmschlag kriegt. das Herz springt einmal von seinem Platz und wenn es sich wieder setzt dann schlägt es trotzdem noch schneller als forher und manchmal tut das sogar weh. in den Ohren rauscht es und es wird einem so kalt das man liber gleich zittert. dann weiß der Schrekk das er fungsionirt hat und hört villeicht auf. manchmal ist der Schrekk aber auch nur ein Scherz. dann hat man sich umsonst erschrokken und muss lachen weil man so dumm war das man auf den Schrekk rein gefallen ist.
»Du Blödmann!«
Ich lache hysterisch. Jakob, es ist nur Jakob, der da draußen in seinem Auto sitzt und mir durch die Sprechanlage einen Heidenschreck eingejagt hat. Jakob, der jetzt auch lacht.
»Was für eine Begrüßung. Ich glaube, ich beschwere mich bei der Geschäftsführung.«
»Um mich an Weihnachten feuern zu lassen? Sehr charmant.« Ich bemerke Michelles Blick und flüstere: »Jakob«, woraufhin sie grinsend ihre linke, farblose Augenbraue nach oben zieht. Es ist mir peinlich, dass sie von uns weiß, auch wenn es im Grunde gar nichts zu wissen gibt. Ich justiere das Mikrofon vor meinem Mund und recke erneut den Hals aus dem Ausgabefenster. Noch immer sehe ich nicht mehr als den Wagen in der Dunkelheit und zwei ausgestanzte Lichtkreise.
»Was machst du hier, Jakob?«
»Du hast gesagt, du hasst Weihnachten und willst es nicht feiern. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht zulassen kann.«
»Stimmt wohl.«
Das war gestern. Ich hatte Kassendienst, als Jakob vor dem Tresen auftauchte und ein »Big Murphy’s Mega Menu« bestellte. Er kommt oft her, fast täglich. Inzwischen richte ich sogar meine Pause nach ihm aus. Dann fegen wir den Schnee von der Bank auf dem Parkplatz vor dem Big Murphy’s und sitzen dort im verschämten Abstand zweier Menschen, die sich eigentlich gerne zu einem richtigen Date verabreden würden. Aber sie tun es nicht; das Mädchen hat Gründe und der Junge offenbar genug Feingefühl, um zu ahnen, dass er sich einen Korb einfangen würde. Er hält sie für eine Germanistikstudentin, die bei Big Murphy’s arbeitet, um sich ihre Miete zu verdienen. Und für etwas spröde wahrscheinlich. Also versucht er sie locker zu machen, indem er ihr lustige Anekdoten von seiner Arbeit auf einem Recyclinghof in Kreuzberg erzählt. Sie mag den Gedanken, dass er den Leuten dabei hilft, ihre Altlasten loszuwerden. Ihren Sperrmüll, ihre abgetragenen Kleider, Farbdosen, Kartonagen, Batterien, Gartenabfälle. Und am meisten gefällt ihr die Vorstellung, wie er auf die übervollen Papiercontainer klettert und auf den Bergen herumtrampelt, bis sie sich unter seinem Gewicht absenken und wieder neuen Platz freigeben. Wie seine schlaksigen Arme dabei durch die Luft rudern, seine kurzen, dunklen Locken wippen und seine blauen Augen vor kindlichem Übermut glänzen. Er kommt ihr so unbelastet vor, so frei.
»Na ja, und deswegen hatte ich die Idee, dass wir vielleicht …«
Ich seufze. Ausgerechnet heute scheint Jakob beschlossen zu haben, den Abstand zwischen uns zu verringern.
»Geht nicht, tut mir leid.«
»Du weißt doch noch gar nicht …«
»Muss arbeiten.«
»Kein Problem, ich warte auf dich.«
»Meine Schicht geht bis neun.«
»Macht nichts.«
»Nein, das ist zu lange. Abgesehen davon werde ich müde sein und nach Fritteuse stinken.« Ich zupfe mir eine fettige schwarze Haarsträhne vor die Augen, betrachte sie und überlege, ob ich gestern Abend überhaupt noch geduscht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Es fällt mir nicht ein. Ich erinnere mich nur noch an ein fades Mikrowellengericht und wie ich wie ein Sack Mehl auf der Couch im Wohnzimmer hing und mir ›E.T. – Der Außerirdische‹ angeschaut habe, weil ich weinen wollte, einmal ganz befreiend, nur aus Rührung, nicht vor Schmerz. »Ein andermal, okay?« Zu meiner Erleichterung sehe ich auf dem Monitor, wie sich ein weiteres Auto hinter Jakobs in die Spur zum Drive-in schlängelt. »Du musst jetzt bestellen oder den Weg freimachen.«
Ich höre ihn noch etwas Unverständliches brummen. Dann fährt er am Ausgabefenster vorbei, sehr zügig und ohne Seitenblick. Kurz schließe ich die Augen und atme durch. Ich drücke den Knopf am Headset, genau wie den anderen, den inneren Knopf, lächle und sage: »Frohe Weihnachten und willkommen bei Big Murphy’s Burgers and Fries. Ihre Bestellung, bitte.«
Weißt du noch …?
22. Dezember 2014, Weihnachten vor drei Jahren.
– Was ist verkehrt an unserem Baum?
– Er ist aus Plastik, Ann.
– Er ist Tradition, Papa! Wir haben diesen Baum, seit ich denken kann.
– Umso schlimmer.
– Und jetzt?
– Ich kenne da eine Stelle im Blumenthaler Wald …
– Du willst selbst einen schlagen? Nicht dein Ernst, Papa. Mit einer Axt?
– Nein, ich will am Stamm nagen, bis ich ihn durchgebissen habe. Natürlich mit einer Axt!
– Erinnerst du dich noch, als du damals mein Trampolin aufbauen wolltest? Du hast dir mit dem Akkuschrauber in den Finger gebohrt.
– Stand das Trampolin am Ende, oder nicht?
– Mussten wir am Ende in die Notaufnahme, oder nicht?
– Jetzt komm schon, mein Käferchen. Es ist wunderschön dort, wo ich mit dir hinwill. Und wir werden einen richtigen Weihnachtsbaum haben, wie ganz normale Leute.
– Seit wann wollen wir wie die anderen sein? Mal ganz abgesehen davon, dass man nicht einfach so in den Wald marschieren und irgendwelche Bäume umnieten darf. Stell dir mal vor, das würde jeder machen!
– Wir lassen uns einfach nicht erwischen.
– Du bist verrückt.
– Und du bist meine Tochter, also: Willkommen im Club.
Und genau das waren wir doch immer, Papa, oder? Ein ganz exklusiver Club, nur wir beide, im Zweifel gegen den Rest der Welt. Du hast mich getröstet, wenn ich wegen Mama weinen musste. Mich gelassen, wenn ich sie gehasst und in die Hölle gewünscht habe. Du hast mir Zöpfe geflochten und Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Du hast mir die Sache mit dem Frausein erklärt, mir Tee gegen die Krämpfe und Schokolade gegen den Heißhunger gebracht. Du hast mich gedeckt, als ich Nico im ersten großen Liebeskummer den Rahmen seiner 125er zerkratzte, weil er mit meiner damals besten Freundin Eva rumgemacht hatte.
Daraufhin schlug seine Mutter bei uns auf.
»Meine Tochter soll so etwas getan haben?«, hast du sie gefragt. »Niemals.«
»Aber ich selbst habe sie gestern Abend in unserer Straße rumlungern sehen, und heute Morgen war der Schaden angerichtet! Wissen Sie, wie lange Nico darauf gespart hat?«
»Das tut mir natürlich sehr leid, aber Sie müssen sich irren. Meine Tochter war gestern den ganzen Abend zu Hause. Wir haben zusammen Schach gespielt.«
Und du hast mich immer gewinnen lassen beim Schach, weil du nicht wolltest, dass ich mich wie eine Versagerin fühlte. Du kennst mich so gut, Papa. Und ich kenne dich.
Deswegen ist es jedes Mal wieder ein Schock.
Da hilft auch kein verpixeltes Fotogesicht.
Sie schreiben über dich, sie sind sich ihrer Sache so sicher.
Ich stehe vor einem Zeitungskasten auf halber Strecke des Heimwegs und starre in das von einer Straßenlaterne beleuchtete Sichtfenster auf die morgige Ausgabe einer der größten Berliner Tageszeitungen, die auf dem Titelblatt darüber berichtet, wie die Familie E. plant, die Weihnachtsfeiertage zu verbringen, nachdem der mutmaßliche Täter, der Mann, der ihnen all das angetan haben soll – du! –, endlich im Gefängnis sitzt, zumindest in Untersuchungshaft. Dass sie seit drei Jahren zum ersten Mal wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen werden, wird Jörg E. (43) in dem Artikel zitiert. Er weine und lächle zugleich, schreibt der Redakteur dazu. Am Ende des Aufmachers steht: »Lesen Sie weiter auf Seite 3.« Ich weiß nicht, ob ich das will. Es reicht, dass ich mich an diese Begebenheit von 2014 erinnere. Das erste Mal, dass du einen echten Baum haben und, um diesen selbst zu schlagen, in den Blumenthaler Wald wolltest. 2014, zugleich das erste Weihnachtsfest, das die Familie E. ohne ihre »geliebte kleine Saskia (†8)« verbringen musste. Diese war wenige Tage zuvor von einem Unbekannten entführt worden. Man fand sie in der ersten Januarwoche tot in einer Hütte. Im Blumenthaler Wald.
Ein Zufall, ich weiß, Papa.
Du bist kein Mörder.
Sie irren sich so schrecklich, aber das wollen sie einfach nicht einsehen. Lieber verbreiten sie weiter ihre Lügen, ihre Lügen, ihre gottverdammten Lügen.
Wut. (Ann, 7 Jahre alt)
die Wut ist unsichtbar wie Luft und schlüpft in einen rein wenn man sich sehr ärgert. zuerst krigt man einen Kloß im Hals und atmet wie ein Stier. das Herz fengt an ganz schnell zu schlagen und man beist die Zähne aufeinander um sich wieder zu beruhigen. aber das klappt nicht weil die Wut viel stärker ist als der Mensch. sie explodiehrt im Körper und weil der Mensch das nicht aushält fängt er an seine Arme und Beine zu bewegen und haut einfach los oder tritt. nur so kommt die Wut wieder aus dem Körper raus und lässt einen in Ruhe. ich war auch schon mal wütend und zwar auf meine MAMA. aber ich hätte sie nicht gehauen weil sie krank war. man darf niemand hauen der krank ist. jetzt ist sie leider tot.
Jemand brüllt: »Ann!«, und umklammert meine Taille. Ich werde von den Füßen gerissen und trete ins Leere, wo eben noch der Zeitungskasten einen Widerstand bot. Ich strampele trotzdem weiter. Ich will nicht aufhören, ich kann nicht. Ich will die Lügen zerstören, selbst wenn es in diesem Moment nur einen Zeitungskasten trifft.
»Ann!«, noch einmal, und der Griff um meine Taille, der sich verstärkt. »Scheiße, was machst du denn da?« Ich werde herumgewirbelt. »Hör auf!«
Ich denke nicht daran; ich will kämpfen, zerstören. Metall knirscht, Plastik zerspringt, Papier zerfleddert. Bis mich allmählich die Kraft verlässt.
»Alles gut«, sagt die Stimme. Sie gehört zu Jakob – schon wieder Jakob. Der mich jetzt, wo ich mich endlich beruhige, vorsichtig aus seiner Umklammerung entlässt. Wortlos blicken wir erst einander an, dann auf das, was einmal ein Zeitungskasten war. Die Halterung grätscht auseinander, die Box ist zerbeult, durch das Plexiglas des Sichtfensters zieht sich ein Riss. Die Zeitungen liegen zerfetzt im Schneematsch.
Erschöpft trolle ich mich in den nächsten Hauseingang, ich muss mich setzen. Die Stufen sind kalt und nass, es stört mich nicht; ich schwitze und keuche wie nach einem Marathon. Vor mir auf dem Fahrradweg steht mit geöffneter Fahrertür Jakobs roter Jeep. Er setzt sich neben mich. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen will er wissen, was da gerade geschehen ist; die passenden Worte hat er nicht parat. Ich weiß genauso wenig, was ich sagen soll. Wie ich diese Randale erklären könnte, diese ihm völlig unbekannte, andere Ann, die wie eine Geisteskranke auf einen Zeitungskasten eintritt. Außer natürlich mit der Wahrheit.
Hast du dich jemals gefragt, ob der Mann aus der Zeitung, das »Monster«, wie sie ihn nennen, Familie hat? Hat er, Jakob. Nämlich mich. Ich bin die Tochter des mutmaßlichen Schleifenmörders, der in den letzten dreizehn Jahren neun kleine Mädchen entführt und getötet haben soll. Ich war dabei, als sie ihn verhaftet haben. Ich hatte ihn besucht, an diesem Donnerstagabend vor sechs Wochen. Wir hatten Pizza bestellt, Lou Reed aufgelegt und eine Flasche Rotwein geöffnet. Es hat geklingelt; wir dachten, es wäre der Pizzabote. Aber es war ein Einsatzkommando, bestimmt ein Dutzend Männer. Sie haben sich auf ihn gestürzt, ihm Handschellen angelegt und ihn abgeführt. Mich wollten sie auch mitnehmen, ich sollte eine Aussage machen, aber ich hatte einen Asthmaanfall. Und was hätte ich ihnen auch sagen sollen? Er ist unschuldig, ihr Idioten! Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft, sie knüpfen noch an ihren lächerlichen Beweisketten, die am Ende den Strick um seinen Hals ergeben sollen. Deswegen bin ich so wütend, Jakob. Ich bin wütend und ich habe furchtbare Angst.
Ich sage nichts von alledem, ich schweige. Weil es doch sowieso sinnlos ist. Zoe hat es ja auch nicht verstanden, dabei kennen wir uns seit fast drei Jahren und haben sogar zusammengelebt. Nicht, dass sie meinen Vater für schuldig halte, nein, nein, um Gottes willen. Und es tue ihr auch wahnsinnig leid, aber sie habe da halt einfach kein gutes Gefühl. Bestimmt kämen bald die Journalisten und belagerten unsere Wohnung. Das Getuschel in der Uni und die Tatsache, dass sie zwei jüngere Geschwister habe, vom Alter her passend zum Beuteschema des Täters. Bitte, Ann, sei mir nicht böse. Aber nein, Zoe, passt schon.
»Geht’s wieder?«, fragt Jakob.
Ich brumme.
»Okay, gut.« Er streckt die Hände aus und richtet mir den Kragen der alten, dick gefütterten Jeanskutte. Es ist Papas Jacke, in der ich versinken kann, nicht nur körperlich. Manchmal, wenn ich sie vom Garderobenhaken nehme, stelle ich mir vor, dass er sie gerade erst ausgezogen und dort aufgehängt hat, und wenn ich dann hineinschlüpfe, bilde ich mir ein, noch etwas von seiner Restwärme zu spüren.
Im Reflex schlage ich Jakobs Hände weg.
»Entschuldige«, sagt er erschrocken. »Ich wollte nur …«
»Nein, nein, schon gut. Mir tut’s leid. Ich bin heute ein bisschen empfindlich. Was machst du hier?«
Er zuckt die Schultern.
»Ich war noch mal bei Big Murphy’s, weil ich gehofft habe, du hättest es dir vielleicht anders überlegt. Aber da habe ich nur noch deine Arbeitskollegin getroffen. Sie sagte, du seist schon weg, also wollte ich nach Hause fahren. Und dann …« Mit dem Kopf deutet er erst zur Straße, was wohl heißen soll, dass er zufällig hier vorbeigekommen ist, und anschließend zu dem demolierten Zeitungskasten.
»Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Eine leicht ausgeartete Weihnachtsdepression womöglich.«
Ich versuche es zur Ablenkung mit einem Lächeln, aber Jakob bleibt unangenehm ernst.
»Du hast mich belogen, Ann«, kommt es wie ein Eimer kaltes Wasser in mein Gesicht.
Ich blinzele hektisch. »Was?«
»Deine Tochter.«
»Meine …?«
»Das hat deine Kollegin eben zu mir gesagt: dass sie dich etwas früher nach Hause geschickt habe, damit du noch das Trampolin aufbauen kannst, bevor deine Tochter morgen von ihrem Vater zurückkommt.« Wie in Zeitlupe wandert sein Blick zu dem Haufen zerfledderter Zeitungen, die mit den Mädchenmorden titeln.
Es trifft mich schlagartig.
Meine distanzierte Art. Meine vernachlässigte Erscheinung mit den ungewaschenen, schwarz gefärbten Haaren und der Kleidung voller Flecken. Mein blasses Gesicht, Augenringe von schlaflosen Nächten. Dieser Ausbruch von Zerstörungswut. Und vor allem: eine Tochter, von der ich ihm nie erzählt hatte. So als gäbe es sie überhaupt nicht – mehr.
Wir
Du bist wie ein Lied, das sich im Kopf festgesetzt hat, eine hartnäckige Melodie. Du bist meisterhaft arrangiert, ein perfekter Akkord aus Schönheit und Unschuld; jeder einzelne deiner Töne trifft mitten in mein Herz. Ich spitze die Lippen und summe dich vor mich hin, leise nur, ganz leise, denn niemand darf dich hören. Ich will dich nicht teilen. Nie mehr.
Ich bin gekommen, lautlos wie ein Geist, wie ein Schatten in der Nacht. Ein Schraubenzieher und dreißig Sekunden, mehr brauchte der Schatten nicht, um das Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Es sind nur zwei Stellen, wo man bei einem Standardfenster den Schraubenzieher ansetzen muss, das wusste der Schatten aus einer Videoanleitung, die ausgerechnet die Polizei ins Netz gestellt hatte, um vor den Tricks der Einbrecher zu warnen und den Einsatz von Sicherheitsfenstern zu bewerben. Idioten. Ich kletterte hinein, schlich durch das Gebäude, fand dich schlafend wie einen Engel. Das Mondlicht auf deinem Gesicht, wie schön du warst, so wunderwunderwunderschön.
»Wach auf, Prinzessin«, flüsterte ich leise, und tatsächlich, du öffnetest die Augen. Sahst mich an, als hättest du mich längst erwartet. Und das hattest du, nicht wahr? Ich konnte es in deinem Gesicht lesen. Du musstest nichts sagen, ich hörte deine Gedanken, klar und deutlich wie Worte. »Nimm mich mit«, flehtest du. Vorsichtig hob ich dich in meine Arme. Dein Kopf lag ruhig an meiner Schulter, du ließest dich einfach davontragen. Wir verschwanden durch das Fenster, durch das ich gekommen war, und liefen zu dem Wagen, den ich gemietet hatte. Auf der Rückbank lag schon die kuschelige, warme Decke bereit, in die ich dich jetzt einwickelte. Schließlich ist es Winter und du solltest nicht frieren. »Schlaf noch ein bisschen, mein Schatz«, sagte ich dir. »Und hab keine Angst. Wenn die Sonne aufgeht, werden wir woanders sein, weit weg, wo niemand uns finden wird.«
Und ich habe Wort gehalten, stimmt’s?
Niemand hat uns gefunden, niemand hat eine Ahnung.
Du und ich, oder der Tod. So einfach ist das.
Ann
Berlin, 25.12.2017
Zuerst ist da nur das Rauschen in meinen Ohren, dann folgt der stechende Schmerz in meinem Schädel. Ich versuche die Augen zu öffnen, vergeblich. Meine Lider sind schwer, meine Wimpern kleben aneinander. Ich liege weich, aber unbequem. Vorsichtig bewege ich mich, strecke zuerst die Beine aus, führe dann die Hand zum Kopf, dorthin, wo der Schmerz sticht und wütet.
Was ist passiert?
Gestern Abend …
Jakob, der nach meiner Tochter fragte. Mir dämmerte ein grauenvolles Missverständnis. Er hielt mich für die Mutter eines der Opfer, die ausgeflippt war, nachdem die Zeitung sie daran erinnert hatte, dass sie nie wieder ein Weihnachtsfest mit ihrem Kind verbringen würde. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und davongelaufen. Aber ich ahnte, dass das alles nur schlimmer machen würde. Und dass Jakob der Typ wäre, der einem in so einer Situation hinterherrannte. Mir blieb also nichts anderes übrig, als ihm zu gestehen, dass ich meine Tochter bloß erfunden hatte.
»Ich dachte wohl, dass ein paar Sympathien nicht schaden könnten, wenn ich sonst schon keine Qualifikationen für den Job mitbrachte. Denn weißt du, alle bei Big Murphy’s haben Kinder oder Familien, für die sie arbeiten müssen, und das schweißt sie irgendwie zusammen. Sie sind anders als ich.«
»Wie bist du denn?«
Ich zuckte die Schultern. »Kompliziert, schätze ich.«
»Ach?«
»Na ja, im Groben stimmt es ja schon, was ich dir über mein Germanistikstudium erzählt habe. Zumindest habe ich bis vor kurzem studiert. Nur brauche ich momentan eine Pause, verstehst du? Um über mein Leben nachzudenken und so.«
»Ein kleine Krise also?«
»Sozusagen.«
»Und der Zeitungskasten?«
»Okay«, gab ich zu. »Vielleicht ist es doch eine etwas größere Krise. Weihnachten ätzt.«
Jakob seufzte. »Komm, ich fahr dich heim.« Er erhob sich und streckte mir die Hand entgegen. »Keine Sorge, das ist kein Date, bloß eine Mitfahrgelegenheit. Schließlich kann man nie wissen, welche Verrückten sich um diese Uhrzeit auf den Straßen herumtreiben.«
Unwillkürlich huschten meine Augen nach rechts und links über die weihnachtstoten Straßen. Hier war niemand. Niemand außer ihm und mir. Ich stieg trotzdem ein, und anstatt mich einfach ein paar Straßen entfernt absetzen zu lassen und in den Eingang eines x-beliebigen Mehrfamilienhauses zu verschwinden, dirigierte ich ihn gedankenlos zu unserem Haus.
Hier bin ich aufgewachsen. Hierhin bin ich zurückgekrochen, nachdem Zoe mich aus unserer Wohnung geschmissen hatte. Mein Zuhause, das seit der Durchsuchungsaktion allerdings auch nicht mehr das ist, was es einmal war. Drei Tage lang hat die Polizei auf der Suche nach potenziellem Beweismaterial alles auf den Kopf gestellt und ist dabei nicht zimperlich vorgegangen. Sogar eines der Fotos vom Kaminsims ist kaputtgegangen. Durch das Glas, hinter dem mein Vater und ich Grimassen schneidend vor dem Eiffelturm stehen, zieht sich jetzt ein dicker Riss. Jedes Mal, wenn mein Blick darauf fällt, zerfetzt es mir das Herz.
Jakob ahnte davon nichts, als er seinen Jeep gestern Abend in unsere Einfahrt stellte. Er sagte: »Wow, ein schönes Haus«, aber das stimmte nicht. Ohne Papa war es nur leer und kalt und dunkel, wie ein hässliches schwarzes Loch inmitten der stimmungsvoll beleuchteten Nachbarschaft. Plötzlich wollte ich nicht mehr aussteigen.
»Erzähl mir von deiner Idee«, bat ich.
»Welcher Idee?«
»Na die, mit der du mich heute Nachmittag bei Big Murphy’s überraschen wolltest.«
Er grinste. Seine Idee waren zwei Sixpacks, die hinter dem Beifahrersitz warteten …
Ich blinzele. Erkenne verschwommen unseren Couchtisch, darauf ein Dutzend Bierflaschen; einige davon sind umgefallen, und aus der kleinen Kristallschale, aus der es am Abend der Verhaftung noch Pralinen gab, quillen Zigarettenstummel. Der unsinnige Gedanke, aufzustehen und das Chaos zu beseitigen, bevor Papa heimkommt, schießt mir durch den Kopf. Besonders über die Kippen würde er sich aufregen. Mein Asthma ist nicht schlimm, aber eine Tatsache. Ich setze mich auf, stütze die Ellenbogen auf die Oberschenkel und vergrabe mein Gesicht in den Händen. In meinem Kopf finden Bauarbeiten statt; es wird gehämmert, gebohrt, gesägt und planiert, alles gleichzeitig. Zusätzlich klappert aus der Küche Geschirr, kurz darauf ist die Kaffeemaschine in Betrieb.
Ich fasse es nicht. Nicht nur, dass Jakob jetzt weiß, wo ich wohne. Ich habe ihn sogar mit hineingenommen, ihn und sein Bier. Wir haben den Abend und die Nacht zusammen verbracht. Und: Er ist immer noch hier.
»Guten Morgen!«, wie auf Kommando, irgendwo unter dem Baustellenlärm in meinem Kopf. Ich höre, wie Glas gegeneinanderklirrt; Jakob räumt den Couchtisch auf. Ein paarmal läuft er vom Wohnzimmer in die Küche und wieder zurück. Ich verharre in meiner Position, bis der Tisch sauber ist und eine Tasse Kaffee darauf steht.
»Wie fühlst du dich?«
»Kater.«
»Kein Wunder«, sagt er und lacht. »Bei deiner sechsten Flasche hab ich aufgehört zu zählen.«
Ich greife nach meiner Tasse, weniger aus dem Bedürfnis heraus, zu trinken, als um von meiner Verlegenheit abzulenken. Jakob setzt sich mir schräg gegenüber auf die Kante des Couchtischs, so nah, dass sich unsere Knie fast berühren.
»Wie spät ist es?«, frage ich, nachdem ich eine Zeitlang bloß in meinen Kaffee hineingepustet und versucht habe, mich zu ordnen. Um elf muss ich in Moabit sein. Ich darf meinen Vater sehen, unter den strengen Regeln eines Besuchs in der Untersuchungshaft: 1. Man darf nicht über den Tatvorwurf sprechen. 2. Ein Beamter der JVA wird dem Gespräch beiwohnen. 3. Alles wird auf Video aufgezeichnet.
»Erst kurz nach neun«, antwortet Jakob und deutet auf die Kleidung, die ich gestern schon getragen und in der ich auch geschlafen habe. »Du kannst also vorher noch in Ruhe duschen gehen.«
Vorher, das Wort und seine Bedeutung brauchen etwas, um sich zu setzen. Doch dann. Entsetzt stelle ich meine Tasse zurück auf den Tisch, Kaffee schwappt hinaus.
»Keine Sorge, Ann. Es ist nichts passiert letzte Nacht. Du hast hier geschlafen und ich dort.« Über seine Schulter hinweg nickt er in Richtung der zweiten Couch, die meiner, getrennt durch den Couchtisch, gegenübersteht. Aber ich weiß sofort, dass das nicht stimmt. Dass eben doch etwas passiert ist. Das Schlimmste. Und Jakob weiß es auch. Ein Unbehagen breitet sich aus, so als würde das komplette Wohnzimmer literweise mit einem zähen Brei geflutet, und der Pegel steigt und steigt und steigt uns bis zum Kinn.
»Tut mir leid. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich sich die Situation für dich anfühlen muss. Oder nein …« Er schüttelt den Kopf. »Eigentlich kann ich mir das nicht annähernd vorstellen. Es ist nur: Wenn du einen Freund brauchst, bin ich gerne für dich da.« Er hebt die Hände und fügt hinzu: »Keine Hintergedanken, Ehrenwort.« Es beruhigt mich nicht.
Gestern Abend.
Die Bilder in meinem Kopf sind unscharf und verwackelt, so als wären sie mit einer alten Kamera aufgenommen, der Ton kommt wie aus der Konserve. Vom Plattenspieler läuft Lou Reed. Kronkorken ploppen. Ich bin albern und will tanzen. Einmal wieder normal und völlig unbedarft sein. Für einen Moment alles loslassen. Ich kreise wie ein Flugzeug durch einen blauen Himmel, die Sonne scheint. Hier ist es viel schöner als da draußen im kalten, schwarzen Orbit. Hier ist es warm, und ich bin nicht allein. Ich will mich befreien, mich ganz rein machen, ich gestehe ihm lallend, dass die Geschichte von der Germanistikstudentin mit der Sinnkrise auch nur die halbe Wahrheit gewesen ist. Dass ich in Wirklichkeit nur bei Big Murphy’s arbeite, weil ich Angst habe, irre zu werden, wenn ich mich ganz meinem Elend überlasse. Dass ich aus Feigheit und purem Egoismus ein Kind erfunden habe, weil es einen, wenigstens einen Ort geben sollte – selbst, wenn es nur ein schmuddeliges Fast-Food-Restaurant ist –, wo ich jemand anders sein kann als die Tochter meines Vaters.
Von dem man sagt, er sei ein Mörder.
Von dem man sagt, er habe eine Masche. Kleine Mädchen und rote Bänder, die zu ihren Leichen führen.
Sie drucken sein halbherzig unkenntlich gemachtes Gesicht in ihren Schundblättern ab und berichten über tiefe Schnitte und riesige Blutlachen. Ich glaube nichts davon, kein Wort, keine einzige ihrer abscheulichen Lügen, und dennoch … es tut so weh, so unglaublich weh. Es ist ein Schmerz, der an sämtlichen Gliedern zerrt, der mich auseinanderreißen will bei lebendigem Leib. Ein Schmerz, der mein Herz stolpern lässt und meinen Kopf verrückt macht, und ich will das alles nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich brauche so dringend eine Pause. Also, sing, Lou Reed, sing für mich, sing lauter, lass mich einfach nur tanzen und alles vergessen. Und du, Jakob, mein einziger Freund, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen. Wie schön, dass du hier bist, denn alle anderen sind fort. Keine Zoe und auch sonst niemand mehr. Danke, dass du mit mir tanzt und mir Kraft gibst. Denn, weißt du, morgen wird ein schwerer Tag. Um elf muss ich in Moabit sein. Noch ist er dort, in Moabit, in Untersuchungshaft, aber bald, nach der Gerichtsverhandlung, wird er nach Tegel verlegt werden und dort einsitzen, wie die richtigen Straftäter, die wahren Monster, dauerhaft, lebenslänglich, wenn kein Wunder geschieht und sie ihren Irrtum einsehen. Komm schon, Jakob, los, lass uns weitertanzen. Schenk mir einen Moment woanders. Nur du und ich und das Bier und Lou Reed … und dann reißt der Film – Schwarzblende. Den Rest kann ich mir nur noch leidlich zusammenreimen: Jakob, wie er mich zur Couch schleppt, zudeckt und vielleicht noch etwas Nettes flüstert: »Gute Nacht, Ann. Hab keine Angst, es wird alles wieder gut.«
Gestern Abend – so war das.
Ich ziehe die Nase hoch, ein ganz erbärmliches Geräusch. Es passt gut zu mir. »Eigentlich wollte ich dir das alles gar nicht erzählen.«
»Ich weiß.«
»Du musst mir versprechen, es für dich zu behalten. Es wissen schon genug Leute Bescheid. Die Uni, die Nachbarschaft, Freunde oder besser die, die es mal waren.«
»Was? Woher denn? Der Name deines Vaters wurde bisher doch noch gar nicht veröffentlicht.«
»Aber die Polizei hat unser gesamtes Umfeld befragt. Und genau dieses Umfeld ist ja auch nicht blöd: natürlich erkennen unsere Bekannten sein Foto in der Zeitung, ob mit oder ohne den lächerlichen schwarzen Balken über seinen Augen, der den letzten Rest eines angeblichen Persönlichkeitsrechts bewahren soll. Ich warte nur auf den Moment, bis sich einer von denen entschließt, mit der Presse zu reden, und mir die gesammelte Meute auf den Hals hetzt.« Die Sensationslüsternen, die Rachsüchtigen. Pressepack, das vor unserem Haus campiert und mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Eltern wie Jörg E., der Vater der kleinen Saskia, die mich aufspüren und büßen lassen wollen für die angeblichen Taten meines Vaters. Ich muss nur daran denken, und schon fange ich an zu zittern.
Jakob streicht beruhigend über mein Knie. »Ich werde mit niemandem darüber sprechen. Du kannst dich auf mich verlassen.«
Sein Blick schweift durch unser Wohnzimmer. Die dunkelgrüne Samtcouch, auf der ich sitze, die andere, auf der er die Nacht verbracht hat, dazwischen der kleine Mahagoniholztisch. Der Kamin und darauf unzählige gerahmte Bilder – Bilder von uns, Papa, eine kleine Zeitreise im Fotoformat, mit wechselnden Frisuren und Haarfarben, du wirst grauer und ich bunter, du scheinst zu schrumpfen, während sich mein Körper streckt; die Mode ändert sich, alles ändert sich, nur eines nicht: wie wir auf jedem einzelnen dieser Bilder lachen und uns nahe sind.
Das drei Meter breite, deckenhohe Bücherregal, Schopenhauer, Seneca, Nietzsche und Camus, Kunstdrucke von Munch und Macke an den dunkelrot getünchten Wänden, die bodentiefen Fenster mit der Aussicht in den zugeschneiten Garten, wo ein großes, mit einer Plane abgedecktes Gebilde steht, mein altes Trampolin. So lebt er also, der mutmaßliche Mädchenmörder. Hier hat er seine Tochter aufgezogen, die von den grausamen Taten, die ihm vorgeworfen werden, nichts bemerkt haben will.
»Vielleicht solltest du dir überlegen, für eine Weile woanders zu wohnen«, sagt Jakob, als sein Blick schließlich wieder auf mir endet. »Ich meine, du hast schon recht. Irgendwann wirst auch du in den Fokus der Presse geraten, schließlich bist du seine Tochter.«
»Nein, das käme mir wie ein Statement vor. Wenn ich von hier wegginge, würden doch alle denken, dass ich mich von ihm distanzieren wollte. Und das will ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich weiß ja, dass er unschuldig ist.«
Jakob wirkt nachdenklich. »Es gäbe noch eine andere Möglichkeit.«
»Welche?«
»Anstatt zu warten, bis sich die Presse auf dich stürzt, könntest du von dir aus den ersten Schritt machen. Such dir gezielt einen vertrauenswürdigen Journalisten, dem du ein Exklusivinterview gibst, mit deiner Darstellung der Geschichte. Dann hast du die Fäden in der Hand und bestimmst die Rahmenbedingungen.«
»Vertrauenswürdig, klar.«
»Ann.« Jakob seufzt. »Du kannst den Leuten nicht vorwerfen, dass sie wissen wollen, was da geschehen ist. Immerhin sind neun kleine Mädchen tot, und irgendjemand ist dafür verantwortlich.«
»Aber mit Sicherheit nicht mein Vater.«
»Doch er ist nun mal derjenige, der ins Visier der Ermittler geraten ist.«
»Weil er Pech gehabt hat! Richtig beschissenes, blödes Pech, Jakob!«
»Na ja, solche Ermittlungen, ich meine … es ist ja nicht so, dass sie bei der Suche nach einem Verdächtigen blind auf irgendeinen Namen im Telefonbuch tippen.« Wir brauchen beide eine Sekunde, um zu begreifen, was er da gerade gesagt hat. »Oh Mann, entschuldige, das war dumm. Ich wollte nicht …«
»Behaupten, dass mein Vater schuldig ist? Mich verletzen? Vergiss es, deine Meinung kratzt mich nicht. Du bist nur irgendein Typ vom Wertstoffhof. Was weißt du denn schon?« Ich will diese Diskussion nicht fortführen, und die Uhr an meinem Handgelenk sagt, dass ich das auch nicht muss. »Ich sollte jetzt duschen gehen, sonst komme ich zu spät.« Damit erhebe ich mich von der Couch. »Danke für das Bier. Ich bring dich raus.«
»Schon gut, Ann. Mach dir keine Mühe.« Wie er klingt. Und der Ausdruck in seinem Gesicht. Ich spüre seine Enttäuschung noch, als hinter ihm längst die Haustür ins Schloss gefallen ist.
Traurigkeit. (Ann, 7 Jahre alt)
es stimmt gar nicht das man immer weinen muss und einem die Nase läuft wenn man traurig ist. Manchmal sitzt die Traurigkeit viel tiefer in einem Menschen drinn und klemmt die Leitung für seine Tränen ab. Das fült sich sehr kalt und dunkel an so als würde man in einem Burgturm sitzen. so ein alter Burgturm wie bei Rapunzel in meinem Märchenbuch aber ohne Fenster. Und es gibt auch keine Tür. man friert sehr und die Kälte macht einen ganz schlap und müde. Man will raus aus dem Turm weil man noch weis das draußen die Sonne scheint. Aber man kann nicht raus weil man vergessen hat wo der Ausgang ist.
Der Anwalt meines Vaters, der im Besprechungszimmer in Moabit bereits auf mich gewartet hat, spricht leise und zu seinen auf der Tischplatte gefalteten Händen statt in mein Gesicht, als er mir die neuesten Erkenntnisse darlegt: Larissa Meller ist die neueste Erkenntnis, ein ungeklärter Fall von vor vierzehn Jahren. Schon kurz nach der Verhaftung stand die Theorie im Raum, dass auch ihr Tod zur Serie der Mädchenmorde gehören könnte, nun aber haben sich die Ermittler festgelegt. Larissa war zehn Jahre alt, als sie an einem Juninachmittag 2003 mit ihrem roten Fahrrad von ihrem Zuhause in Hellersdorf losfuhr und nie wieder zurückkehrte. Wenige Tage später fand ein Spaziergänger das Rad in der Nähe der Hönower Weiherkette, und weitere drei Monate darauf wurde in einer Holzhütte dann eine Leiche entdeckt. Die Hütte lag nur ein paar Hundert Meter vom Fundort des Fahrrads entfernt, war jedoch derart eingewachsen, dass die Polizei sie bei ihrer großangelegten Geländesuche einfach übersehen hatte. Man vermutete sofort, dass es sich bei der Leiche um Larissa handeln könnte, doch bis zur eindeutigen Identifizierung dauerte es Wochen. Jener Juni war heiß, aber auch sehr regnerisch gewesen und die Leiche daher in einem furchtbaren Zustand. Was man ebenfalls fand: Schuhabdrücke in Größe 42, hinterlassen bei Regen, eingetrocknet und damit konserviert durch die anschließende Hitze. Dass das der Schuhgröße meines Vaters entspricht, kommt den Ermittlungen, die damals mangels weiterer Spuren ins Stocken gerieten, jetzt natürlich zugute. Larissa soll das erste Opfer der Mordserie gewesen sein. Nur, dass es bei ihr noch keine roten Bänder gab, die zu ihrer Leiche führten.
»Die Ermittler spekulieren, ob Larissa überhaupt erst der Grund dafür war, dass der Täter künftig mit den roten Bändern arbeitete. Möglicherweise hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, dass die Mutter ihr Kind so sehen musste.« Er blickt mir immer noch nicht ins Gesicht, stattdessen knetet er derart fest seine Hände, dass sich die Haut an den Stellen rot verfärbt. »Jedenfalls wiesen weder sie noch die restlichen Opfer Anzeichen von sexuellem Missbrauch auf, was bedeutet, dass es ein anderes Motiv sein muss, das den Täter antreibt.«
Ich habe zugehört, in stummer Fassungslosigkeit darüber, dass »der Täter« ein Synonym für »dein Vater« sein soll, und mir fällt nichts dazu ein außer: »Du bist sein Freund, Ludwig.« Es klingt wie eine Frage.
Ludwig Abramczyk, ehemals einer der besten Anwälte Berlins, zweiundsechzig Jahre alt und eigentlich seit drei Monaten im Ruhestand, den er in seiner Jagdhütte in den polnischen Wäldern verbringt. Er ist extra für meinen Vater zurück in seinen schicken, maßgeschneiderten Anzug und damit auch in seine alte Rolle geschlüpft. Um zu helfen.
»Genau deswegen bin ich hier, Anni. Aber es ist sehr schwierig mit ihm. Wenn man ihn fragt, was er zu den jeweiligen Tatzeitpunkten gemacht hat, sagt er entweder gar nichts oder zitiert bloß seinen Philosophenkram.«
»Also, bitte. Als könntest du dich daran erinnern, was du an irgendeinem Juninachmittag vor vierzehneinhalb Jahren gemacht hast.«
»Aber er regt sich ja noch nicht mal über die Vorwürfe auf, geschweige denn, dass er sie von sich weisen würde! Man konfrontiert ihn mit neunfachem Mord – zehnfachem, jetzt, wo man davon ausgehen kann, dass auch Larissas Tod zu der Serie gehört –, und er sitzt einfach nur da und schweigt.«
»Na, weil er verzweifelt ist! Offenbar scheint ihn ja nicht mal sein bester Freund für unschuldig zu halten.« Ich sehe meine Anklage in Ludwigs Gesicht explodieren. Sein Freund Walter, mit dem er in zahllosen Sommernächten auf der Terrasse saß oder im Winter vor unserem Kamin, wie sie Whiskeygläser schwenken, Witze reißen, diskutieren. Sie hatten immer ein Thema: Ludwig, der durch seine Arbeit als Strafverteidiger mit so vielen menschlichen Bösartigkeiten konfrontiert war, und mein Vater, der sich als Philosoph und Anthropologe von diesen Bösartigkeiten, deren Antrieb und Mechanismen, faszinieren ließ. Grillfeiern in unserem Garten. Mein Vater, geistig oftmals auf seinem eigenen Planeten unterwegs, der die Würstchen anbrennen ließ, und Ludwig, der gerade noch rechtzeitig dazukam, um ihm die Grillzange zu entreißen und das Ganze zu übernehmen. Und dann ich, Walters Tochter, die kleine Anni, die er doch schon kennt, seitdem sie auf speckigen Babybeinchen erste unsichere Gehversuche unternahm. Die er hat aufwachsen sehen, großgezogen vom liebevollsten aller Väter überhaupt. Sein Patenkind, das ihm jetzt gegenübersitzt und einfach nur maßlos enttäuscht von ihm ist.
»Bitte sei nicht unfair«, sagt er, nachdem ich meinen Pfeil verschossen habe. »Du weißt genau, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht. Aber je länger er schweigt, desto schwieriger wird es nun mal.«
Ich blicke zur Zimmerdecke, entdecke Risse im Beton. So wie die Risse, die sich seit der Durchsuchungsaktion durch das Foto auf unserem Kamin ziehen. Risse, die unser gesamtes Leben bekommen hat. Er hat einfach Pech gehabt, habe ich heute Morgen zu Jakob gesagt. Sein Pech, dass er sich kurz vor dem Fund der letzten Leiche im Königswald aufgehalten hatte, wo er beim Spazierengehen auf einen Bekannten traf. Kurz darauf stieß ausgerechnet dieser Bekannte auf die berühmt-berüchtigten roten Bänder, über die im Zusammenhang mit etlichen Morden schon viel in den Medien berichtet worden war, und so auch letztlich auf die Hütte, in der inmitten einer riesigen Blutlache der leblose Körper eines siebenjährigen Mädchens lag. Natürlich rief der Mann sofort die Polizei zum Fundort und gab auf die Frage, ob er im Wald jemandem begegnet sei, den Namen meines Vaters an. Das allein hätte wohl nicht ausgereicht, um ihn zu verhaften. Aber da waren eben auch noch diese verfluchte Vorlesung, die er vor einigen Jahren an der Uni gehalten hatte, und vor allem die Zeitungsartikel, die ihm dabei als Diskussionsmaterial gedient hatten. Dann die Sichtung eines dunklen Audi A6 in der Nähe eines früheren Tatorts und ein schwarzer Audi A6, der in unserer Garage steht und auf den Namen meines Vaters zugelassen ist …
»Warum?«, frage ich Ludwig. »Warum sollte er die Morde begangen haben? Er ist doch selbst Vater einer Tochter, und du weißt, dass ich sein Leben bin. Er hat mich immer geliebt und beschützt und er wäre durchgedreht, wenn mir jemals etwas Schlimmes passiert wäre. Das würde er heute noch. Warum sollte also ausgerechnet er anderen Eltern so einen Schmerz zumuten wollen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Aber geht es nicht genau darum? Geht es nicht immer um ein Motiv? Indizien kann man fehlinterpretieren. Man könnte sogar heimtückisch welche zusammenschustern, wenn man es darauf anlegte, jemandem zu schaden, oder nicht?«
Ludwig nickt, etwas widerwillig, wie mir scheint. Ich dagegen schüttele den Kopf. »Er war’s nicht. Kein Grund, nichts auf der Welt, hätte ihn dazu veranlassen können, so etwas zu tun.«
»Ach, Anni.« Über den Tisch hinweg greift Ludwig nach meiner linken Hand und dreht sie so, dass die Innenfläche nach oben zeigt. Dann verschiebt er das Armband meiner Uhr, so dass er mit dem Daumen über die kleine Narbe an meinem Handgelenk streichen kann. Ich war noch sehr klein, als ich mich dort verletzt habe. »Wir alle fangen uns im Laufe unseres Lebens die eine oder andere Schramme ein. Und nicht jede ist äußerlich sichtbar.«
Ich reiße meine Hand zurück, sprachlos.
»Man kann niemandem hinter die Stirn blicken, Kind. Nicht mal denen, die man glaubt am besten zu kennen. Ich will nur, dass du auf alles vorbereitet bist. Die Indizien …«
»Die Indizien! Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?«
»Anni …«
»Ihr habt euch alle dermaßen auf ihn eingeschossen, dass ihr völlig blind geworden seid für eine andere Möglichkeit.«
»Und welche?«
»Na, ein anderer Täter! Ermittelt denn die Polizei offen in alle Richtungen? Nein. Papa soll’s gewesen sein, basta, Fall geklärt. Und wenn ich sage, dass das einfach nicht stimmen kann, werde ich behandelt wie eine Idiotin, die die Wahrheit nicht verträgt.« Ich fange an, auf meiner Unterlippe herumzukauen. »Vielleicht sollte ich doch ein Interview geben.«
»Bitte was? Um Gottes willen, schlag dir das sofort wieder aus dem Kopf!«
»Aber wenn die Öffentlichkeit kapieren würde, was für ein Mensch er wirklich ist, könnte das den Druck auf die Polizei erhöhen, gründlicher zu ermitteln und somit auch den wahren Schuldigen zu finden.«
»Nein, nein, noch mal nein«, und jedes »Nein« nachdrücklich betont. Dann: eine lange Rede. Die Presse, eine unkontrollierbare Meute. Die wenigsten Journalisten fühlen sich noch wie auf einer Mission, wollen noch die Wahrheit aufdecken und nach Fakten suchen. Im Gegenteil schielen die meisten doch bloß auf den Unterhaltungswert, wollen Blut und Drama, Auflagen und Einschaltquoten, das – und nur das – sei ihr Motor. Wenn ich mit denen spräche, würde ich die Dinge möglicherweise nur noch schlimmer machen. »Am meisten hilfst du deinem Vater, indem du versuchst, dein eigenes Leben im Griff zu behalten. Damit nimmst du ihm schon mal eine große Sorge.«
Ich verdrehe die Augen und mache gedehnt: »Blaaa…«, doch diesmal lässt Ludwig sich nicht aus der Fassung bringen.
»Und mir hilfst du, indem du ihm ins Gewissen redest und ihn dazu bringst, mitzuarbeiten.«
»Ich dachte, es ist verboten, über den Tatvorwurf zu sprechen.«
»Konkret sollst du das ja auch gar nicht tun. Du sollst nur sagen, was nötig ist, um ihm den Ernst der Lage klarzumachen. Die Staatsanwaltschaft weiß über den Zweck deines Besuchs Bescheid, also mach dir keine Sorgen, okay?«
Ich nicke, auch wenn ich kein gutes Gefühl habe. Irgendetwas kommt mir falsch vor.
Wir
Ich weiß, du bist Besseres gewohnt. Das schöne große Haus. Das liebevoll gestaltete Kinderzimmer im ausgebauten Dachgeschoss. Der große Garten samt Pool … Du bist eine richtige Wasserratte, nicht wahr, Prinzessin? Im Sommer habe ich dich noch beobachtet, wie du mit den prall aufgeblasenen Schwimmflügelchen an den Oberarmen und quietschend vor Freude im Pool herumgeplanscht bist. Deine Lippen hatten sich schon leicht verfärbt; wahrscheinlich hätte man streng sein müssen, dich aus dem Wasser kommandieren und in ein dickes Handtuch wickeln. Doch deine Begeisterung zu sehen, diese ahnungslose, offene Lebendigkeit, wie sie wohl nur von einem Kind ausgehen kann, verwischte meine Bedenken und ließ mich versinken in diesen Moment. Nein, ich musste mir keine Sorgen um dich machen, du warst ja nicht dumm. Du würdest schon von selbst aus dem Pool steigen, wenn du zu frieren begännest und dich nicht mehr wohlfühltest. Insgeheim hoffte ich, es wäre noch lange nicht so weit, er sollte ewig andauern, dieser Moment. Die Sonne, die sich wie ein Filter über sämtliche Farben legte, sie satt und kräftig machte. Deine losgelöste Euphorie. Wassertropfen, die wie in Zeitlupe flogen. Mir war, als schaute ich einen Film; am liebsten hätte ich auf »Pause« gedrückt und das Bild von dir, wie du so glücklich warst, für immer eingefroren.
Nun sind wir hier, und ich weiß, es gefällt dir nicht besonders. Du bist die Prinzessin aus dem schönen großen Schloss, du gehörst nicht in dieses Loch. Aber manchmal kann man es sich eben nicht aussuchen, und das Wichtigste ist doch, dass wir zusammen sind. So wie du alles für mich bist, bin ich alles für dich. Nur durch mich bleibst du am Leben, und wenn ich dich aufgebe – bist du tot.
Ann
Berlin, 25.12.2017
Meinen Vater zu treffen – in diesem Betonzimmer mit dem nervös zitternden Licht der Neonröhren an der Decke und der kargen Einrichtung; bestehend aus einem Tisch und zwei Stühlen, in dieser manifestierten Kälte und Trostlosigkeit, einer Umgebung, in die er verdammt noch mal nicht hineingehört –, fühlt sich an wie zusammengetreten zu werden. Es ringt mich innerlich zu Boden, dieses Gefühl; es überfällt mich mit Tritten in den Magen, die so überwältigend sind, dass ich meinen Würgereiz nur schwer kontrollieren kann. Da hockt mir ein Mann gegenüber, der einmal aufrecht saß, mit stets geradem Rücken. Er war groß und stattlich. Sein kurz geschnittenes graues Haar ordentlich gescheitelt und gekämmt.
»Ich freue mich, dich zu sehen, mein Käferchen«, sagt in diesem Moment ein Fremder mit zusammengesunkenen, schmalen Schultern, eingefallenen Wangen, wirrem Haar und leerem Blick. Aber so klingt es nicht – so, als würde er sich freuen. Da ist nicht die Spur einer Emotion, nur Monotonie in seiner Stimme, wie von einer Maschine.
Ich sage: »Papa«, und fange an zu heulen, so sehr erschreckt es mich, was von ihm übriggeblieben ist. Erst da zuckt eine Regung durch sein totes Gesicht.
»Wie geht es dir?«, will er wissen. »Sag schon. Du musst nicht tapfer sein.«
Ich schüttele den Kopf, weil ich egal bin. Nicht mich hat man eingesperrt und verleumdet. Nicht ich soll wegen zehnfachen Mordes angeklagt werden. »Ludwig hat mir erzählt, dass du die Mitarbeit verweigerst. Du sagst weder, wo du zu den Tatzeitpunkten warst, noch versuchst du, die Indizien zu erklären. Aber das musst du tun, hörst du, Papa?«
Verunsichert blicke ich mich um. Es ist nicht das erste Mal seit der Verhaftung, dass ich meinen Vater treffe. Doch noch nie geschah das ohne die Aufsicht eines JVA-Beamten. Dabei wäre ich heute sogar dankbar für einen Einwand oder wenigstens ein Räuspern, wenn ich in kritische Gefilde gerate. Ich darf nicht über den Tatvorwurf sprechen, gleichzeitig soll ich meinen Vater dazu bringen, sein Schweigen zu brechen. Ich will nichts falschmachen, zumal sämtliche Besuchsgespräche auf Video aufgezeichnet werden. »Ich weiß, dass dir das alles zu dumm erscheint, Papa. Dass es dir lächerlich vorkommt, dich für so etwas Abwegiges zu rechtfertigen. Aber glaub mir, dein Stolz bringt dich hier nicht weiter, im Gegenteil. Du musst der Polizei klarmachen, dass du nicht der Mörder bist, du musst einfach.«
»Ach …« Kraftlos zuckt er die Schultern. »Unschuldsbekundungen sind hier doch gar nicht von Interesse. Sie haben sich ihr Bild längst gemacht. Wie die Gefangenen aus Platons Höhlengleichnis.« Wieder zuckt etwas durch sein Gesicht, womöglich die Erinnerung daran, wie er bis vor sechs Wochen noch Vorlesungen gab, in denen er seinen Studenten die großen Philosophen nahezubringen versuchte. Dreißig Jahre lang hat er an der Uni gelehrt, war ständiger Gast bei allen großen Symposien und hat