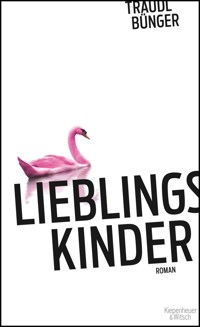
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch mal schnell die Welt retten Rosalie ist Mitte dreißig, Staatsanwältin und hat die Welt, das Leben und ihre Neurosen im Griff – denkt sie. Als ihr Vater plötzlich verschwindet, führt ihre Suche sie an jenen Ort, der für sie gefährlicher ist als jeder andere: ihre Kindheit. Als Rosalie fünf war, war alles ganz einfach: Die Welt war böse und ihr Vater angetreten, sie zu retten, Rosalie als Assistentin immer an seiner Seite.Dreißig Jahre später ist die Welt nicht besser geworden, aber Rosalie weiß, dass sie nicht mit Privatermittlungen gegen Nachbarn, Lokalpolitiker und die US-Regierung gerettet werden kann. Aber als Rosalie nach dem Verschwinden ihres Vaters wieder in ihrem Elternhaus steht, umgeben von Aktenordnern mit vermeintlich stichhaltigen Beweisführungen, muss sie sich fragen, ob ihr Vater dieses eine Mal nicht eine wirklich heiße Spur verfolgt – und wie aus dem nervigen Nachbarsjungen von damals ein so attraktiver und zupackender Mann werden konnte …In Traudl Büngers temporeichem, vielschichtigem und pointiertem Debüt geht es um unsere Sehnsucht, die Welt zu verstehen und zu verändern. Es geht um einen Vater, der seine Familie an dieser Sehnsucht zerbrechen lässt. Es geht um eine Tochter, die um seine Liebe kämpft und zu spät erkennt, dass Väter keine Helden sind. Es geht um eine Staats anwältin, die Dienstvorschriften vergisst, um vielleicht sogar die Welt, zumindest aber die Glühbirne zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelWidmungInhalt197819791980Tag 1Tag 2Tag 3Tag 4Tag 5Tag 6–8198319841985Tag 9KaklerlakentageTag 10Tag 11Tag 12, morgensTag 12, mittagsTag 13Tag 14Tag 15 bis Tag 21198619871988Tag 22Tag 23Drei Tage späterAugust23. August23. August 1.23 UhrSeptemberOktoberDankBuchAutorImpressum[Menü]
Widmung
Für Bert
[Menü]
Inhalt
Ich versuche es immer so einzurichten, dass ein wenig Hausarbeit zu erledigen ist, wenn ich mit meinem Vater telefoniere. Ein paar braune Blätter an einer Balkonblume, ein paar schmutzige Teller für die Spülmaschine oder ein paar staubige Glühbirnen reichen aus. Ich bin mir sicher, dass mein Atem nicht nach Beschäftigung klingt, dass das Grunzen, mit dem ich seinen Redestrom in Gang halte, nicht künstlicher ist als sonst. Dennoch merkt er es jedes Mal.
»Was klappert da?«, fragt er freundlich, und als ich gestehe, dass ich parallel koche, will er wissen, was. Als ich »nur Pasta« murmele, ist er enttäuscht. Früher hat er bei Familienfeiern gerne darauf hingewiesen, dass jetzt beide Töchter kochen und backen könnten. (»Früher konnte die eine kochen, die andere nicht. Dafür konnte die andere backen, aber nicht kochen. Ich hab immer gedacht: Der arme Mann, muss gleich beide heiraten. Aber inzwischen können beide beides.«)
»Mach doch mal einen schönen Schweinebraten!«
»Vielleicht am Wochenende.«
»Au, fein! Dann komme ich am Sonntag zum Schweinebratenessen.«
Am Sonntagmorgen schneide ich große Mengen Knoblauch und zerhacke einen Berg Kräuter. Ich mache einen Salat als Vorspeise, ein Risotto mit Spinat und Gorgonzola als Beilage und Birnen in Rotweinsoße zum Nachtisch. Unter den kritischen Blicken der Katze lege ich ein weißes Tuch auf den Tisch im Schatten der Weinranken, schmücke ihn mit einem Strang weißen Flieder und lege eine mittelteure Flasche Weißwein ins Tiefkühlfach.
Wie immer bin ich pünktlich fertig; wie immer kommt er 20 Minuten zu spät; wie immer gelingt es mir nicht, die 20 Minuten sinnvoll zu nutzen.
Er klingelt stürmisch und läuft dann mit schnellen, platschenden Schritten die Treppe herauf. Ein dichtes Duftgewebe aus Knoblauch und Kräutern umweht uns, als er mich steif umarmt und sich die Schuhe von den Füßen streift. Ich schiebe sie mit dem Fuß in eine Ecke neben der Kommode und folge ihm ins Wohnzimmer. »Hier!«, rufe ich fröhlich, zeige Richtung Balkon und wünsche mir mit einem Mal, dass er die Tischdecke und den Fliederzweig bemerkt.
»Ach ja«, sagt er, stolpert über die Türschwelle, fängt sich und lässt sich mit Schwung auf den nächsten Stuhl fallen.
»Kannst du dich bitte auf den anderen Stuhl setzen? Ich muss in die Küche können.«
»Ach ja«, sagt er wieder, geht um den Tisch und setzt sich, ohne eine Sekunde an die Aussicht oder die Stockrosen zu verschwenden. Ich sehe auf meine nackten Zehen, auf das Überbein, das er mir vererbt hat. Der Moment, an dem ich hätte fragen können, wie die Fahrt war, ist vorbei.
»Ich hol mal den Salat.«
»Oh ja.«
Der Wein ist von einem kühlen, hellen Gelb und die Gläser sind bis zur Füllhöhe beschlagen. Ich verscheuche eine frühe Wespe, während wir den Salat essen. Er sticht seine Gabel in eine halbierte Cocktailtomate, schiebt sie sich in den Mund, kaut schnell, ebenso die Pinienkerne. Die Salatblätter ignoriert er.
»Mir ist das ein wenig viel«, sagt er und deutet mit der Gabel ein paar Mal auf die Blätter. »Möchtest du?«
Ich schüttele den Kopf.
»Nicht wahr?«, sagt er und lacht. Ich nehme seinen Teller, öffne den braunen Biomüll-Behälter mit dem großen Zeh und lasse den Salat hineinrutschen. Das Hellgrün sieht hübsch aus auf dem körnigen Braun aus dem Coffeemaker. In der Küche schneide ich eine dicke Scheibe rosig weißen Schweinebraten ab und häufe Knoblauchscheiben und geschmorte Kräuter darauf. Ich forme eine Eiskugel aus dem Risotto und bestreue sie mit glatter Petersilie.
Er isst den Schweinbraten mit Appetit, lobt die »gebratenen Zwiebeln« und den »Kartoffelkloß«. Von den Kräutern lässt er das meiste liegen. Als ich ihm eine zweite Portion anbiete, kommt er mit in die Küche und zeigt auf das Ende des spitz zulaufenden Schweinebratens. Während ich in das mürbe Fleisch schneide, fühle ich alten Ärger. Früher hebelte er gerne die Käseschicht von den Aufläufen und ließ Kartoffeln und Gemüse liegen.
Beim Nachtisch erzähle ich ein bisschen aus der Behörde, aber schnell franst meine Stimme unter seinem fehlenden Interesse aus und meine Anekdote verliert an Tempo. Mit einem lahmen »so ist das in der Staatsanwaltschaft« ende ich, ohne die Pointe erreicht zu haben. Es fällt ihm nicht auf.
»Rosalie, wo ich hier all die Blumen sehe, die du auf deinem Balkon züchtest«, er macht eine ausladende, kreisende Handbewegung, mit der er nur knapp sein Weinglas verfehlt, »importierst du etwa Knollen oder Samen von deinen Fernreisen?«
Ich erspare uns die Geschichte von der Blumenhändlerin aus Sumatra und ihren Dahlienknollen, sie sind in meinen Kästen ohnehin nicht angegangen, und schüttele den Kopf.
»Das ist gut. Vielleicht weißt du es nicht, aber das Importieren fremder Arten hat ein nie gekanntes, bedrohliches Ausmaß erreicht: Unwissende Touristen kaufen in exotischen Ländern Blumenknollen, Samen gelangen als blinde Passagiere in Containerschiffen, Autoreifen oder Profilsohlen rund um die Welt. Im Ballastwasser von Schiffen reisen nicht nur Pflanzen, auch Einzeller, Meerestiere und Muscheln von Asien nach Europa. Meeresbiologen gehen von einer Invasionsrate von einer Art pro Jahr aus! Da muss nur eine einzige eine ökologische Nische finden und zack« – er schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch, die Teller klirren, ich zucke zusammen – »richtet sie Verheerendes unter den einheimischen Arten an. Die pazifische Auster ist so ein Fall: Sie wurde 1987 zu Zuchtzwecken auf Sylt eingeführt vom Sohn des Orangensaft-Fabrikanten Dittmeyer. Einige Larven sind in die offene Nordsee entwischt. Mittlerweile ist die pazifische Auster im Watt so präsent, dass sie einheimische Arten wie die Miesmuscheln verdrängt.«
»Dann ist die pazifische Auster doch gar nicht eingewandert, sondern importiert worden.«
»Gut aufgepasst. Das Importieren passiert leider immer noch viel zu oft. Ob eingewandert oder angesiedelt, am Prinzip ändert das nichts. Die Überfremdung von Flora und Fauna nimmt bedrohliche Ausmaße an. Es ist ein biogeografischer Vorgang von evolutionärer Bedeutung.«
»Aha.«
»Du machst dir keine Vorstellung, welche Konsequenzen das hat. Der asiatische Buschmoskito zum Beispiel hat sich von Ostasien bis nach Europa vorgekämpft, und anders als unsere heimischen Mücken kann er tropische Krankheiten wie das Dengue-Fieber übertragen, auch bekannt als Knochenbrecher-Fieber. Es ist wirklich wichtig, für diese Gefahren zu sensibilisieren, ich denke zum Beispiel über eine Plakatkampagne mit Steckbriefen der gefährlichsten Invasoren nach und über Expeditionen, bei denen man invasive Pflanzen mit Spaten und Flammenwerfern zu Leibe rückt. Man könnte auch Schulen beteiligen und das Kind auszeichnen, das die beste Ausrottungsquote hat …«
»Wie bist du bitte dem asiatischen Moskito auf die Spur gekommen?«
»Buschmoskito, Rosalie. Es heißt Buschmoskito. Ich habe einen hochinteressanten Bericht über die Einwanderung fremder Arten im Radio gehört und mich seither ein bisschen umgetan. Wusstest du, dass manch ein Hausbesitzer Zehntausende investieren muss, um sein Haus waschbärenfrei zu bekommen?«
»Nein, aber ich weiß, dass der Waschbär nicht eingewandert ist, sondern von den Nazis ausgewildert wurde.«
»Das ist richtig. Hermann Göring war damals für die Jagdbehörde zuständig und genehmigte 1934 das Aussetzen von zwei Waschbärenpaaren am Edersee in Hessen. Dieses Detail kennen nicht viele Leute. Woher weißt du das?«
»Ich hatte Letztens eine querulatorische Strafanzeige in einem Nachbarschaftsstreit auf dem Tisch. Der Anzeigeerstatter behauptete, eine Studenten-WG habe absichtlich Waschbären im Dach seines Hauses angesiedelt, um ihn zu terrorisieren. Der Klage lag auch eine Informationsbroschüre des NABU über den Waschbär bei.«
»Studenten benutzen Waschbären, um unliebsame Nachbarn zu terrorisieren. So, so.«
»Nein, genau andersrum: Nachbarn benutzen Waschbären, um Klagen gegen Studenten anzustreben. Ich habe natürlich sofort eingestellt, ist ja kompletter Schwachsinn.«
»Wenn du da mal nicht voreilig gehandelt hast, Rosalie. Eine fremde Art kann eine gefährliche Waffe sein. Mir ist der Fall eines Krebszüchters bekannt, der von einem Konkurrenten durch das Aussetzen einiger amerikanischer Signalkrebse ruiniert wurde. Die amerikanischen Arten übertragen eine Pilzkrankheit, gegen die die deutschen Krebse keine Abwehrkräfte haben. Also sind alle deutschen Edelkrebse gestorben, für die amerikanischen gab es aber keine Absatzmöglichkeiten, und der Mann war bankrott. Gerade bin ich einem Investor auf der Spur, der plant, ein Naturschutzgebiet durch das gezielte Ansiedeln der Herkulesstaude zu zerstören.«
Hilfe.
»Die Herkulesstaude ist eine extrem anpassungsfähige Art, die sich enorm schnell ausbreitet. Ihre Ansiedlung in der Sumpflandschaft des Niederen Venn würde eine biologische Kettenreaktion in Gang setzen, die über kurz oder lang das Ökosystem kollabieren ließe.«
»Warum sollte jemand so etwas tun?«
»Das ist doch offensichtlich: Um nach vollzogener Tat das Land des Niederen Venn billig erwerben zu können und ein Einkaufszentrum oder einen Vergnügungspark zu bauen. Kein Mensch kämpft für ein Riesenfeld Herkulesstauden. Sie sehen nicht besonders hübsch aus und enthalten Substanzen, die in Kombination mit Tageslicht schmerzende Quaddeln und Verbrennungen hervorrufen. Ganz einfach: keine schützenswerte Natur, kein Naturschutzgebiet. Und schon können die Bagger kommen.«
»Das ist absurd.«
»Überhaupt nicht! In den Mangrovenwäldern Floridas ist genau das geschehen, als 1906 der Melaleuca-Baum angesiedelt wurde. Er sollte die Sümpfe austrocknen und damit urbar machen. Als in den 1950er-Jahren entdeckt wurde, was für ein kostbares Ökosystem die Everglades sind, hatte diese hochinvasive Spezies sämtliche anderen Pflanzenarten ergo auch Tierarten verdrängt. Man hat alles Mögliche versucht, um sie wieder loszuwerden, Herbizide, Brandrodung, Insekten …«
Ich hörte nicht mehr zu. Mein Wernicke-Areal schaltet sich aus und seine Worte verlieren ihre Bedeutung, werden zu einem unrhythmischen Rauschen. Die frühe Wespe ist in sein Weinglas gefallen und rudert chancenlos. Die Wände des Glases sind glatt und nach außen gewölbt.
Irgendwann mündet der Wortstrom in eine Frage:
»Gibt’s noch Kaffee?«
Ich mache ihm einen sehr heißen Cappuccino. Während er schlürfend trinkt, hoffe ich auf Schweißperlen auf seiner Stirn und sage:
»Es tut mir fürchterlich leid, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich habe morgen eine Sitzung.«
Noch zweimal sage ich, dass ich – jetzt wirklich – anfangen muss zu arbeiten. Als er weg ist, ziehe ich hektisch meine Laufschuhe an und laufe am Kanal entlang bis zum See. Eine Stunde später komme ich zurück; die Katze liegt in einem Sonnenstreifen und gähnt, auf dem Kräutersud ist eine durchbrochene, weißliche Fettschicht und auf dem Anrufbeantworter seine Stimme, die sich für das leckere Mittagessen bedankt, ein Bild des asiatischen Buschmoskitos per Mail ankündigt und viel Erfolg bei der Sitzung wünscht.
[Menü]
1978
Bianca hat Angst, Rosalie nicht. Höher und höher klettert sie, je dünner die Zweige werden, desto leichter fühlt sie sich. Auch die ganz kleinen, dünnen können tragen, wenn man sie dicht am Stamm betritt. Ein Vogel fliegt auf, erschreckt. Rosalie erschrickt auch, zum Glück lässt sie nicht los.
Sie ist ganz schön hoch, vielleicht sollte sie zurückklettern. Fuß, Hand, anderer Fuß, andere Hand. Als die Äste wieder dicker werden und die Erde nah ist, kommt der Stolz. Sie war sehr hoch.
»Ich war höher als das Kreuz«, ruft sie Bianca zu, und, als sie sicher ist, dass Bianca guckt, lässt sie sich ein Stück fallen. Lässig fängt sie sich an einem dicken Ast wieder auf und schwingt hin und her. »Was denn?«, fragt sie, als Bianca aufschreit, »ich mach das immer so.«
Sie springt den letzten Meter, fällt auf die Hände. Das Triumphgefühl verschwindet in brennenden Handflächen.
Rosalies Vater steht an der Mauer und betrachtet einen Rechen. Die Mädchen laufen zu ihm.
»Na, ihr zwei? Habt ihr auch keinen Fußpilz?«, fragt er. »Zieht mal eure Schuhe und Strümpfe aus und zeigt mir eure Zehen.« Rosalie und Bianca setzen sich auf den Boden, der Vater geht vor ihnen in die Hocke. Rosalie zieht ihre weißen Lochsandalen aus und hat ein schlechtes Gewissen wegen der grünen Streifen auf dem Leder. Sie legt ihre Söckchen ordentlich auf die Schuhe und spreizt die Zehen. Das kann sie gut. Ihr Vater nickt. Bianca zieht ihre schwarzen Strümpfe aus, einer ist zu groß und wirft an der Ferse eine Falte. Sie muss die Hände zu Hilfe nehmen, um die Zehen zu spreizen, und schaut Rosalie Hilfe suchend an. Rosalie nickt.
»Da!«, ihr Vater zeigt auf Biancas Zehen, ein paar schwarze Flusen kleben in den Zwischenräumen. »Fußpilz!«
Bianca schiebt die Unterlippe vor und reibt mit dem Finger zwischen ihren Zehen, die Flusen formen sich zu einem schwarzen Popel.
»Das sind Fusseln«, protestiert Rosalie, »von den Strümpfen.« Sie zeigt auf Biancas Strümpfe und ist froh über diese Erklärung. Aber ihr Vater wirft ihr nur einen abwesenden Blick zu, steht auf und sagt: »Ihr müsst euch immer ganz gründlich zwischen den Zehen abtrocknen. Das Handtuch falten und mehrfach zwischen den Zehen durchziehen.« Er macht eine demonstrierende Bewegung mit den Händen und wendet sich ab. Dann dreht er sich noch einmal um und sagt zu Bianca:
»Und du lässt bitte die Strümpfe an, wenn ihr reingeht. In meinem Haus läufst du nicht barfuß.«
Rosalie und Bianca gehen zur Sickergrube und schieben den Holzdeckel zur Seite. Das schwarze Wasser glänzt geheimnisvoll und sie stellen sich vor, in der Grube wäre eine Schatztruhe versteckt.
»Ihr sollt doch nicht an der Grube spielen«, ruft Rosalies Mutter aus dem Küchenfenster. »Rosalie, bitte mach die Grube zu, stell dir vor, Muckel fällt hinein.« Rosalie erschreckt, die Vorstellung ist zu schrecklich. Aber ist Muckel so blöd? Er kann noch besser klettern und balancieren als Rosalie selbst.
»Sollen wir noch Playmobil spielen?«
Sie gehen durch den Kellereingang ins Spielzimmer. Schuhe und Strümpfe lassen sie an.
Rosalie muss aufs Klo und lässt Bianca und den Playmobil-Bauernhof alleine. Leise schleicht sie sich die Treppe hoch. Die Tür lässt sie einen Spalt offen. Sie lauscht auf ihren Strahl, wird aber bald von Stimmen aus der Galerie gestört. Sie steht auf, wischt, zieht aber nicht ab. Schnell schleicht sie in den Flur, mit einer klumpigen Gewissheit im Bauch: Sie streiten sich.
»Carla«, sagt ihr Vater, mit Betonung auf beiden Silben, »du weißt doch, wie wichtig das ist. Ich habe es dir hundert Mal erklärt und ich dachte, du seiest meiner Meinung oder wärst zumindest ausreichend interessiert am Schicksal der Welt, um mich nicht zu boykottieren. Aber offenbar war das ein Irrtum, deine persönliche Bequemlichkeit …«
»Meine Güte, Ernst, jetzt mach mal einen Punkt und werd nicht pathetisch. Das hier ist ein Haus, in dem Menschen wohnen, und kein Laboratorium für deine verrückten Versuche. Und in einem Haus braucht man Licht. Wenn eine Glühbirne kaputt ist, wechselt man sie aus. Das ist völlig normal und ich habe keine Lust, mich deswegen anschnauzen zu lassen.«
Bei »verrückte Versuche« zuckt Rosalie zusammen. Das mag Papa gar nicht. Sicher wird er böse.
»Ist es denn zu viel verlangt, dass du mich einfach informierst? Du weißt doch, dass ich genau Buch führe über Lebens- und Brenndauer, über die Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens, über die Beschaffenheit des elektrostatischen Feldes, in dem sie eingesetzt wurden …«
»Ja, das ist zu viel verlangt! Das ganze Haus ist voll von deinen Tabellen, Statistiken, Akten. Das Giebelzimmer kann man wegen der tausend Glühbirnen gar nicht mehr betreten …«
»Ich bin mit dem Katalogisieren ein wenig im Rückstand, aber es kleben auf allen Glühbirnen Etiketten, die alle nötigen Informationen enthalten. Und wenn ich erst den programmierbaren Taschenrechner habe, geht das alles ratzfatz, du wirst schon sehen.«
Bianca kommt aus dem Keller, Rosalie wendet ihr den Rücken zu. Sie ist erleichtert, als ihr das Klicken der Haustür verkündet, dass die Freundin gegangen ist.
Die Mutter redet, eigentlich schreit sie, einfach weiter:
»Du verdächtigst die Nachbarn, gegen uns zu intrigieren, und wenn ich dich zufällig um 23 nach irgendwas bei der Arbeit anrufe, drehst du komplett durch. Ernst, wirklich, das wird zur fixen Idee bei dir.«
»Hast du die Glühbirne noch?«
»Verdammt noch mal, ja, die ist noch da. Liegt da hinten.«
»Du lieber Himmel, auf der Fensterbank?«
Mama sagt lange nichts, und als sie endlich spricht, klingt sie müde:
»Ja, auf der Fensterbank.«
»Carla, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die kaputten Glühbirnen keinen extremen Bedingungen aussetzen darf, wenn sie noch nicht interpretiert sind? Wie soll ich sie überführen, wenn ich die Glühbirnen nicht interpretieren kann? Die hier ist erst vor 14 Monaten eingewechselt worden! Wir nutzen diesen Raum durchschnittlich an zwei Abenden in der Woche für zirka vier Stunden, betreten wird er, großzügig gerechnet, vielleicht zehnmal die Woche für zirka zehn Minuten. Oder hat sich an deiner Nutzung etwas geändert? Warte mal, zwei mal vier mal vier mal 14 sind 448 Stunden, plus zehn mal zehn mal vier mal 14 sind 5600, geteilt durch 60, macht, äh, ungefähr 90 Stunden. Sind zusammen 540 Stunden, großzügig gerechnet! Das ist noch nicht mal die durchschnittliche Brenndauer, die mir die International Electrical Association auf mehrfaches Nachfragen angegeben hat. Das sind 300 Stunden darunter! Und wenn du jetzt bedenkst, dass eine Brenndauer von 5000 Stunden technisch problemlos machbar ist, dann hat diese Glühbirne nur 1/10 ihrer möglichen Brenndauer erreicht! Carla, schockiert dich das nicht?«
Wieder antwortet Mama lange nicht, so lange, dass Rosalie überlegt, ob sie gegangen ist. Aber dann antwortet sie, und zwar sehr böse:
»Nein, mich schockiert etwas ganz anderes: dass ein intelligenter Mann seine Zeit damit verbringt, die Lebensdauer …«
»Brenndauer! Mit Lebensdauer bezeichne ich die gesamte Spanne, also die Leucht- und die Ruhephasen.«
Jetzt schreit Mama: »… damit verbringt, die LEBENSDAUER einer Glühbirne auszurechnen, statt eine Alternative zur Atomenergie zu finden oder wenigstens einen Videorekorder richtig zu programmieren.«
Mama knallt die Tür und kommt sehr schnell in den Flur.
»Was stehst du hier rum?«, schreit sie Rosalie an. »Na los, geh schon zu ihm, ich bin sicher, er erklärt dir gerne, was für schreckliche Gefahren der Menschheit drohen. Und du wirst es sicher verstehen und ihm helfen, die Brenndauer einer Glühbirne in eine Tabelle einzutragen.«
Rosalie spürt, wie sich ihre Blase öffnet. Zum Glück war sie eben auf dem Klo, deswegen kommt nur ganz wenig warmes Pipi. Sie sieht der Mutter nach und geht in die Galerie.
Ihr Vater hält eine Glühbirne gegen das Fenster und klopft mit einem Finger sanft dagegen. Rosalie weiß, dass es eine matte Glühbirne ist. Die sind aus milchig weißem Glas, deswegen blenden sie nicht. Zum Glück ist es keine von den teuren verspiegelten.
»Was ist denn mit der Glühbirne?«, fragt sie.
»Sie ist viel zu schnell kaputtgegangen«, sagt ihr Vater. »Sie hat nur 400 Stunden gebrannt. Ich hab dir doch von Phöbus erzählt, erinnerst du dich?«
»Das sind die Bösen, die extra machen, dass die Glühbirnen schnell kaputtgehen.«
»Genau. 1924 haben sie sich das ausgedacht, und zwar bei einer großen Versammlung in einer Stadt in der Schweiz namens Genf, merk dir das. Freie Marktwirtschaft, den Motor für Innovation und Fortschritt, gab es auf dem Glühbirnenmarkt nie. Vertreter aller führenden Glühbirnenhersteller waren dabei, weißt du noch, welche es waren?«
»Ossram aus Deutschland, Internäschonell aus Amerika, Kompänje der Lampen aus Frankreich und Tunzram aus …«, Rosalie fällt nicht mehr ein, aus welchem Land Tungsram kommt. Der Vater sieht trotzdem zufrieden aus.
»… aus Ungarn. Klasse! Du hast ein gutes Gedächtnis. Wollen wir die Glühbirne zu den anderen bringen?«
Rosalie darf die Glühbirne tragen. Sie legt sie auf ihre ausgestreckten Handflächen und hält die Hände ganz ruhig. Sie lässt die Birne nicht aus den Augen, während sie die Treppe hochsteigt, und nimmt pro Schritt nur eine Stufe.
Im Giebelzimmer angekommen, ist Rosalie froh, dass sie die Verantwortung an ihren Vater abgeben kann. Der Vater nimmt ihr die Birne vorsichtig ab, legt sie auf den Schreibtisch und notiert sorgfältig Zahlen in eine Tabelle, die auf der Schreibtischplatte festgepinnt ist.
Rosalie mag das Giebelzimmer, die abgestandene Luft und die durchgebogenen Regale mit den vielen Büchern und den staubigen Aktenordnern. Sie bewundert ihren Vater dafür, dass jeder Aktenordner das gleiche Etikett hat und sauber und gut leserlich beschriftet ist. Sie mag die rätselhaften Tabellen an den Wänden, die Briefwaage und den großen Locher und die anderen Geräte, deren Namen sie nicht kennt. Sie mag das Bett mit der weichen Bettdecke, das so stark nach ihrem Vater riecht und in dem oft Tabellen, Papiere und Bleistifte liegen. Sie mag auch die vielen Glühbirnen, die in Eierkartons hinter Glasscheiben stehen oder auf Zellstoffbahnen in den Regalen und auf dem Boden liegen. Manchmal schleicht sie sich heimlich hier hinein, betrachtet die Tabellen und streichelt über die Glühbirnen auf der Suche nach ihrem Geheimnis. Sie muss nur aufpassen, dass Lily sie hier nicht erwischt, sonst petzt die, und Mutter wird böse.
»Weißt du, was ich glaube?«, fragt der Vater.
Rosalie legt schuldbewusst den Druckbleistift mit den vielen dünnen Ersatzminen und dem kleinen Radiergummi weg und lauscht aufmerksam.
»Ich glaube, sie machen diese matten Glühbirnen nur, damit die Leute sie schütteln, um rauszufinden, ob der Draht durchgeschmort ist. Wenn man sie ordentlich geschüttelt hat und der Draht mehrfach so richtig fest an den Innenrand der Glühbirne gedonnert ist«, er wedelt kräftig mit der Hand durch die Luft, »dann kann man den Draht nicht mehr untersuchen.«
»Ich denke, die matten sollen einen nicht blenden?«, Rosalie ist stolz, dass sie so viel über Glühbirnen weiß.
Der Vater wendet sich ihr mit einer schnellen Drehung des Schreibtischstuhls zu.
»Rosalie, das enttäuscht mich! Sogar du glaubst diesen Propagandamist.« Er fasst sie an beiden Schultern und beugt sich vor. »Verstehst du denn nicht? Das sagen sie doch nur, damit man ihre wahre Absicht nicht erkennt! Es ist völlig sinnlos, eine Glühbirne zu mattieren, damit sie nicht blendet. Dafür gibt es Lampenschirme! Verstehst du, was ich meine?«
Rosalie nickt.
»Du darfst ihnen niemals ungeprüft glauben! Niemals, versprich mir das.«
»Ich verspreche es.«
Der Vater lässt sie los.
»Du bist ein gutes Kind. Willst du mir helfen, die Ergebnisse von heute in das Koordinatensystem einzutragen?« Er nickt zu der beeindruckendsten aller Tabellen hinüber.
»Ich kann doch noch gar nicht richtig lesen!«
»Die Zahlen kannst du schon, und dann musst du nur noch wissen, was ein Komma ist, nämlich das hier.« Er zeigt auf einen kurzen Strich, der zwischen vielen Zahlen steht. »Du musst mir die Zahlen von oben nach unten vorlesen und nicht vergessen, die Kommata zu diktieren.« Der Vater hebt sie hoch und setzt sie auf den Drehstuhl, er betätigt die Pumpe so lange, bis Rosalie auf der richtigen Höhe ist.
»Machen wir mal eine Probe. Lies mir bitte diese Zahl vor.«
Rosalie rutscht auf ihrem Stuhl hin und her, sie würde gerne die Beine unterschlagen, traut sich aber nicht. Sie liest mit fiepsiger Stimme: »Drei – zehn – acht – noch mal acht – null – zwei – sechs – sieben – äh – Komma – sieben – drei.«
»Sehr gut. Meine Assistentin muss langsam verantwortungsvollere Aufgaben bekommen, meinst du nicht?«
Rosalie nickt.
»Alles klar, hier fangen wir an«, er zeigt auf eine Zahl und geht zum Koordinatensystem. Rosalie legt den Finger unter die Zahl und beginnt zu diktieren. Sie haben gerade mal die Hälfte der Zahlen geschafft – einige musste Rosalie noch einmal diktieren, weil sie das Komma vergessen hatte, zum Glück ist der Vater nicht sauer geworden –, als Lily im Türrahmen erscheint. Rosalie kommt sofort ins Stocken. Der Vater schaut auf, entdeckt Lily, zieht die Augenbrauen hoch und sagt: »Lily, wie du siehst, sind wir beschäftigt. Was können wir für dich tun?«
Rosalie sieht die roten Flecken, die auf Lilys Gesicht erscheinen, und ruft: »Lily, heute ist schon wieder eine Glühbirne kaputtgegangen! Sie hat nur 500 Stunden oder so gelebt.«
»Ist mir doch scheißegal!«
»Keine Kraftausdrücke, Lily. Von mir hast du das nicht gelernt!«
Lily sieht ihn hasserfüllt an und schnaubt: »Ich soll euch sagen, das Essen ist fertig.« Sie wirft Rosalie einen mahnenden Blick zu und lässt sie alleine.
Rosalie ist unbehaglich zumute. Wie soll sie den Vater dazu bewegen, die Tabelle liegen zu lassen und mit ihr in die Küche zu gehen? Mama wird wütend werden, wenn sie nicht kommen. Der Vater hat sich schon wieder den Tabellen zugewandt und murmelt schnelle Worte. Rosalie nimmt seine Hand.
»Papa, ich hab solchen Hunger!«, quengelt sie. »Ich glaube, es gibt Radieschen zum Abendbrot. Komm, wir gehen runter.«
Ihr Vater lässt den Stift sinken, betrachtet einen Moment die Ziffern und Striche, dann sagt er:
»So wenig Pflichtgefühl hätte ich von meiner Assistentin nicht erwartet. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Wir haben noch einige Reihen vor uns, oder nicht?«
Das Unbehagen steigt Rosalies Speiseröhre hoch und presst Tränen in ihre Augen, fast kann sie die Zahlen nicht mehr erkennen. Mühsam schluckt sie und liest weiter.
An diesem Abend essen Rosalie und ihr Vater nicht mit Lily und der Mutter gemeinsam zu Abend. Als Rosalie mit verheultem Gesicht an der Hand ihres Vaters in die Küche kommt, ist der Abendbrottisch verwaist. Auf zwei der vier Brettchen liegen Krümel und Quarkreste und neben einem rote Radieschenschwänze und grüne Radieschentoupets mit Zahnspuren.
Rosalie fühlt sich wie nach dem Kinderturnen, wenn alle schon laut schreiend rausgelaufen sind und niemand wartet, bis sie sich die Schuhe zugebunden hat.
Später räumt Rosalie den Tisch ab. Sie stellt die Tassen in die Spülmaschine, das Brot in den Schrank, findet ein Häubchen und zieht es über den Rand der Steingutschüssel mit dem Quark. Sie schiebt einen Stuhl über den stumpfen beigefarbenen Gummiboden, klettert darauf und stellt den Quark, die Butter, den Käse und die Joghurts in den Kühlschrank. Nur die Teekanne kann sie nicht auf das Regal stellen, es ist zu hoch.
Danach läuft sie zur Mutter und sagt: »Papa hat den Tisch abgeräumt!«
Ihre Mutter sieht vom Bügelbrett auf, seufzt und fragt Rosalie, ob sie baden will.
Ein halbe Stunde später schwimmt Rosalie selig zwischen Schaum, Wasser, Dampf, Duft und blutroten Badezimmerkacheln.
[Menü]
1979
»Du hast überhaupt keine Ahnung von Fischen. Die erholen sich wieder. Stimmt’s, Papa?«
»Ich hab immer noch mehr Ahnung als du«, gibt Lily zurück, bevor der Vater antworten kann, »schließlich hat der Olaf ein Aquarium. Und der hat gesagt, wenn Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen«, Lily zeigt auf den weißen Bauch der Scholle, die quer im Wasser liegt, »dann sind sie tot.«
»Der ist nicht tot. Der hat noch gezuckt. Und wie.« Wenn Rosalie die Augen schließt, sieht sie die weiße Plastiktüte am Fahrradlenker ihres Vaters zappeln.
»Schollen schwimmen am Abend in seichte Gewässer, um dort maritime Kleinstlebewesen zu fressen. Praktisch, haben sich unsere beiden hier gedacht, jetzt sind wir im seichten Wasser und mussten nicht einmal hinschwimmen. Bestimmt lassen sie sich morgen wieder von einem Kutter fangen.«
»Nein!«, schreit Rosalie.
»Nein, bestimmt nicht«, sagt Lily mit süßlicher Stimme. »Die werden in ihrem ganzen Leben nie mehr gefangen, die werden 100 000 Jahre alt und sitzen irgendwann mit langen Bärten auf dem Meeresboden und erzählen ihren Urururururenkeln von dem kleinen deutschen Mädchen, das ihnen das Leben gerettet hat, indem es einfach so lange geheult hat, bis sie wieder ins Wasser gelassen wurden. Wenn du noch ein bisschen weitergeheult hättest, dann hättest du ihnen gleich ein eigenes Meer anbieten können.«
»Du wolltest sie auch nicht essen.«
»Ich bin Vegetarierin. Ich bin wenigstens konsequent. Denkst du eigentlich noch an das süße Kälbchen, das im letzten Skiurlaub bei Hubers geboren wurde, wenn du dein Wiener Schnitzel isst? Wie hast du es noch genannt? ›Sternchen‹?«
»Ich hasse dich! Dich und deine dämlichen Schweinslocken.« Rosalie boxt ihre Schwester in den Bauch.
»Hört auf, alle beide! Nicht einmal im Urlaub gönnt ihr einem hart arbeitenden Familienvater ein bisschen Frieden. Nicht genug, dass die eigene Ehefrau sich weigert, einen Fisch auszunehmen. Ihr habt auch nichts Besseres zu tun, als mich mit euren Streitereien zu quälen. Viel zu gutmütig bin ich. Ich muss es mir in den Kalender schreiben, dass ich euch nie wieder einen Gefallen tue. Du« – an Lily gewandt – »kannst deine Tennisstunden vergessen. Und du« – Rosalie – »brauchst gar nicht mehr zu fragen, ob du eine Katze aus dem Tierheim holen darfst.«
Die Reste der Schollentränen sind noch hinter Rosalies Lidern. Sie heult, als hätte jemand eine Sirene eingeschaltet. Sie denkt an die kleine Katze, die bestimmt schon auf sie wartet und die sie jetzt nie kennenlernen wird. Binnen Sekunden ist sie knallrot im Gesicht, der Mund ist offen und verzerrt und Speichelfäden hängen zwischen ihren Lippen.
»Na toll«, sagt Lily zu ihrem Vater. »Super gemacht.« Sie legt Rosalie den Arm auf die Schulter, und weil der Vater gerade noch gemeiner ist als Lily, lehnt Rosalie sich an ihre Schwester und heult in ihr mintfarbenes Poloshirt von Lacoste.
»Was ist denn jetzt schon wieder los?« Die Mutter taucht auf. Die Sonne steht genau hinter ihrem Kopf, sodass ihr Gesicht im Schatten liegt und das kurze Haar rot aufflammt. Rosalie rennt zu ihr und drückt sich an ihre Beine.
»Er hahahahat gesagt, dahahass ich keine Kahahatze bekomme.« Der Schmerz beim Aussprechen dieser Nachricht ist so gewaltig, dass er als großes Geheul aus Rosalie herauskommt.
»Mein Gott, du benimmst dich, als hätte man dir ein Bein abgehackt.« Die Mutter schiebt Rosalie weg und wischt ihr mit einem Stofftaschentuch die Tränen ab. In dem Stofftaschentuch sind Krümel. Rosalie versucht, das Schluchzen zu unterdrücken. »Ernst, war das nötig? Du weißt doch, wie sensibel sie ist.«
Der Vater zuckt die Schultern. »Weißt du, Carla, was ich im Heimatmuseum in Quimper gefunden habe?«
Er wartet ihre Antwort nicht ab.
»Einen Brief von einem leitenden Angestellten des CEP, des ›Centre d’expérimentation du Pacifique‹, aus dem Jahr 1969. Es war eine ganze Reihe seiner Briefe dort ausgestellt, weil dieser Mann, ein gewisser Jacques Mouron, später so etwas wie ein Heimatdichter wurde. In dem Brief beschwert er sich darüber, dass die Tahitianer das Fischfangverbot in der Lagune von Mururoa nicht ernst nehmen. Ich habe das recherchiert. Offenbar gehört es zu einer Eigenart der Polynesier, Regeln und Verbote nicht zu befolgen. Dieser Mann beschreibt in seinem Brief, dass viele der Arbeiter wegen Vergiftungen ins Krankenhaus mussten. Dadurch werde die Produktivität der Einrichtung massiv eingeschränkt, schreibt er. Und dass er das Problem mit seinen Vorgesetzten erörtert habe, aber ohne Erfolg.«
Rosalie schluchzt langsamer. Die Mutter hält ihr und Lily eine Dose mit Pulmoll hin, jede nimmt sich eins.
»Carla, weißt du, was das bedeutet?«
Wieder wartet er nicht auf eine Antwort.
»Das bedeutet, die Führungsriege in Mururoa hat die Gefährdung der Arbeiter bewusst ignoriert! Das lässt auch die Berichte glaubwürdig erscheinen, in denen es heißt, dass ein Großteil der damals Beschäftigten gar nicht wusste, dass sie für ein Atomtestprogramm arbeiteten. Häufig trugen sie nicht einmal Schutzkleidung oder zogen sie aus, wegen des heißen Klimas. Du musst bedenken, dass die meisten kein Französisch verstanden. Und auch der, der ein bisschen verstand, konnte den Ernst der Situation kaum begreifen. Ihr Wortschatz ist aus Erfahrungen mit der Natur entstanden, Begriffe wie ›Strahlung‹ und ›Kontaminierung‹ gibt es in ihrer Sprache nicht.«
»Mama, schau mal«, ruft Lily. »Die Schollen sind weg!«
Der Vater erstarrt mit in die Luft gerecktem Zeigefinger und sieht Lily mit steiler Stirnfalte an.
Rosalie zieht die Nase hoch und rennt zum Ufer. Es stimmt, die Schollen sind weg.
»Papa, du hast recht gehabt«, jubelt sie. »Sie haben Mini-Lebewesen gefressen und sind wieder gesund geworden!«
Vater steht immer noch in unveränderter Haltung, die Sonne hinter seinem Rücken. Rosalie kann sein Gesicht nicht erkennen.
»Na also«, sagt die Mutter. »Jetzt haben wir schon mal den zwei Schollen das Leben gerettet, und morgen kümmern wir uns um den Rest der Welt, inklusive Mururoa-Atoll. Bleibt nur die Frage, was wir heute Abend essen, jetzt, wo sich die Schollen endgültig gegen die Bratpfanne entschieden haben. Ich könnte euch Ratatouille anbieten.«
»Super, das ist eh viel besser als totes Tier«, sagt Lily.
Rosalie greift nach der Hand ihrer Mutter. »Können wir noch mehr Schollen kaufen und zurück ins Meer bringen?«, fragt sie und hüpft auf und ab.
»Das musst du deinen Vater fragen, ich weiß nicht, ob der sich noch mal zu den Fischern traut.«
Wachsam schaut Rosalie ihren Vater an.
»Morgen kaufen wir wieder zwei«, sagt er.
»Und setzen sie im Mururoa-Atoll aus. Damit die Polynesier mal ordentlichen Fisch zu essen bekommen.« Lily scheint stolz zu sein, als alle vier zu lachen beginnen.
[Menü]
1980
Die Marmelade ist ein dunkelrotes, tödliches Paradies.
»Papa, schau mal, eine Wespe ist in die Marmelade gefallen.« Rosalie möchte nicht, dass bei ihrem Geburtstagsfrühstückspicknick jemand in Marmelade erstickt. Der Vater beugt sich über das Glas, nimmt einen Löffel und befreit die Wespe aus ihrem klebrigen Grab. Er legt sie auf den Baumstumpf. Die Wespe ist rundum mit Marmelade verkleistert. Ihre Flügel kleben am Körper und nur ein Fühler ist nach vorne gerichtet. Sie sieht klein aus und bewegt sich nicht.
»Sie ist tot.«
»Nein, Rosalchen, sie ist nur eingesponnen. Schau.« Der Vater nimmt einen Plastikbecher und gießt ein wenig Wasser hinein. Den Becher hält er an den Rand des Baumstumpfes und kehrt die Wespe behutsam hinein. Das Wasser reicht der Wespe bis zum Bauch und färbt sich rot.
»Sie blutet.«
»Dummerchen, Wespen bluten nicht. Es ist die Marmelade, die das Wasser rot färbt.« Der Vater pflückt eine Ähre Wilden Weizen und tunkt sie ins Wasser. Behutsam fährt er damit über den Körper der Wespe.
»Sieh mal, ich benutze die Ähre wie eine Bürste. Die Wespe wird schön langsam abgebürstet und bekommt dabei noch eine Massage gegen den Schreck.« Langsam entfaltet sich die Wespe zu ihrer normalen Größe, bewegt Fühler und Beine. Der Vater schüttet sie mit dem Wasser auf den Baumstumpf. Die Wespe kriecht aus dem Wassertropfen und wartet.
»Jetzt muss nur noch die Sonne ihre Flügel trocknen und schon ist sie wieder unterwegs.«
»Stachelchen.«
»Bleibst du hier und passt auf, dass niemand sich auf Stachelchen setzt, bis sie wieder fliegen kann?« Rosalie nickt. Sie hat Lust, der Wespe über den gelb-schwarzen Körper zu streichen, tut es nicht.
Stattdessen schreit sie Lily an, die in einem Meter Entfernung vorbeischlendert: »Ey! Vorsichtig sein, ne? Hier liegt ne Wespe!«
Lily verdreht die Augen, bewegt eine Hand vor dem Gesicht hin und her und geht ihrer Wege.
Die Mutter kommt mit einem Waschkorb voller Schmetterlinge aus Papier.
»Hilft mir mein siebenjähriges Mädchen, die Schmetterlinge in den Bäumen aufzuhängen?«
»Ich muss auf die Wespe aufpassen«, sagt Rosalie und zeigt auf Stachelchen, die ihre Hinterbeine aneinanderreibt.
Als die Mutter alle Schmetterlinge aufgehängt hat und Rosalie langsam ungeduldig wird, breitet Stachelchen ihre Flügel aus und fliegt in den Augustsonntag.
Bald schon kommen Rosalies Gäste: Neben Ella und Bianca sind es Inga, Britta, Lisa, Kerstin, Lasse, Ole, Bosse und noch einige andere. Während die Eltern ein paar Worte wechseln, packt Rosalie die Geschenke aus. Es sind schöne Geschenke, aber Rosalie schaut sie nicht richtig an. Gleich beginnt die große Rosalie-ist-sieben-Geburtstagsrallye.
Rosalie ist mit Inga und Bianca in einer Gruppe. Bianca steht dicht neben ihr, als Rosalie den ersten Briefumschlag öffnet. FINDEDENMURMELNDENBACH steht auf dem Zettel, der in dem Briefumschlag steckt.
»Ich weiß, wo der ist!«, ruft Inga und rennt los. Bianca folgt ihr, und auch Rosalie bleibt nichts anderes übrig. Sie laufen einen Weg entlang, der Waldboden ist weich und rechts und links des Weges stehen hohe Farne. Als sie eine Weile gerannt sind, bleibt Bianca stehen.
»Ich hab Seitenstechen«, sagt sie und beugt sich nach vorne.
»Es muss hier irgendwo sein«, sagt Inga, und Rosalie weiß, dass sie keine Ahnung hat. Langsam geht Rosalie ein Stück weiter. Hier war sie mit dem Vater und hat Elfenbeobachten gespielt. »Und hier«, flüstert die Stimme ihres Vaters ihr durch Tage und Wochen zu, »hier baden die Elfen im Mondschein.«
Der flüsternde Bach, das muss er sein! Rosalie drängt Inga zur Seite und geht zwischen zwei Fichten hindurch auf eine Schonung. Sie erkennt den Baum wieder, den die Elfen zu einer Aussichtsplattform umgebaut haben, und die Parkgarage in dem Ameisenhügel. Nach ein paar Schritten glitzert der Bach durch das Dunkel.
»Kommt!«, ruft sie und hört, wie Inga und Bianca durch das Unterholz brechen.
In dem Bach liegen sechs grün glitzernde Flaschen, Inga stapft mit ihren Gummistiefeln ins Wasser und schnappt sich eine. Ein kleiner goldener Schlüssel ist in der Flasche und ein weiterer Zettel: DERSCHLÜSSELGEHÖRTDEMSCHÖNSTENBAUM. Sofort beginnt Inga auf Bäume zu zeigen. Rosalie nimmt ihr den Schlüssel ab und lauscht auf die Worte ihres Vaters, die in ihrem Gedächtnis verstaut sind. »Wenn eine Buche richtig wachsen darf, dann wird sie mit dem Alter immer schöner. So wie eure Mutter.« Rosalie blickt sich um. Sie sind umringt von stacheligen Fichten. Aber da hinten bilden die Fichten einen Kreis und lassen Licht und Luft in den Wald. In diesem Licht steht die hundertjährige Buche. Rosalie geht näher, ihr Stamm ist glatt und silbrig, und die Blätter glänzen in der Farbe von geronnenem Blut. Der Wind reibt die Blätter aneinander und lässt sie leise wispern. Zwischen ihren Wurzeln liegt ein goldenes Kästchen, Rosalie steckt den Schlüssel hinein und dreht ihn um, bevor die anderen da sind.





























