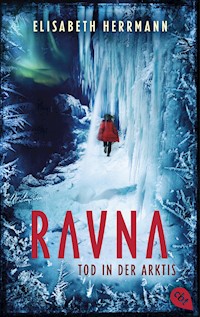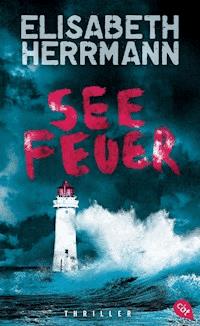9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
Vor dem Landgericht Berlin wird Anwalt Joachim Vernau Zeuge einer merkwürdigen Szene: Die Rentnerin Margarethe Altenburg schießt auf einen Obdachlosen, bricht noch am Tatort zusammen und wird verhaftet. Ist sie verwirrt? Oder eine kaltblütige Mörderin? Joachim Vernau übernimmt die Verteidigung. Doch die scheinbar willkürliche Tat entpuppt sich als Auftakt zu einer rätselhaften Mordserie. Vernau reist in Margarethe Altenburgs Heimatstadt Görlitz. Der erst harmlos scheinende Auftrag wird für ihn zu einer aufwühlenden Begegnung mit der Vergangenheit der alten Frau – und er stößt auf eine längst vergessene Schuld, die nun ihren Tribut fordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Vor dem Landgericht Berlin wird Anwalt Joachim Vernau Zeuge einer merkwürdigen Szene: Die Rentnerin Margarethe Altenburg schießt auf einen Obdachlosen, bricht noch am Tatort zusammen und wird verhaftet. Ist sie verwirrt? Oder eine kaltblütige Mörderin? Joachim Vernau übernimmt die Verteidigung. Doch die scheinbar willkürliche Tat entpuppt sich als Auftakt zu einer rätselhaften Mordserie. Vernau reist in Margarethe Altenburgs Heimatstadt Görlitz. Der erst harmlos scheinende Auftrag wird für ihn zu einer aufwühlenden Begegnung mit der Vergangenheit der alten Frau – und er stößt auf eine längst vergessene Schuld, die nun ihren Tribut fordert.
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
ELISABETH HERRMANN
Die letzte Instanz
Kriminalroman
Die Originalausgabe erschien 2009 im List Taschenbuch,
einem Verlag der Ullstein Buchverlage, GmbH, Berlin.
Neuausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Neuausgabe März 2018
Copyright © 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: plainpicture/Daniel Allan
FinePic®, München
CN · Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-22216-1V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Für Shirin
Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwaltes gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.
Zulassungseid zur Rechtsanwaltschaft,
§ 12a BRAO
A11, Berliner Ring,
Freitag, 3. März, 16:25 Uhr.
Außentemperatur plus 1 Grad, gefrierende Nässe.
Die Gasflaschen.
Irgendwie muss sich der Gurt gelockert haben. Als er in die Spurrillen kurz vor der Ausfahrt Zehlendorf gerät, hört er das Klappern. Er wirft einen Blick in den Rückspiegel. Die Plane liegt straff über dem Gebinde, zwei 16-Flaschen-Bündel, jede gefüllt mit 50 Litern Crypton mit einem Druck von 300 bar. Der Fahrtwind fährt unter die Abdeckung und beult sie aus, sie knattert wie detonierende Knallerbsen, die Kartuschen schlagen gegeneinander.
Herrgottverdammtescheißenochmal.
Kurz vor halb fünf. Um fünf muss er auf der verfluchten Baustelle sein, sonst steht er wieder vor der verschlossenen Tür des Containers und kann sehen, wie, wann und wo er das Zeug loswird. Vermutlich gar nicht. Er kennt den Vorarbeiter, einen schlechtgelaunten, kurz angebundenen Mann, der Abhängige und Untergebene behandelt, als seien sie ihm Genugtuung schuldig für all die Jahre, die er in Unfreude und Unwillen an seinem Arbeitsplatz verharren muss, an den ihn die Alternativlosigkeit gefesselt hat wie den Fährmann an sein Boot über den ewigen Fluss.
Es ist ein Fährmann über den Fluss, der ewig, ewig fahren muss, hin und her, hin und her. Ist es der Fluss Styx? Oder die Überfahrt zum Teufel mit den drei goldenen Haaren? Ewig fahren. Hin und her. Niemals abgelöst. Es ist schwer, dem Kleinen zu erklären, was ewig ist. Er hat es versucht, doch irgendwann aufgegeben. Was ist ewig? – Das hört nicht auf. – Warum hört es nicht auf? – Weil es unendlich ist. – Was ist unendlich? – Der Himmel. Das Meer. Etwas ohne Ende eben. – Und wie ist es ohne Ende? – Weiß ich doch nicht. – Warum weißt du das nicht? – Weil … Himmelherrgottverdammtescheißenochmal.
Dann fängt es auch noch zu schneien an. Eine widerliche Mischung aus Regen und nassen, schweren Flocken, die auf die Windschutzscheibe klatschen. Es ist ein kalter März, und die Straßen sind noch immer vereist von dem nicht enden wollenden Winter. Er muss vorsichtig sein. Runter vom Gas. Langsam, Brauner. Langsam.
Ein Wagen hinter ihm hupt auf und flackert empört mit dem Fernlicht. Blöder Arsch. Fahr doch drauf. Dann wäre endlich ein neuer Lack fällig. Und der kaputte Riegel hinten würde auch ersetzt. War alles nicht drin gewesen im letzten Jahr. Vielleicht in diesem. Es geht wieder los auf dem Bau. Endlich. Früher war das die Zeit, in der es ihn in den Süden gezogen hat. Heute ist es die Zeit der Achtzehn-Stunden-Schichten. Von viel zu wenig Schlaf, weder im Führerhaus noch im eigenen Bett. Er mag das nicht, wenn Steffi so früh aufsteht. Jeden Morgen um drei. Bei Wind und Wetter. Brötchen ausliefern. Vor sechs ist sie selten zurück. Und wenn der Kleine wach wird, bleibt alles an ihm hängen. Waschen. Anziehen. Frühstück machen. Es ist nicht sein Job, sich um das Kind zu kümmern. Es ist ja auch nicht sein Kind.
Er sucht einen anderen Sender, bleibt hängen irgendwo auf der Skala. »Tunnel of Love« von Bruce Springsteen. Gott, ist das lange her.
Die Scheibenwischer verschmieren den Schnee auf der Scheibe, der glasige Film verwandelt die roten und weißen Lichter vor ihm zu tanzenden Flecken, die ihn blenden. Knapp achtzig. Hoffentlich kein Stau. Halb fünf. Die Baustelle. Die Gasflaschen klappern.
Den Pritschenrahmen hat er selbst geschlossen. Rausfallen kann also nichts. Aber wenn das Klirren nicht aufhört, muss er anhalten, aussteigen, mit dem Gurtstraffer auf die Ladefläche klettern, nachsehen, wo es denn dieses Mal wieder hakt. Wo ist der Scheiß-Gurtstraffer? Hat er ihn überhaupt dabei?
Er beugt sich nach rechts und tastet über den Beifahrersitz. Thermoskanne. Klemmbrett. Expander. Stadtplan. Kein Gurtstraffer. Er beugt sich noch tiefer, um auf dem Boden zu suchen, und verreißt das Lenkrad. Der LKW gerät ins Schlingern. Er steuert auf den weißen Randstreifen zu, überfährt ihn, hört das Trommeln der Rillen unter den Rädern, fühlt das Adrenalin in seine Adern schießen – ruhig, ganz ruhig –, fängt den Wagen ab, bremst stotternd, die Flaschen klirren und scheppern, keinen halben Meter vom Graben entfernt hat er ihn wieder im Griff und fädelt sich in den dichten Verkehr ein, der ihn kommentarlos wieder aufnimmt.
Na also. Gelernt ist gelernt. Zwanzig Jahre auf dem Bock jetzt. Er kennt den LKW, weiß um die schwammige Lenkung, den Rost, die Macken mit der Zündspule, das schweißt zusammen wie Ross und Reiter. Kurz nach halb fünf. Und erst an der Stadtgrenze.
Der Bär steht auf den Hinterbeinen und hat die Pfoten zum Gruß erhoben. Er passiert ihn, ohne hinzusehen, wie er das schon so oft gemacht hat, zu oft, um noch die Stele mit dem leeren Ring wahrzunehmen, in dem einst der Ährenkranz mit Hammer und Zirkel das Ende des DDR-Territoriums markierte, zu oft, um sich noch an die langen Warteschlangen zu erinnern, die Laufbänder mit den Pässen, die gelangweilt wirkenden Vopos mit ihren scharfen Hunden, zu oft auch, um noch der Erleichterung nachzuspüren, die er jedes Mal empfunden hatte, wenn er wieder Gas geben konnte auf der hell erleuchteten Avus, die durch den Grunewald direkt auf den Fernsehturm führte wie eine intergalaktische Startrampe zu den Sternen. Zwanzig vor fünf. Es wird knapp. Sehr knapp.
Wenn er ruhig fährt, sind auch die Flaschen ruhig. Er sieht in den Seitenspiegel und erkennt nichts, nur die Scheinwerfer der nachfolgenden Wagen. Der Dreck hat das Glas fast blind gemacht. 800 Liter Crypton. 64 mal 300 bar. Er will das Zeug loswerden. Er beschleunigt wieder auf hundert, wohl wissend, dass er in einer Kontrolle seinen Lappen los wäre. Zu schnell. Gefahrguttransport. Für die Ausnahmegenehmigung hätte er wieder … Scheiß drauf. Die Flaschen beginnen ihren rhythmischen Tanz auf der Ladefläche. Sie hüpfen und zittern, schubsen und rempeln sich an. Kein Rastplatz in Sicht. Er muss runter von der Avus. Scheiß-Gurtstraffer. Scheiß-Flaschen. Scheiß-Stress. Scheiß-Kohle.
Er setzt den Blinker und verlässt die Autobahn am Hüttenweg. Der Wald verschluckt das trübe Licht, Nebel kriecht durch das Unterholz und legt seinen weißen Atem lauernd über die Straße. An der ersten roten Ampel hält er mit quietschenden Bremsen, und die Flaschen kommentieren das Manöver mit einer atonalen Tonfolge, die klingt wie ein verrücktes Glockenspiel. Gleich kippen sie. Er hört das. Wenn eine kippt, reißt sie die anderen mit, wie beim Bowling. Er muss runter von der Straße. Gleich. Jetzt. Sofort. Rechts ein Parkplatz. Er behält die wenigen Jogger und Skater im Blick, die hastig zu ihren Autos zurückkehren, Hundebesitzer, Spaziergänger, Familien mit ihren Rädern. Weiße Wolken vor den Mündern, Frostatem, die Kälte im Nacken wie eine Knute, die sie vorwärtstreibt. Die Straßenlaterne springt flackernd an, verbreitet einen Heiligenschein aus Sprühnebel und Licht. Grün.
Er setzt den Blinker, sieht instinktiv in den Seitenspiegel und biegt ab. Rumpelt über etwas. Ein Mal, zwei Mal. Er sieht in den Rückspiegel. Die Flaschen stehen noch. Er gibt Gas und hört durch das Hochdrehen des Diesels, wie jemand etwas schreit. Brüllt. Nach seinem Hund vielleicht. Sieht noch einmal in den Rückspiegel. Erkennt ein Fahrrad. Verbogen. Und rumpelt ein drittes Mal über etwas. Bremst. Spürt Eiskristalle an seinen Nervenenden. Denkt nicht. Hält an. Steigt aus. Lässt die Tür offen stehen. Geht nach hinten. Sieht die kleinen Gummistiefel neben dem rechten Hinterrad.
Und plötzlich weiß er, was ewig ist.
Sechs Jahre später
1.
Donnerstag, 12. Februar, 12.34 Uhr.
Erster Spatenstich für das Wohn- und Geschäftshaus Tauben- Ecke Glinkastraße, Berlin Mitte.
Der Phaeton rollte hinter der Kreuzung am rechten, frei gehaltenen Fahrbahnrand aus. Der Wind schleuderte Regentropfen an die Seitenscheiben und über den diamantschwarzen Lack. Sie perlten ab und sammelten sich zu kleinen Rinnsalen, die in nicht vorhersehbaren Linien kreuz und quer am Wagen hinunterliefen in den überfluteten Bordstein und in ein fast knöcheltiefes, straßenbreites Schlagloch.
Sieht immer noch aus wie nach dem Krieg hier, dachte er.
Der Mann im Fond des Wagens hatte die fünfzig bereits um einige Jahre überschritten, aber er hielt sich für eine bemerkenswert juvenile Erscheinung. Zumindest wurde ihm das oft genug signalisiert, um an Tagen wie diesen auch daran zu glauben. Die Haare trug er millimeterkurz, etwa so lang wie seinen Dreitagebart, den er mit Hingabe pflegte und der seinem prallen, fast faltenlosen Gesicht einen Hauch Verwegenheit verlieh, während er seine Kleidung in einer wohldosierten Mischung aus Eleganz und Understatement wählte. In den einschlägigen Bars und Nachtclubs der Stadt nahm er die interessierten Blicke der Frauen wie selbstverständlich zur Kenntnis, genauso selbstverständlich wie das Desinteresse seiner Gattin, die ihn noch ab und zu auf Veranstaltungen begleitete, wo ihr ein Mindestmaß an Zerstreuung geboten wurde oder doch wenigstens die Gelegenheit, einen adäquaten, sprich ebenso solventen Nachfolger für ihn zu finden. Da hier, in dieser Baugrube, bis auf ein paar mindestens ebenso fade wie schlecht bezahlte Beamte nur noch Angestellte, Arbeiter und ein paar Schaulustige zu erwarten waren, hatte Trixi es vorgezogen, in Hamburg zu bleiben und sich mit ihren ebenso frustrierten wie noch nicht geschiedenen Freundinnen zum Fünf-Uhr-Tee im Atlantic zu verabreden.
Er klappte den Kragen seines schwarzen Kaschmirmantels hoch und warf einen Blick durch die strömende Nässe auf den Bretterzaun gegenüber. Die Baustelle nahm das gesamte nordöstliche Areal Tauben- Ecke Glinkastraße ein. Es war die letzte Lücke in der goldenen Innenstadt, der Tusch auf das Finale des Hauptstadtbooms. In achtzehn Monaten würde sie geschlossen sein und Platz für 400 Büros, ein Dutzend Einzelhandelsgeschäfte und zwei Restaurants bieten. 1A Filetlage. Investitionssumme 23,4 Millionen. Zwei Dachterrassenwohnungen, eine hundertzwanzig, eine zweihundert Quadratmeter. Die Terrasse natürlich. Die zweihundert waren für ihn.
Die Bundesanstalt für Immobilienwesen, vertreten durch die Bundesanstalt für Bauwesen und Raumordnung, in großen Lettern stand es auf dem meterhohen Schild, das den Attacken der stürmischen Böen solide standhielt, direkt darunter dann sein Name. Projektmanagement: Fides Immo Invest Jürgen Vedder. Ausführung: Fides Bauträger Invest Jürgen Vedder. Noch über der Fachaufsicht, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Der Ritterschlag. Bundesbauten im Portfolio, das war, als hätte der Staatsminister einen persönlich in die Arme genommen. Er lehnte sich zurück und atmete tief ein.
Schließ die Augen. Denk dran. Wie es angefangen hat. Und wo. Jetzt öffne sie und sieh dir an, wie weit du gekommen bist.
Zwei Polizeimotorräder mit Blaulicht bogen langsam und gemächlich um die Ecke. Der Verkehr wurde weiter vorne umgeleitet, so dass sie die gesamte Breite der Straße für sich hatten. Ihnen folgte eine Limousine, die jetzt direkt vor der Zufahrt zum Gelände anhielt. Das Tor im Zaun stand weit offen, vier Angestellte einer privaten Wachfirma sicherten den Eingang und kontrollierten mit stoischer Gleichmut die Einladungen. Dahinter konnte man das weiße Festzelt erkennen, die Baugrube mit dem provisorischen Unterstand, und viele dunkel und praktisch gekleidete Menschen, die sich unter den Heizstrahlern drängten.
Der Beifahrer sprang aus der Limousine und öffnete einen riesigen schwarzen Schirm. Zwei weitere Sicherheitsleute tauchten wie aus dem Nichts auf. Sie trugen keine Uniformen, sondern körpernah geschnittene Anzüge und wasserabweisende gewachste Jacken, weit genug, um die Waffen zu verbergen, die sie mit sich führten. Sie flüsterten in ihre Kragenmikrofone und ignorierten den Regen, der ihnen in Strömen den Rücken hinunterlaufen musste.
Aus dem Wagen stieg der Senator für Stadtentwicklung. Er nahm seinem Assistenten mit einem freundlichen Nicken den Schirm ab und ging zwei vorsichtige Schritte um eine Pfütze herum.
Vedder konnte erkennen, wie der Senator den Kopf in den Nacken legte und nach oben in den dunklen Nachmittagshimmel blickte, dorthin, wo die Brandmauer des Nachbargebäudes über einer blinden Wand endete. Der Putz blätterte ab. An einigen Stellen waren Buchstaben zu erkennen.
Vedder kniff die Augen zusammen. Gant Srcwan. Galanta Strickwaren, ersetzte er automatisch. Er lächelte über diesen Reflex und darüber, dass ihm die geschwungenen Linien hier noch nie aufgefallen waren. Aber wie oft hatte er sich das Grundstück auch schon angeschaut? Ein, zwei Mal. Gekauft und entschieden wurde nicht hier, sondern in Büros und Rechnungsabteilungen und an diskreten kleinen Tischen erstklassiger Hotelrestaurants. Zwei Mal waren sie auch im Capital Club gewesen – unnötig für das abgeschlossene Geschäft, nötig aber für die zukünftigen. Die letzte Unterschrift hatte er an seinem Schreibtisch geleistet, und das zufriedene Gefühl, das sich jedes Mal einstellte, wenn eine neue Herausforderung darauf wartete, souverän bewältigt zu werden, dieses Gefühl breitete sich auch jetzt in seiner Mitte aus.
In zwei Monaten würde der Schriftzug verschwunden sein, verdeckt von Stahlbeton und Sandstein, von hochgezogenen Mauern und gläsernen Aufzügen, vorbei war es dann mit Galanta Strickwaren, niemand würde sich mehr an sie erinnern, ach was, niemand würde sich an die Erinnerung an sie erinnern, denn sie war schon lange Vergangenheit, genauso wie die Buchstaben über verwitterten Kellereingängen und auf Mauern, wo Kohlenhandlung stand, Obst und Gemüse oder Plaste aus Schkopau. Das Gedächtnis der Menschen war flexibel. Es passte sich der Gegenwart an. In ein, zwei Jahren würde jeder schwören, das Ministerium hätte schon immer hier gestanden. So schnell ging das. Merkwürdig, dass der Senator die Buchstaben so weit da oben überhaupt eines Blickes würdigte. Vielleicht war er ein Romantiker. Oder er kam aus dem Osten. Für Vedder lief mittlerweile beides auf das Gleiche hinaus.
Aus der Gruppe der Frierenden löste sich ein Mann und eilte hastig zum Eingang. Mit Befriedigung erkannte Vedder den Senatsbaudirektor. Ein eloquenter Mittvierziger, ein wenig dünkelhaft vielleicht in seinen Ansichten, denn er war ein einsamer Verfechter antiquierter Traufhöhen und homogen gestalteter Stadtkerne. Keine Visionen. Keine Kühnheit. Es hatte Vedder Mühe gekostet und Überzeugungskraft, ihm diese zwei Geschosse mehr abzuringen, die aus einem simplen Bauvorhaben ein Renditeobjekt machten. Dafür mussten halt Sandstein her und Kupfer, damit Patina und Ocker sich nicht bissen mit der behördlichen Vorstellung von Innenstadt. Wenigstens das Glas war im Großen und Ganzen geblieben.
Vedder konnte damit leben. Und der Senatsbaudirektor war zufrieden mit seinem Sieg. Er beobachtete, wie er den Senator mit freundlichem Handschlag begrüßte. Dann flüsterte er ihm ein paar Worte zu. Beide schauten sich suchend um. Man vermisste ihn. Zeit für den Auftritt.
Er öffnete die Tür und setzte das rechte Bein auf die Straße. Der Schlag traf ihn von hinten mit voller Wucht. Das hässliche Geräusch von schepperndem Blech erreichte sein Bewusstsein, als Nächstes schickten seine Nerven eine Fanfare wütenden Schmerz von seinem Knie hinauf in seinen Leib. Ein Schrei. Ein Aufprall. Sie fiel vor ihm auf den Asphalt, als wäre sie aus einer Regenwolke gerutscht. Ihr Einkaufswagen schlitterte weiter, schlitterte noch zwei Meter die Straße entlang, verteilte bunte Baumarktprospekte über die nasse Fahrbahn und blieb dann mit drehenden Vorderrädern mitten auf der leeren Fahrbahn liegen.
Er krümmte sich zusammen. Sie hatte dieses Ding direkt in ihn hineingerammt, als ob sie ihn mit Absicht hätte treffen wollen. Sein Fahrer öffnete die Tür und hastete auf die Frau zu. Vedder versuchte tief einzuatmen. Ihr war nichts geschehen. Langsam rappelte sie sich auf.
»Sind Sie noch ganz bei Trost?«
Vedder richtete sich auf und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Mit zusammengebissenen Zähnen starrte er auf die Frau, die mit anklagend ausgestrecktem Arm auf den Einkaufswagen und die aufgeweichten Prospekte wies.
»Haben Sie Tomaten auf den Augen? Sie können doch nicht einfach die Tür aufmachen!«
Sein Knie schmerzte höllisch. Doch Vedder ließ sich nichts anmerken. Unauffällig bewegte er das rechte Bein. Nichts gebrochen, aber eine ordentliche Prellung. Zwei Uniformierte vom Eingang kamen zu Hilfe. Auch der Senator und der Baudirektor überquerten die Fahrbahn, nicht ohne vorher wie die ABC-Schützen nach links, nach rechts und wieder nach links zu schauen. Am liebsten hätte er dieser keifenden Schlampe eine geknallt. War das normal, dass man mit einem vollbeladenen Einkaufswagen mit dreißig Sachen um die Ecke bog?
»Ich bitte vielmals um Verzeihung«, sagte er. Seinem Mantel war nichts passiert. Der Hose auch nicht. »Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt?«
»Ich … weiß nicht.«
Natürlich wusste sie es nicht. Flink flog ihr Blick über seinen Wagen. Bis auf einen Kratzer im Türleder war nichts passiert, sah man von seiner Kniescheibe ab. Er gab ihr zwanzig Sekunden, dann würde sie mit der Pianistengeschichte kommen und dass diese zarten Finger nun nie wieder Chopin spielen könnten. Natürlich kannte sie weder einen Phaeton noch Chopin. Aber groß war der Wagen, glänzend, und richtig teuer. Wahrscheinlich überschlug sie schon im Geiste, wie viel sie herausschlagen konnte.
Sein Fahrer hob den Einkaufswagen auf und stellte ihn prüfend vor sich hin. Er ließ ihn einige Male vor- und zurücklaufen, dann schob er ihn zu Vedder, der sich Mühe geben musste, die Frau vor sich besorgt zu mustern.
»Ist nichts passiert.«
Misstrauisch betrachtete sie ihr ungewöhnliches Transportmittel, doch es schien fahrbereit. Ein Sicherheitsmann begann damit, die nassen Prospekte aufzusammeln. Sie rieb sich vorsichtig die Arme, als wollte sie ausprobieren, ob noch alles funktionierte. Oder als ob sie frieren würde. Wie alt mochte sie sein? Mitte, Ende dreißig? Ein ungeschminktes Gesicht, nichtssagend, leer, mit geröteten, müden Augen und einem resignierten Mund. Ihre Jacke musste aus einem dieser Textildiscounter stammen, in denen Menschen einkauften, für die ein Mantel weniger kosten musste als ein Kasten Bier. Das dünne Haar hatte sie wohl irgendwann einmal an diesem Tag zu einem Pferdeschwanz gezwirnt. Strähnen hatten sich gelöst und klebten nass an ihren Schläfen. Sie war einen Kopf kleiner als er und wog wohl auch nur die Hälfte.
»Aber die Werbung. Was mach ich denn jetzt?«
Sie sah mit einer derart überzeugenden Ratlosigkeit auf den Müll, den der Sicherheitsmann in ihren Wagen stopfte, dass Vedder einen Augenblick lang geneigt war, ihr Glauben zu schenken. Keine Pianistenhände. Nur Prospekte. Das war gut.
»Hören Sie …«
Der Senator hatte sie erreicht und unterbrach ihn.
»Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Vielleicht haben Sie einen Schock. Sie sollten sich untersuchen lassen. – Herr Vedder, sind Sie verletzt?«
Vedder schüttelte den Kopf. Er hätte der Frau gerne einen Schein in die Hand gedrückt und die Sache damit auf sich beruhen lassen. Da sich der Unfall aber vor mehreren Dutzend Zeugen abgespielt hatte, musste er auch noch den Betroffenen mimen.
»Mir geht es gut. Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
Sie lächelte hilflos. »Is ja eh alles im Eimer. Kann ich auch gleich nach Hause gehen.«
»Nein«, protestierte er. Er packte sie am Arm. »Sie kommen jetzt erst mal mit uns und wärmen sich auf. Hier wird nämlich gefeiert. Und da Sie mir geradezu vor die Füße gefallen sind, lasse ich Sie ab jetzt nicht mehr aus den Augen.«
Er schenkte ihr das Lächeln, das er an Neujahr zum letzten Mal benutzt hatte, als er dem Doorman in seinem Town House einen Hunderter in die ausgestreckte Hand geschoben hatte.
»Ich bin jetzt für Sie verantwortlich.«
Er registrierte das Wohlwollen bei den Umstehenden. Er konnte sie geradezu denken hören. Schau an, schau an, der Vedder. Kümmert sich wirklich um alles und jeden. Ein Mann, der Verantwortung übernimmt. Einer, der nicht kneift. Ein gestopfter Vogel zwar, aber immerhin einer, der sich nicht schämt, mit einer Prospektverteilerin am Arm zu seiner eigenen Feier zu kommen.
»Wir legen heute einen Grundstein. Haben Sie so etwas schon mal erlebt?«
»Nö.«
Sie wischte sich mit dem freien Handrücken den Regen aus dem Gesicht. Gerade rechtzeitig kam sein Fahrer mit dem aufgespannten Schirm angerannt. Vedder nahm ihn, bot der Frau seinen Arm an und achtete sorgfältig darauf, dass sie geschützt vor Wind und Wetter die Baustelle und das Festzelt erreichte. Nach wenigen Schritten ließ der Schmerz in seinem Bein nach, auf der anderen Straßenseite hatte er ihn schon fast vergessen.
Es war ein großer Pavillon, in dem sich gut und gerne zweihundert Menschen drängelten. Er ließ dem Senator den Vortritt.
»Wie heißen Sie denn?«
»Rosi. Roswitha eigentlich. Kurz Rosi.«
»Rosi«, wiederholte Vedder. »Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? Oder einen heißen Kaffee? Möchten Sie etwas essen? Dort hinten ist das Buffet. Ich denke, wir schlagen uns einfach mal durch.«
Rosi nickte stumm. Vedder bahnte sich einen Weg durch die Gäste, die sich alle aus irgendwelchen Gründen direkt am Eingang zusammengeballt hatten und ihm nur dann eine Gasse öffneten, wenn sie ihn erkannten.
Die Architekten. Irgendjemand musste ihnen einmal sagen, dass diese kleinen Brillen mit den dunklen Horngestellen affig aussahen. Genauso wie die schwarzen Rollkragenpullover. Vedder hätte unter Millionen Menschen auf Anhieb bestimmen können, wer von ihnen Architekt war. Hielten sich immer irgendwie für Künstler.
Die Vorarbeiter. Schutzhelme, wattierte Jacken, klobige Schuhe. Ein paar Entscheidungsträger aus den Ministerien samt Vorzimmerpersonal. Zu dünn angezogen. Froren immer auf Baustellen, selbst im Sommer. Die Ingenieure. Die Zimmerleute. Die Frauen der Architekten mit dämlichen Ponyfrisuren und grellroten Mündern, verblühte Studentinnen vergessener Semester, gefangen im Vorstadthäuschen mit zweihundert Quadratmetern Garten. Ein paar von ihnen hatte er gefickt, sie waren so langweilig wie ihre DIN-gerechten Küchendurchreichen. Im Vorübergehen sah er, wie eine von ihnen den Kopf wandte und überrascht auf seine Begleitung starrte.
»Ach Rosi«, sagte er. »Rosi, Rosi, Rosi.«
Vor dem Buffet blieben sie stehen. »Möchten Sie eine Erbsensuppe? Oder erst die Vorspeisen?«
Rosi hing immer noch an seinem Arm. Er war ihr Fels in der Brandung. So eine Gesellschaft kannte sie höchstens aus den Zerrbildern der Vorabendserien, die um diese Uhrzeit in blauen Kisten hinter gelben Gardinen flimmerten. Die Hellste schien sie nicht zu sein. Kein Wunder, wenn sie ihr Geld bei diesem Wetter mit Prospektaustragen verdiente.
»Ich ersetze Ihnen natürlich den Schaden. Zwei Weißwein, bitte. Sie trinken doch Weißwein?«
Rosi machte ein unentschlossenes Gesicht. Er drückte ihr die Gläser in die Hand und wies auf einen kleinen Stehtisch in der Nähe des Buffets, auf dem sich bereits einige benutzte Tellerchen stapelten.
»Eigentlich wird erst später gegessen. Nach getaner Arbeit. Aber Sie sehen aus, als könnten Sie schon jetzt was vertragen. Was möchten Sie denn?«
»Mozzarella«, sagte sie. »Mit Tomaten.«
Vedder lud ein halbes Dutzend der kleinen Kugeln und einige Kirschtomaten auf einen Teller. Als er sich wieder umdrehte, stand die Architektenfrau neben ihm. Ihr Blick folgte Rosi, blieb an ihrem Rücken hängen, glitt über die Schmutzspuren auf der schäbigen Jacke und die vom Regen durchnässten Schultern, bevor ihre magere Gestalt hinter einer Gästegruppe verschwand. Mit einem ironischen Lächeln drehte sie sich zu ihm um.
»Deine neue Freundin?«
Sie sprach leise. Fieberhaft suchte er nach ihrem Namen. Johanna? Susanna?
»Sie ist mir mit einem Einkaufswagen in die Wagentür gelaufen.«
Anna vielleicht? Hanna? Die Frau lächelte amüsiert.
»Guter Trick. Ich werde ihn mir merken.«
Sie hob ihr Weinglas und trank einen Schluck. Er bemerkte die Gänsehaut über ihrem Schlüsselbein und spürte, dass er geil wurde. Hinter dem Zelt standen drei Bauwagen. Er müsste sich nur den Schlüssel geben lassen. Doch sie nickte ihm kurz zu und verschwand wieder in der Menge. Später. Jetzt musste er erst mal diese Rosi loswerden und sich dann um die wichtigen Gäste kümmern. Erst das Geschäft. Dann das Ficken. Eins nach dem anderen.
Er trat zu Rosi und stellte den Teller vor ihr ab. Die Zimmerleute drängelten nach draußen. Der Senator unterhielt sich mit einem Staatssekretär, doch während er sprach, sah er kurz auf die Armbanduhr und entschuldigte sich dann mit einem knappen Nicken.
»Rosi, Rosi.«
Vedder sah sie gar nicht an. »Ich muss jetzt los. Ist alles in Ordnung? Geben Sie meinem Fahrer Ihre Adresse. Ich komme für den Schaden auf.«
»Wer sind Sie eigentlich?«
Vedder, der sich gerade umdrehen wollte, hielt inne. »Sie kennen mich nicht?«
Rosi schüttelte den Kopf.
»Jürgen Vedder, ich bin der Investor. Ich baue das Ganze hier.«
Er hatte Überraschung erwartet. Bewunderung. Nicht aber, dass sich plötzlich ihre Augen weiteten und sie ihn mit offenem Mund anstarrte.
»Vedder?«, fragte sie. »Der Jürgen Vedder?«
Hastig kramte er nach seinen Visitenkarten und reichte ihr eine.
»Hier stehen meine Büronummern. Rufen Sie einfach an, dann können wir alles Weitere besprechen.«
»Jürgen Vedder?«
Stirnrunzelnd sah sie auf die Karte.
»Stimmt was nicht?«
Sie ließ die Karte sinken und sah ihn an. Sie hatte graue Augen. Eine Farbe, die ihn immer irritiert hatte. Unentschlossenheit, Lebensferne, Phlegma, das kam ihm in den Sinn, wenn er an graue Augen dachte. Baumarktprospektverteileraugen. Doch plötzlich schien sich das Grau in Stahl zu verwandeln.
»Jürgen Vedder«, sagte sie. »Sie haben nicht immer Häuser gebaut.«
»Das stimmt. Aber ich muss jetzt leider.«
»Sie haben mal ganz klein angefangen. Damals, nach der Wende.«
Aus den Augenwinkeln beobachtete er, dass die Blaskapelle über die roh gezimmerte Holztreppe in die Baugrube stieg. Unten hatten sich bereits drei adrett gekleidete junge Damen vom Studentenwerk in den Schutz des kleinen Unterstandes begeben, sie trugen Schatulle, Kelle und Stein wie Orden auf roten Kissen. Es wurde Zeit. Als er sich wieder zu Rosi umdrehte, bemerkte er, dass sie gerade hastig etwas in ihre Jackentasche gesteckt hatte. Wahrscheinlich eine Stoffserviette oder ein kleines Salzfässchen. Es gab nichts, was auf Baustellen und Grundsteinlegungen nicht geklaut wurde. Am meisten von denen, die es am wenigsten nötig hatten. Was auch immer es gewesen war, er gönnte es ihr, und betrachtete in diesem Moment seine Fürsorge als erledigt.
»Das haben viele. Es waren gute Jahre.«
Er sah sich nach dem Senatsbaudirektor um, doch er konnte ihn nirgendwo entdecken. Die Architektenbraut stand ein paar Meter entfernt. Sie sah ihn an. Er hielt diesem Blick stand, solange es ging, und spürte, wie das Blut in seine Lenden schoss. Dann schob sich eine Abordnung der Bauverwaltung zwischen sie, und als das Menschenknäuel sich endlich Richtung Ausgang entwirrte, war sie weg. Er ignorierte seinen halbsteifen Schwanz, nahm einen Zahnstocher und spießte erst eine Mozzarellakugel und dann eine Tomate auf.
»Ich habe immer gesagt, wer in den Neunzigern kein Geld verdient hat, wollte keins.«
Er schob sich hastig den Happen in den Mund, nahm eine Papierserviette und tupfte sich kauend die Lippen ab.
»Ich muss jetzt. Wir sehen uns.«
Er schluckte und stockte. Etwas war ihm im Hals stecken geblieben. Er hustete und bekam keine Luft. Hilflos keuchte und würgte er, lächelte verzweifelt, dann verwirrt, hatte plötzlich Tränen in den Augen, spürte, wie er rot anlief und ihm jemand zu Hilfe kam. Jovial klopfte ihm ein Bauarbeiter auf die Schulter. Dann, als es nichts half und Vedder in die Knie ging, schlug der Mann heftiger. Rief etwas. Andere kamen dazu, beugten sich über ihn, schüttelten ihn, rissen ihm Kragen und Hemd auf. Er ging zu Boden. Verkrampfte die Hände um seinen Hals, spürte den Schmerz in seiner Lunge, hörte seinen Herzschlag dröhnend in den Ohren, rang verzweifelt um Luft, seine Zunge wurde dick und pelzig, sein Körper zuckte, seine Beine strampelten, und die ganze Zeit stand Rosi daneben, reglos, stumm, der graue Blick bohrte sich in seine Netzhaut, glühende Punkte tanzten in der Nacht, Rufe von weit her, die er nicht mehr verstand, schwarze Schleier, die heranschwebten, und er dachte noch, wie zynisch, wie unglaublich zynisch, wer in den Neunzigern kein Geld verdient hat, der wollte keins, das sind die letzten Worte von Jürgen Vedder, da hätte es wirklich Besseres gegeben, dann spürte er seinen Herzschlag wie einen tibetanischen Gong, wieder und immer wieder, er wunderte sich, wie lange es dauerte, bis der letzte Ton verklungen war und die Stille kam, und die Nacht, die eine nie gekannte Wärme über ihm ausgoss und ihn mit sich forttrug, weit, weit fort.
Vedder lag auf dem Boden. Seine Glieder hatten sich entspannt, seine leeren Augen starrten nach oben. Unwillkürlich folgte Rosi diesem letzten Blick durch die Regenschnüre, die vom Zeltdach liefen, wie ein nasser Vorhang sah das aus, dann die holzverschalte Grube, dahinter die Brandmauer und auf ihr ein paar verblasste große Buchstaben, DDR-Werbung aus den sechziger Jahren. Dorthin hatte er gesehen. Merkwürdig.
Jemand rempelte sie an. Die Menschen, die sich eben noch um Vedder bemüht hatten, traten zurück. Sie schoben die Umstehenden weg von der Leiche, als gebiete der tote Körper Respekt und Abstand. Eine Frau schluchzte. Die Bauarbeiter nahmen die Helme ab. Alle Gespräche erstarben. Plötzlich konnte sie den Regen hören, der auf die Plastikplane trommelte.
Sie verließ das Zelt und ging über die rohen Bohlen zum Ausgang. Der große dunkle Wagen stand noch da, die Blaskapelle wartete auf den Einsatz, die Wachleute wehrten noch immer alle Neugierigen ab, die das Flutlicht der Scheinwerfer angelockt hatte. Sie ließen sie anstandslos passieren. Draußen auf der Behrenstraße fand sie ihren Einkaufswagen mit den völlig unbrauchbaren Prospekten. Langsam schob sie ihn vor sich her, bis sie die nächste Straßenecke erreichte. In einem Hauseingang suchte sie Schutz und kramte mit klammen Fingern ihr Handy hervor.
Vorsichtig warf sie einen Blick über die Schulter. Doch der Bürgersteig war leer. Von fern hörte sie die jaulende Sirene eines Notarztwagens, der von der Friedrichstraße heruntergebraust kam, zu spät, zu spät.
Sie musste nicht lange nach der Nummer suchen.
Früher war alles besser.
Früher gab es noch richtige Winter. Tomaten schmeckten nach Tomaten, die Mark war was wert in der Welt, und ich, ich ging im Landgericht ein und aus, weil ich große Strafprozesse und Granatenrevisionen führte und nicht so wie heute nur ein geduldeter Gast war, der mit seinem kläglichen, unbedeutenden Fall Asyl gefunden hatte, weil im Amtsgericht Charlottenburg mal wieder die Heizung ausgefallen war.
Ich stand in dem gewaltigen Treppenhaus und sah den anderen zu, wie sie geschäftig die Stufen hinauf- und hinabeilten, sich flüchtige Grußworte zuwarfen, mit ihren Handys redeten, ihre Klienten flüsternd ein letztes Mal berieten, ich sah all die großen Strafverteidiger und würdigen Richter in ihren schwarzen Roben, die Staatsanwälte und Schöffen, sogar die Mandanten sahen hier anders aus, und ich fühlte Wehmut. Ich gehörte nicht mehr dazu. Ich war abgewandert in die Welt der Kleinkriminalität und Amtsgerichte. Automatenknacker. Mietnomaden. Tachomanipulierer. Ich hatte hier nichts mehr zu suchen.
»Ich würd jetzt gern eine rauchen.«
Mein Mandant hatte sich extra für diesen Tag geduscht und rasiert. Er trug ein Hawaiihemd aus einer der Kleiderkammern irgendwelcher bezirklichen Sozialdienste, ausgeblichene Jeans und ein viel zu weites Sakko. Vielleicht hatte es ihm einmal gepasst, Jahre musste das her sein, auch so ein Leben von früher, als alles besser war und er noch nicht in einem Schlafsack neben einem verrotteten Toilettenhäuschen im Kleistpark schlief, wo er bereits zwei Mal von Mitarbeitern der Stadtmission halb erfroren gefunden und im Kältebus in eine der Notunterkünfte gebracht worden war.
Er hieß Hans-Jörg Hellmer. Er war zweiunddreißig und sah aus wie fünfzig. Ein Exjunkie mit einem derart langen, aber harmlosen Vorstrafenregister, dass ich die Akte Kevin überreicht und nur um eine kurze Zusammenfassung gebeten hatte. Hellmer hatte nichts an Beschaffungskriminalität ausgelassen. Irgendwann einmal, zu einem Zeitpunkt, zu dem andere sich den goldenen Schuss setzten, fing er mit Alkohol an, stieg aus sämtlichen Resozialisierungsmaßnahmen und Methadonprogrammen aus und beschloss, dem Schweinesystem komplett die kalte Schulter zu zeigen.
Ein paar Jahre ging das gut, weil das Schweinesystem trotz Hellmers Verachtung auch weiterhin darauf bestand, für ihn zu sorgen. Jeden Monat um den Fünfzehnten herum hatte er kein Geld mehr. Dann holte er sich Gutscheine, die er in den Discountern gegen Lebensmittel eintauschen konnte. Keine Zigaretten. Kein Alkohol. Nur Lebensmittel.
Hellmer hielt sich daran und kaufte mit den Gutscheinen Mineralwasser. Gebindeweise. In rauen Mengen. Gleich um die Ecke schüttete er das Wasser in den nächsten Gully und brachte die Flaschen zurück. Für das Pfandgeld kaufte er sich Lippstädter Doppelkorn. Die Sache lief wunderbar, bis er eines Tages den Fehler beging, mittags einen Discounter in der Nähe seines Sozialamtes aufzusuchen. Eine junge Sachbearbeiterin tätigte zu dieser Zeit einige Einkäufe und beobachtete mit steigender Entrüstung, wie das Geld des Steuerzahlers sprudelnd im Rinnstein versickerte, um sich unter gehörigem Reibungsverlust zurück in Wasser zu verwandeln, dieses Mal allerdings mit einem Alkoholgehalt von über 50 Prozent.
Noch vor dem ersten Schluck konfiszierte sie den Doppelkorn, stieß unhaltbare Drohungen aus und ließ den durstigen Hellmer verdattert auf seiner Parkbank zurück. Da mein Mandant körperlich an eine gewisse Mindestzufuhr geistiger Getränke gewöhnt war und sich die Möglichkeiten gerade erschöpft hatten, sie auf halbwegs legalem Wege zu beschaffen, dauerte es nicht lange, bis er den Discounter stürmte, eine Flasche Brandy köpfte, den heraneilenden Marktleiter als Büttel des verhassten Systems wüst beschimpfte, mehrere Flaschen unter seine Daunenjacke stopfte und tatsächlich glaubte, das Weite suchen zu können.
Er hatte nicht mit dem Widerstand der Kassiererin gerechnet. Und mit vier Kunden, die schnell feststellten, dass Hellmer kein Gegner war, und den schmächtigen, kleinen Mann quer durch die Regale hetzten. Dabei gingen die Brandyflaschen zu Bruch und zwei DVD-Recorder zu je 199 Euro, das Schnäppchenangebot der Woche.
Insgesamt entstand also ein Schaden von knapp 500 Euro. Den konnte Hellmer natürlich nie und nimmer abtragen. Das sah der Richter genauso. Dennoch mussten Diebstahl und Sachbeschädigung gesühnt werden, und Hellmer kam mit 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit davon, die er irgendwann im Laufe des Jahres Laub kehrend im Dienste der Miniermottenbekämpfung ableisten durfte.
Mehr war nicht drin. Hellmer allerdings wirkte etwas unglücklich, als er seine selbstgedrehte Zigarette fertig hatte und sich suchend nach einem Aschenbecher umsah.
»Hier wird nicht geraucht«, sagte ich.
Hellmer runzelte die Stirn. »Seit wannen ditte?«
Seufzend steckte er das krumme Stäbchen zurück in seinen Tabaksbeutel. Ich beschloss, ihm etwas Gutes zu tun und ihn zum Essen einzuladen.
»In der Kantine gibt es heute Grießbrei mit Kirschen. Haben Sie Lust, mich zu begleiten?«
»Ich hätt aber eher Durst. Gibt’s da auch Bier?«
»Natürlich.«
Ein paar Schritte weiter befand sich der Aufzug. Wir warteten schweigend, bis sich die schweren Metalltüren geräuschlos öffneten und ich Hellmer den Vortritt ließ. Der Fahrstuhl war fast voll, sämtliche Etagenknöpfe bis hoch zur Kantine leuchteten rot. Wir zwängten uns hinein, die Türen schlossen sich, und eine kräftige Stimme hinter mir rief: »Vernau! Ich werd verrückt!«
Mühsam drehte ich mich um. Ich sah einen beigen Seidenbinder und darüber das braungebrannte, fröhliche Gesicht von Sebastian Marquardt.
»Was machst du denn hier?«
Alle in der Kabine schien diese Frage zu bewegen, denn sie starrten mich an und warteten auf eine Antwort.
»Ich wollte in die Cafeteria.«
Marquardt lachte. Das hatte er nicht verlernt. Dieses herzhafte, aus dem Bauch hochkollernde Lachen, vertrauenerweckend, freundschaftlich, urgewaltig, und wer ihn nicht kannte, konnte glauben, es gelte tatsächlich seinem Gegenüber. In Wirklichkeit war es nur ein Ausdruck ganz persönlicher Erheiterung, ohne Rücksicht darauf, ob er gerade jemanden an- oder auslachte.
»Lange nicht gesehen. Hast du hier zu tun?«
Ich nickte. Der Fahrstuhl hielt in jedem einzelnen Stockwerk.
»Was Großes also?«
Ich schwieg.
Marquardt grinste. Wir erreichten die fünfte Etage. Alle drängten sich hinaus. Ich verlor Hellmer aus den Augen, und dann sah ich sie.
Sie kam durch die Schwingtür der Kantine auf den Flur geeilt, eine klitzekleine Flasche Multivitaminsaft in der Hand, sah die offenen Türen des Aufzugs, rief: »Nehmen Sie mich noch mit?«, schwebte auf zehn Zentimeter hohen Stilettos über das Linoleum, schenkte mir ein höfliches und Marquardt ein überwältigendes Lächeln, und schlüpfte an ihm vorbei, der bei ihrem Anblick wohl völlig zu vergessen schien, wer er war und wo er hinwollte. Er blieb freudestrahlend im Aufzug, und als er den Knopf zum Offenhalten der Tür losließ, entschloss ich mich im Bruchteil einer Sekunde, Hellmer Hellmer sein zu lassen und mit diesem Geschöpf aus einer anderen Welt nach unten zu fahren.
Ich rettete mich in die Kabine.
»Danke«, sagte sie.
»Bitte, gern geschehen«, erwiderte Marquardt.
Mit einem eleganten Schwung warf sie ihre schulterlangen, glänzenden dunklen Haare nach hinten, verstaute die Flasche in ihrer Handtasche und unterzog sich einer strengen Kontrolle im Spiegel an der Rückwand. Sie sah aus wie eine Mischung aus Demi Moore und Schneewittchen, und sie trug ein schmalgeschnittenes dunkelblaues Kostüm mit einer enganliegenden Jacke und einem knielangen Bleistiftrock, über den sie jetzt mit einigen hastigen Handbewegungen strich, um imaginäre Falten zu entfernen. Dann drehte sie sich zur Seite, musterte ihre Silhouette, und entdeckte im Spiegel, dass ich sie die ganze Zeit ansah. Sie runzelte die Stirn und drehte sich um.
»Darf ich vorstellen?«, fragte Marquardt. »Salome Noack, Staatsanwältin. Und das ist Joachim Vernau. Rechtsanwalt.«
Sie reichte mir die Hand. Sie war schmal und kühl und kräftig, und ich hätte sie am liebsten nicht mehr losgelassen.
»Welche Kanzlei?«
»Vernau und Hoffmann«, antwortete ich.
»Kenne ich nicht. Ist er in deiner Entourage?«
Marquardt schüttelte bedauernd den Kopf. Das Letzte, was ich im Zusammenhang mit ihm gehört hatte, war der glückliche Ausgang eines verhinderten Prozesses, in dem er ein Aufsichtsratsmitglied der Bank des Landes vertreten hatte. Bedauerlicherweise hatte sich sein Mandant aus Krankheitsgründen von der Verantwortung für einen läppischen 200-Millionen-Euro-Schaden entbinden lassen müssen. Das schwer zu definierende Gebrechen, von mehreren Gutachtern als eine Mischung aus narzisstischer Depression und Weltschmerz vage umrissen, schloss eine Teilnahme an weiteren Prozessen völlig aus. Sogar die Untersuchungshaft war dem Angeklagten wegen seiner zarten Konstitution nicht mehr zumutbar. Dass er die ihm verbliebenen schwindenden Kräfte dazu nutzte, sich unter anderem für den New-York-Marathon vorzubereiten, war etwas, das der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln war. Vor allem, weil diese Öffentlichkeit für die in den Sand gesetzten Millionen aufzukommen hatte und dafür etliche Kindergärten, Nachtbuslinien und Leihbüchereien opfern musste.
Marquardt allerdings hatte seinen Mandanten so restlos überzeugend vertreten, dass dieser bis zu diesem Tag nicht zur Rechenschaft gezogen worden war und sein Privatvermögen auch weiterhin unangetastet blieb. Wenn man bedachte, dass Hellmer für einen Schaden von 500 Euro 200 Stunden lang Laub kehren musste, dann wären das, hochgerechnet auf 200 Millionen, achtzig Millionen Stunden Straßenfegen. 9100 Jahre lang rund um die Uhr. Gnädig berechnet hundert Mal lebenslänglich.
Im Namen des Volkes werden Sie wegen Anlagebetruges und den daraus resultierenden Folgen, unter anderem, dass hundertsechzigtausend Schüler nun ihre Lehrbücher selber kaufen müssen, weil das Land Berlin pleite ist, zu hundert Mal lebenslänglich Straßenfegen verurteilt. Das traute sich natürlich kein Richter, noch nicht einmal in Amerika. Beim Geld herrschten andere Gesetze. Vor allem ab sieben Nullen aufwärts.
Salome Noack nahm Marquardts Kopfschütteln zum Anlass, mich keines Blickes mehr zu würdigen. Trotzdem holte ich meine vorletzte Visitenkarte aus der Anzugtasche und überreichte sie ihr.
»Falls Sie mal einen richtig guten Anwalt brauchen.«
Irritiert warf sie einen kurzen Blick auf das Kärtchen. »Vielen Dank. Ich werde daran denken.«
»Ich bitte darum.«
»Herr Vernau war ein ganz großes Talent im Zivilstrafrecht.«
Marquardt legte nur den Hauch einer Betonung auf das war und schenkte mir ein inniges Du-hättest-ein-ganz-Großer-werden-können-Lächeln. Ein zarter Gongschlag ertönte. Erdgeschoss. Geräuschlos öffnete sich die Tür. Salome Noack zupfte die Ärmelenden ihrer Seidenbluse an den Handgelenken zurecht und ging hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Marquardt folgte ihr.
»Wir sollten mal zusammen essen gehen«, rief er mir zu. »Ich ruf dich an!«
Schon war er in ihrem Fahrwasser hinter der Ecke verschwunden. Drei kichernde Protokollführerinnen und eine Archivarin, die mir vage bekannt vorkam, traten ein und drängten mich zurück an den Spiegel. Ich fuhr wieder hinauf in den fünften Stock. Etwas Weißes lag auf dem Boden. Meine Visitenkarte. Ich hob sie auf, pustete den Dreck ab und steckte sie zurück zu der anderen.
In der Kantine war Hellmer nicht zu finden. Das ärgerte mich. Da wollte ich einem Obdachlosen etwas Gutes tun, und er verschwand einfach. Während ich auf den Aufzug wartete, der mich wieder nach unten bringen sollte, sah ich aus dem Fenster hinunter auf die Littenstraße.
Salome Noack ging zügig über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite. Vermutlich hatte sie eine Verabredung in einem der gutbürgerlichen Lokale um die Ecke. Marquardt blieb zurück und rief ihr noch einen kurzen Gruß zu, den sie mit einem halbherzigen Heben des Armes beantwortete. Er trollte sich hinters Haus zu den Parkplätzen, und ich freute mich über seine Abfuhr.
Dann sah ich Hellmer. Er verließ das Landgericht, zündete sich seine Selbstgedrehte an und hielt auf die Würstchenbude weiter vorne Richtung Leipziger zu. Vermutlich gab es dort Lippstädter. Eine ältere Dame stand dort an einem der kleinen Stehtische und suchte gerade etwas in ihrer Handtasche. Ein Mann führte einen Hund an der Leine. Ein Fahrradkurier preschte die Straße hinab. Jemand beging den unverzeihlichen Fehler, mit seinem Wagen direkt vorm Gericht in zweiter Reihe zu warten.
Dann kam der Aufzug, ich stellte mich an, und dann peitschte der Schuss.
In drei Schritten war ich wieder am Fenster.
Hellmer hatte die Hände erhoben und stand wie festgenagelt auf der Straße. Die Sache war ernst. Die alte Dame hielt eine Waffe in der Hand, zielte erneut und drückte ab. Die Schreie waren bis hier oben zu hören.
Der Aufzug war weg.
Ich rannte ins Treppenhaus und raste fünf Stockwerke nach unten. Vor dem Eingang hatte sich eine hysterische Menge versammelt, zwei bewaffnete Vollzugsbeamte keilten sich gerade durch die Gaffer. Ich folgte ihnen, bevor sich die Bresche hinter ihnen schloss. Wieder ein Schuss.
»Weg da!«, brüllte mich einer der Blauen an. »Zurück! Alle zurück!«
Er zog seine Dienstwaffe und suchte Deckung hinter einer der großen, runden Säulen, die den Eingang flankierten. Hellmer schwankte hin und her.
»Was sollen das?« Seine Stimme kippte. »Was ist das für ‘ne Scheiße, he? Was tun Sie denn da?«
Sie drückte wieder ab. Der Rückschlag warf sie fast um. Die Kugel bohrte sich zwanzig Zentimeter vor ihm in den Boden. Hellmer, der endlich begriff, dass Treffen wohl nicht die größte Stärke seines Gegenübers war, tat nun endlich das einzig Richtige. Er türmte.
Die Dame rief ihm etwas hinterher. Sie hob noch einmal die Waffe, zielte und brach zusammen. Die Vollzugsbeamten sprinteten über die Straße. Ohne jede Gegenwehr wurde die Frau entwaffnet und mit Handschellen gefesselt. Dann versuchten sie, sie hochzuziehen. Es misslang. Sie war offenbar ohnmächtig.
Ich rannte los. Gerade tauchte der Imbissbudenbesitzer wieder hinter seinem Tresen auf. Auch zwei, drei Gäste, die sich zwischen parkenden Autos versteckt hatten, trauten sich aus ihrer Deckung hervor. Von Hellmer sah ich nur noch eine Staubwolke.
»Hallo? Hallo!«
Der dickere der beiden Schutzmänner beugte sich über die Frau. Sie war ungefähr siebzig Jahre alt, hatte schlohweiße, zu ordentlichen Löckchen gedrehte Haare, trug einen beigen Staubmantel und Schuhe, die ausgesprochen gesund aussahen. Irgendwie erinnerte sie mich an meine Mutter. Und das war wohl auch der Grund, weshalb ich neben ihr in die Hocke ging. Ihre Augenlider flatterten.
»Mein Kreislauf«, flüsterte sie. »Meine Tropfen.«
»In Ihrer Handtasche?«
Ich wollte nach der Tasche greifen, aber der Schutzmann hatte sie genau in diesem Moment an sich gerissen.
»Nichts da.« Mit grimmigem Blick öffnete er sie und stellte nach genauestem Durchwühlen fest, dass sich keine zweite Waffe in ihr befand. Er zog ein kleines Batisttaschentuch heraus und reichte es seinem Kollegen, der damit vorsichtig die Pistole umwickelte und an dem Lauf roch.
»Das waren keine Platzpatronen.«
Ich versuchte, einen Blick auf die Waffe zu erhaschen, aber aus dieser Entfernung war es aussichtslos. Makarov oder Walther, auf jeden Fall klobig, grau und schwer. Und ziemlich unhandlich. Vor allem für eine so zierliche, nette alte Dame.
Sie versuchte ein schwaches Lächeln. »Könnten Sie mir vielleicht die Handschellen abnehmen? Mir ist nicht gut. Ich brauche meine Tropfen.«
»Sie hören doch. Die Dame braucht Ihre Medizin.«
Der Schutzmann mit der Handtasche geruhte, mir einen kurzen Moment seine Aufmerksamkeit zu schenken. »Kennen Sie die Frau?«
»Nein, aber …«
»Junger Mann. Die Dame ist vorläufig festgenommen und wird umgehend dem Haftrichter vorgeführt. Ende der Diskussion. Bitte gehen Sie auf die andere Straßenseite.«
Ich hörte den kurzen, abgehackten Takt von eleganten Damenschuhen auf dem Straßenpflaster. Ich drehte mich um und sah Salome Noack. Mein Herz setzte aus, um dann umso heftiger weiterzuschlagen.
Sie erreichte uns und sah sich um. Die alte Frau hatte die Augen geschlossen. Salome beugte sich kurz herunter. Und dann geschah etwas Merkwürdiges. Sie berührte sie an der Schulter, als ob sie sie aufwecken wollte. Es war eine Geste, die überhaupt nicht zu ihr passte, weil all das Schnelle, zielgerichtete Tun plötzlich für eine Sekunde von tiefer Bestürzung abgelöst wurde und sie gar nicht zu bemerken schien, dass ich so nahe neben ihr kniete. Doch sofort hatte sie sich wieder in der Gewalt. Schnell richtete sie sich auf und ging zu den Beamten.
»Was ist passiert?«
Offenbar kannten sich Schutzmann und Staatsanwältin, denn bei ihr gab er sich wesentlich kooperativer.
»Die Frau hier hat vier Schüsse auf einen Mann abgegeben. Der Mann konnte flüchten, die Frau ist zusammengeklappt.«
»Auf … einen Mann? Ganz sicher? Wo ist er?«
Ich beobachtete sie genau. Sie war ratlos wie wir alle.
»Geflohen. Hätte ich auch getan an seiner Stelle. Sie hat ihn angesprochen und dann auf ihn geschossen. Gezielt geschossen.«
Salome nickte knapp. Sie hatte alles wieder unter Kontrolle. Auch sich selbst. Jetzt erst fiel ihr Blick auf mich. Sie hatte blaue Augen. Wie schön, dachte ich. Es gab wenige Menschen mit dunklen Haaren und so einem intensiven azurblauen Blick. Leider lag nicht die geringste Wiedersehensfreude darin.
Ich stand auf. »Die Frau braucht einen Arzt.«
»Wer … ach so. Sie sind das. Bernau?«
»Vernau.«
»Kennen Sie die Frau? Oder den Flüchtigen, auf den sie geschossen hat?«
Die Frage kam kalt und professionell. Ich warf einen Blick auf die alte Dame. Sie war kreidebleich, atmete schwer und schien desorientiert. Außerdem lag sie immer noch auf dem Boden und sah so unglaublich harmlos und schutzbedürftig aus. Statt einer Antwort streifte ich mein Jackett ab, knüllte es zusammen und schob es ihr unter den Kopf. Ich fühlte ihre Stirn. Kalter Schweiß. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Gaffer aus dem Gebäude sich langsam heraustrauten. Und dass Marquardt um die Ecke bog.
Wenn ich jetzt zugab, Hellmer zu kennen, wurde ich in null Komma nichts zum Zeugen und konnte das Feld räumen. Wenn ich es nicht zugab, dann …
Diese nette alte Dame hier war eine einmalige Chance. Die Rückkehr an den grünen Tisch, der ohne Limit spielte. Mein Strafprozess. Mein erster, richtiger großer Fisch seit ewigen Zeiten. Was konnte man daraus alles machen! Versuchter Totschlag. Nötigung. Mordversuch. Verstoß gegen das Waffengesetz …
Und da stand sie. Meine Staatsanwältin. Die allein mit ihrem Auftauchen das Zepter samt Ermittlungen an sich gerissen hatte und die sich beides ganz sicher nicht mehr aus der Hand nehmen ließ.
Und gegenüber wuchtete es sich empor aus der Straßenschlucht, das Landgericht. Die oberste Instanz des Rechts, steinerne Burg Justitias, Wehrturm der Gesetze, Arena der größten Prozesse. Wenn ich jetzt nicht zugriff, wäre ich ein Idiot, und Marquardt würde sie sich angeln. Es war Zeit. Höchste Zeit, hier etwas klarzustellen. Meine Visitenkarten ließ man nicht einfach so fallen.
Sie wartete ungeduldig auf meine Antwort, sah mich dabei aber gar nicht richtig an, sondern hielt Ausschau nach Kripo, Spurensicherung und Polizeiwagen, die jede Minute hier eintreffen sollten.
»Sie muss ins Krankenhaus. Auf der Stelle. Sonst stirbt sie Ihnen hier noch weg. Und das wäre doch fatal für Ihren Ruf, nicht wahr?«
Sie drehte sich wieder zu mir um. Ihre azurblauen Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. So attraktiv sie war, so sehr sollte man sich vor diesem Blick in Acht nehmen.
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
Ich wies mit einem kurzen Kopfnicken hin zu den Schaulustigen.
»Niemandem ist etwas passiert. Die Frau ist überwältigt. Und sie braucht Hilfe. Die Lage ist unter Kontrolle. Aber überlegen Sie mal, was die Presse schreibt, wenn eine alte, hilflose Dame vor den Stufen des Gerichts in Handschellen das Zeitliche segnet.«
Sie zog die schmalen, wie Adlerschwingen gebogenen Augenbrauen nach oben.
»Sie wollen mir doch nicht etwa …«
Marquardt kam dazu.
»Alttay ist da«, sagte er, und die Stimmung änderte sich schlagartig.
Salome lächelte. Mit zuckersüßer Stimme bat sie die Vollzugsbeamten, einen Krankenwagen zu rufen und der Dame die Handfesseln abzunehmen. Keine Sekunde zu früh, denn schon blitzte es mehrere Male. Berlins bekanntester Gerichtsreporter tauchte auf und schoss ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten und Persönlichkeitsrechte zwei Dutzend Fotos, bis er endlich von den Beamten zurück auf die Straße gedrängt wurde.
»He!«, rief er. »Artikel drei Absatz drei Berliner Pressegesetz!«
»Artikel vier Absatz drei Punkt zwei, drei und vier«, konterte Salome ungerührt. »Erweiterung vom 1.8.65. Noch Fragen?«
Sie drehte sich weg. Marquardt hingegen stellte sich in Positur und schaute direkt in die Kamera. Ich ging vor der Dame wieder in die Knie.
»Hallo!«, flüsterte ich. »Bleiben Sie bei uns. Gleich kommt ein Krankenwagen.«
»Frau Noack«, hörte ich Alttay rufen, »könnten Sie sich mal eben kurz neben Herrn Marquardt stellen?«
»Nein!«, rief sie. »Sie verlassen sofort das Gelände! Herr Alttay, dies ist ein Tatort. Wir warten auf die Spurensicherung. Und auch wenn es noch keine Absperrung gibt, bitte ich Sie trotzdem um Respekt!«
»Und Sie da?«, rief Alttay. »Wer sind Sie?«
Ich stand auf. Er war ein kräftiger Mann Anfang fünfzig mit schlechtsitzender Kleidung, krausen Haaren und einem von zu viel Arbeit und zu viel Wein in der Mittagspause unnatürlich geröteten Gesicht. Aber seine Augen blickten wach, und in seiner Stimme lag ehrliches Interesse. Alttay war einer, der erst zuhörte und dann schrieb. Anders als viele seiner Kollegen. Der Abendspiegel, für den er arbeitete, war die seriöse Stimme Berlins, gerne zitiert in Pressespiegeln und Politikerkreisen. Zeit also auch, ihn endlich einmal mit mir bekannt zu machen. Ich spürte, dass Salome und Marquardt mich ansahen, aber ich tat ihnen nicht den Gefallen, es zu bemerken. Ich holte tief Luft.
»Ich bin ihr Anwalt.«
Sie hieß Margarethe Altenburg und war einundsiebzig Jahre alt. Sie gehörte zum Bibelkreis der Kirchengemeinde Peter und Paul in Görlitz und befand sich mit vierundvierzig weiteren Schäfchen sowie einem Hirten, Herrn Pfarrer Ludwig, auf einem Busausflug nach Berlin, inklusive Kaffee und Kuchen. Um sechs Uhr dreißig hatten sie die Stadt verlassen, um elf Uhr waren sie am Pariser Platz angekommen. Statt durchs Brandenburger Tor zu gehen und anschließend den Gendarmenmarkt samt Französischem Dom und Wiener Konditorei zu besuchen, hatte Margarethe Altenburg sich ein Taxi genommen und in die Littenstraße fahren lassen. Sie wartete, bis Hellmer das Gerichtsgebäude verließ und feuerte vier Schüsse aus einer Waffe ab, über deren Herkunft sie ebenso eisern schwieg wie über den Grund des Attentats.
»Kannten Sie den Mann?«
Ich saß im Notarztwagen neben der Pritsche und hielt ihre Hand. Margarethe Altenburg schüttelte mühsam den Kopf. Sie sah sterbenselend aus. Der Sanitäter hatte ihr eine Sauerstoffmaske aufgesetzt und eine Spritze gegeben. Beides schien nicht zu helfen.
»Aber warum um Gottes willen haben Sie auf ihn geschossen?«
Sie schloss die Augen und sagte nichts.
Der Sanitäter gab mir ein Zeichen, dass ich den Wagen verlassen sollte. Ich zog die Visitenkarte heraus, die Salome im Fahrstuhl verschmäht hatte, und drückte sie der alten Dame in die Hand.
»Ich bin Tag und Nacht für Sie da. Hören Sie? Ich bin Ihr Anwalt. Ich helfe Ihnen.«
Sie wollte etwas sagen. Ich beugte mich ganz nah herab an ihren schmalen, von unzähligen kleinen Falten umgebenen Mund.
Sie hob die Sauerstoffmaske an und flüsterte: »Ich … ich brauche ein Nachthemd.«
Ratlos stieg ich aus und sah der Ambulanz hinterher.
Die Spurensicherung war eingetroffen und hatte den Bürgersteig mit rot-weißem Plastikband abgesperrt. Beamte in weißen Overalls suchten gerade das Gelände nach Kugeln und Patronenhülsen ab. Die beiden Schupos gaben ihre Beobachtungen zu Protokoll. Salome telefonierte. Die Gaffer gafften.
Ich schlenderte zu der Imbissbude, die dem Geruch nach zu urteilen wieder in Betrieb war. Der Inhaber hatte sich von dem Schrecken erholt und erzählte seiner zahlreichen Kundschaft gerade, was er bzw. was er nicht gesehen hatte. Ich bestellte eine Currywurst und verzog mich damit an den äußersten Rand des Tresens, wo man mich am wenigsten bemerken würde. Doch ich hatte die Rechnung ohne Alttay gemacht.
Der Reporter hatte sich den Anweisungen Salomes gebeugt und den Tatort verlassen. Nun versuchte er ebenso wie ich zusätzliche Informationen aus erster Hand zu bekommen.
»Dolles Ding«, sagte er und stellte sich neben mich. »Sie sind also der Anwalt der Dame. Lesen Sie Ihre Mandanten immer in wehrlosem Zustand von der Straße auf, oder war das der reine Zufall?«
»Der reine Zufall.«
Alttay nickte und nahm eine Portion fettige Pommes entgegen, auf die der Chef der Bude noch zwei Kilo Paprikapulver und mehrere Pfund Mayonnaise gehäuft hatte.
»Und der Mann, auf den sie geschossen hat. Was wissen Sie über den?«
Ich kaute so lange auf einem Stück Currywurst, bis Alltay seufzte und resigniert in seinen Pommes herumstocherte.
»Und Ihren Namen? Wissen Sie noch, wie Sie heißen?«
»Vernau«, antwortete ich.
Ich zog meine letzte Karte heraus und überreichte sie ihm. Nachdem er den Text studiert hatte, sah er hoch und lächelte mich an.
»Ich erinnere mich an Sie. Ist lange her, was?«
Er warf einen Blick auf das Landgericht. Einige Schaulustige der unvermeidlichen Sorte lungerten noch vor dem Eingang herum und spähten zum Tatort. Salome telefonierte, immer noch oder schon wieder, die Spurensicherung sicherte Spuren, und weiter oben hielt gerade ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Zwei Beamte sprangen heraus und näherten sich in hastigen Schritten. Ich erkannte die Kollegen vom Kriminaldauerdienst.
»Unsere Besten.« Alttay deutete mit einem schlappen Pommesstäbchen auf den Einsatzleiter der VB1, der als Erstes Salome Noack seine Aufwartung machte und von ihr mit ebenso viel Aufmerksamkeit bedacht wurde wie ich. Sie drehte ihm den Rücken zu und redete weiter mit ihrem Handy. Vermutlich lauerte am anderen Ende der Verbindung ein Haftrichter, dem sie jetzt erklären musste, dass eine verrückt gewordene ältere Dame aus Görlitz in Berlin Jagd auf Obdachlose machte. Und warum sie nun auf dem Weg ins St.-Hedwigs-Krankenhaus war und nicht in eine gemütliche Einzelzelle.
Alttay wischte sich die Finger mit einer Papierserviette ab, hob seine Kamera und schlenderte wieder zur Absperrung.
Der Imbissbudenbesitzer erzählte seine Version des Tatablaufs bereits zum dritten Mal, und ich konnte ihm endlich zuhören.
»Sie hat da vorne auf ihn gewartet. Und dann kam er raus und hier rüber, und da hat sie ihn was gefragt oder zugerufen, auf jeden Fall dreht er sich um, sieht sie an, und dann hat sie ja auch gleich geschossen. Komisch.«
»Was hat sie ihn denn gefragt? Oder gerufen?«, wollte ich wissen.
»Keine Ahnung. Wollte vielleicht seinen Namen wissen. Damit sie nicht den Falschen erwischt.« Er zuckte mit den Schultern und warf eine weitere Portion tiefgekühlte Pommes in die Fritteuse. »Ich steh seit zwanzig Jahren hier. Da kriegt man viel mit. Wenn sie rauskommen nach den Prozessen und erst mal einen Schnaps trinken müssen, um ein Urteil zu verkraften. Vielleicht hat er ihr ja was angetan und ist freigesprochen worden?«
»Nein«, sagte einer der Gäste.
Er wirkte wie ein Postbote in seiner dunkelblauen Windjacke und stand fröstelnd wie die anderen im eisigen Märzwind. »Der hatte was wegen Diebstahl im Supermarkt. Ich war bei der Verhandlung im Zuschauerraum. Das war nichts Spektakuläres. Ein Obdachloser.«
»Vielleicht hat sie was gegen Obdachlose?«, fragte ein anderer Gast, der sich an einem Fläschchen Magenbitter wärmte.
»Kann sein, kann nicht sein. Drinnen im Gericht war sie jedenfalls nicht.«
Er drehte sich zu mir um, als ob er aus meiner Ecke Widerspruch erwarten würde. Bevor ihm einfallen konnte, dass auch ich einer der Prozessbeteiligten gewesen war, verabschiedete ich mich mit einem hastigen Kopfnicken und zog es vor, um Alttay, Marquardt, die Kripo und Salome einen großen Bogen zu machen. Mein Fisch hing an der Angel. Ich musste nur noch Netz und Kescher besorgen.
Als ich den Hinterhof unserer Kanzlei betrat, unter dem Arm eine Plastiktüte mit einem Nachthemd aus der Damenwäscheabteilung eines Kaufhauses am Alexanderplatz, stand schon wieder einer da. Einer dieser nie frierenden Anzugträger in viel zu dünnen italienischen Schuhen, die in letzter Zeit auffällig unauffällig in und um das Gebäude schnürten. Die Überputz-Stromleitungen aus dem Keller in den zweiten Stock hatten es ihm besonders angetan. Er begutachtete sie genau, notierte etwas auf einem kleinen Block und ging dann an das Kellerfenster, um Verlauf und Montage der illegalen Zapfanlage weiterzuverfolgen.
»Darf ich fragen, was Sie hier zu suchen haben?«
Er zuckte zusammen und richtete sich auf. Da ich immer noch wie ein Anwalt angezogen war, riss er sich am Riemen und versuchte, nicht allzu unfreundlich auszusehen. Er war einen halben Kopf kleiner als ich, ein feingliedriger, glattrasierter, sehr junger Mann ohne weitere Eigenschaften. Er musste sich dieses Mangels durchaus bewusst sein, denn er versuchte, ihn durch die Wahl seiner übertrieben konservativen Kleidung zu korrigieren. Bei seinem Gegenüber sollte wohl der Eindruck entstehen, man habe es nicht mit einer Person, sondern mit einer Persönlichkeit zu tun. Ich ordnete ihn ein unter Nachwuchsimmobilienmakler, freiberuflicher PR-Agent kommunaler Galerien oder Gebäudeversicherungsvertreter.
»Mein Name ist Markus Hartung. Ich arbeite für eine Investorengruppe, die sich für dieses Haus interessiert. Sind Sie Mieter?«
»Ja. Uns gehört die Anwaltskanzlei. Ich kann Sie gerne über das Strafmaß von Hausfriedensbruch aufklären.«
»Eine Kanzlei? Also ein Gewerbemietvertrag? Davon ist uns nichts bekannt. Ist diese Nutzung ordnungsgemäß angemeldet?«
Das wusste ich nicht. Der ganze Kram lief über Marie-Luise.
»So ordnungsgemäß, dass ich Sie jetzt bitten muss, dieses Grundstück zu verlassen, weil ich sonst Anzeige gegen Sie erstatte.«
Er nickte ausgesprochen höflich und sah noch einmal hinauf zu den Stromleitungen, die durch das Fenster einer wirklich netten, chronisch klammen französischen Chansonsängerin in eine kleine Zweizimmerwohnung mit Außenklo führten und in ihrer Küche einen Radiator speisten, weil die asthmatische Heizung es nicht mehr schaffte, den Schimmel aus den Wänden zu treiben.
»Wir werden ja sehen, wer hier wen zur Anzeige bringt. Herr …«
»Da geht’s hinaus.«
Er drehte sich um und verließ den Innenhof. Ich lief die zwei Etagen bis zu unserer »Kanzlei« im Eilschritt und fand Marie-Luise in ihrem Büro, wo sie, in zwei Wehrmachtswolldecken gehüllt, die Loseblattsammlung zum Asylrecht auf den neuesten Stand brachte. Um sie herum türmten sich kleine Gebirge zerknüllter, längst veralteter Papiere. Es war eine jener Aufgaben ohne echte Herausforderung, an die man sich nur machte, wenn sonst absolut nichts mehr zu tun war. Gelangweilt riss sie ein neues Blatt aus dem dicken Ordner, knüllte es zusammen und zielte auf ihr momentanes Lieblingsopferposter: das Pressefoto des Jahres. Es zeigte eine achtjährige Jemenitin und ihren dreißigjährigen Bräutigam. Sie verfehlte den Mann und seufzte abgrundtief, bevor sie sich wieder stirnrunzelnd über weitere Neuerungen im Abschiebegewahrsam beugte.
Ich balancierte um sie herum bis ans Fenster und sah hinunter in den Hof.
»Ich habe eben einen von denen rausgeschmissen.«
Marie-Luise sah hoch und nahm ihre Lesebrille ab. Sie trug sie nie vor Zeugen. Und dass ich sie eines Tages damit erwischt hatte, nahm sie mir bis heute übel. Wenigstens versuchte sie nicht mehr, ihr Gebrechen vor mir zu verstecken.
»Schon wieder?«
Die jungen Herren in ihren eleganten Anzügen waren seit Wochen Gesprächsthema in unseren Treppenhäusern. Sie tauchten unangemeldet auf, taxierten Bausubstanz und Mietrückstände, wussten erstaunlich gut Bescheid über unangemeldete Untermieter und zweckentfremdete Keller, und benahmen sich, als ob das Haus schon ihnen gehören würde. Dabei befand es sich noch immer in den Händen einer weit verzweigten und hoffnungslos zerstrittenen Erbengemeinschaft, was letztendlich dazu geführt hatte, dass niemand mehr auch nur eine Glühbirne in der Waschküche ersetzte und im Gegenzug die Mieten seit zehn Jahren nicht erhöht worden waren. So gab es die stille Übereinkunft, sich bei Mängeln selbst zu helfen und schlafende Hunde keinesfalls zu wecken. Dass diese mittlerweile von Wölfen umzingelt wurden, die sich langsam, aber sicher bis in unseren Innenhof wagten, war kein gutes Zeichen.
Marie-Luise schälte sich aus ihren Decken und kam zu mir. Gemeinsam stierten wir auf ein hässliches Geviert aus unansehnlichen Außenwänden, kleinen, schlecht dichtenden Fenstern, zwei verrostenden Fahrrädern und einer Waschmaschine, in der im letzten Jahr ein Amselpärchen gebrütet hatte und auf dessen Rückkehr wir sehnlichst warteten. In den Rissen des zerborstenen Asphalts blühte im Frühling der Raps. Wenn es denn eines Tages wieder Frühling würde. Und die Amseln zurückkehrten.
Sie rieb sich fröstelnd die Arme.
»Hat er gesagt, von wem er kommt?«
»Nein. Eine Investorengruppe, die sich für das Haus interessiert. Mehr nicht.«
»Investoren. Heuschrecken. Gesichtsloses Rattenpack.«