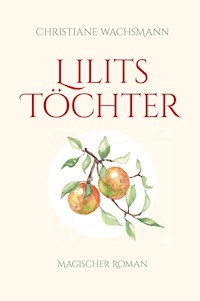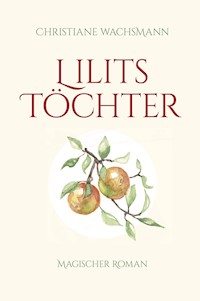
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
August 1862. Im alten Obstgarten vor den Mauern der Kleinstadt Tessen befindet sich eine Pforte zu einer anderen Welt: dem verlorenen Paradies. Hier wohnt die dämonische Lilit, die erste Frau Adams. Unter ihrem Einfluss streben die Frauen der Umgebung nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Sélène Marl, genannt Lele, ist die Tochter des örtlichen Textilfabrikanten. Sie liebt die Beschäftigung mit der Chemie und experimentiert heimlich im Alchemistenturm an der oberen Stadtmauer. Ihre Stiefmutter will dieses seltsame Mädchen endlich verheiraten. Doch Lele hat andere Vorstellungen: Wie ihre Mutter Fanny Rotmund, die in Straßburg erfolgreich Farben für die prosperierende chemische Industrie erfindet, will sie selbständig leben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten in der chemischen Industrie Aufbruchstimmung. Geniale Erfindungen und systematische Versuche, Glückstreffer und unvorhergesehene Explosionen, Konkurrenz und Neid begleiteten die Erfindung immer neuer Farben: Preußischblau und Malachitgrün, Azofuchsin, Chrysamin. Wem würde es als erstes gelingen, die Königin der Farben, das Indigo, synthetisch herzustellen? Als Fanny ihrer Tochter das Rezept für die Herstellung dieser Farbe schickt, taucht Adam Klimmisch, Alchemist, selbst ernannter Magier und Fanny Rotmunds ehemaliger Geliebter, wieder in seiner Heimatstadt auf. Er hat von dem Rezept erfahren und will es an sich bringen. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Lele nicht die fügsame junge Frau ist, die er in ihr sieht, sondern eine ebenbürtige Gegnerin. Detailgenau recherchiert, mit Ironie und Einfühlung, entfaltet Christiane Wachsmann vor unseren Augen die Welt des 19. Jahrhunderts in der deutschen Provinz: Die wissenschaftlichen Errungenschaften, die Geisterseherei und die Suche nach dem Übernatürlichen, die bürgerlichen Konventionen und Einschränkungen – gegen die die Frauen in dieser Geschichte sich durchaus zu wehren wissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
August 1862. Im alten Obstgarten vor den Mauern der deutschen Kleinstadt Tessen befindet sich eine Pforte zu einer anderen Welt: dem verlorenen Paradies. Hier wohnt die dämonische Lilit, die erste Frau Adams. Unter ihrem Einfluss streben die Frauen der Umgebung nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Sélène Marl, genannt Lele, ist die Tochter des örtlichen Textilfabrikanten. Sie liebt die Beschäftigung mit der Chemie und experimentiert heimlich im Alchemistenturm an der oberen Stadtmauer. Ihre Stiefmutter will dieses seltsame Mädchen endlich verheiraten. Doch Lele hat andere Vorstellungen: Wie ihre Mutter Fanny Rotmund, die in Straßburg erfolgreich Farben für die prosperierende chemische Industrie erfindet, will sie selbständig leben.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte in der chemischen Industrie Aufbruchstimmung. Geniale Erfindungen und systematische Versuche, Glückstreffer und unvorhergesehene Explosionen, Konkurrenz und Neid begleiteten die Erfindung immer neuer Farben: Preußischblau und Malachitgrün, Azofuchsin, Chrysamin. Wem würde es als erstes gelingen, die Königin der Farben, das Indigo, synthetisch herzustellen?
Als Fanny ihrer Tochter das Rezept für die Herstellung dieser Farbe schickt, taucht Adam Klimmisch, Alchemist, Magier und Fanny Rotmunds ehemaliger Geliebter, wieder in seiner Heimatstadt auf. Er hat von dem Rezept erfahren und will es an sich bringen. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Lele nicht die fügsame junge Frau ist, die er in ihr sieht, sondern eine ebenbürtige Gegnerin.
Inhalt
Über das Buch
Wind
Scherben
Bibelstunde
Frau im Baum
In der Apotheke
Am Fluss
Kein Brief
Grün und Blau
Alchemie im Turm
Heiratspläne
Nächtlicher Garten
Sonntags im Turm
Poltergeist
Fechtstunde
Fräulein Jette
Séance
Bei Vollmond
Gewitter
In der Scheune
Um die Wette
Das Medaillon
Gold
Dank und Quellen
Über die Autorin
Impressum
Wind
A
n heißen Tagen fegt ein Wind über die Osterberger Höhe. Er schmeckt nach Wüstenstaub, nach Heu und Thymian. In der Luft hängt der Gesang der Zikaden.
Windböen ballen sich und fahren auseinander, zerren an Bäumen und Gräsern. Samen fliegen, Früchte fallen. Morsche Äste brechen und stürzen ins Gras, wo sie liegen bleiben und zerfallen.
Die Luft im Obstgarten ist dicht und schwer und klar. Ein Geruch nach faulenden Äpfeln hängt darin, nach Abfall und chemischen Substanzen, nach Schwefel, Exkrementen. Ein Summen hängt darin wie von Schmeißfliegen und Wespen, eine Sehnsucht und ein Verlangen.
Ein Duft nach Meer. Der Geschmack von Salz und Sand.
Zusammen mit Adam schuf Gott eine Frau und nannte sie Lilit. Er schuf sie aus der gleichen Erde wie Adam. Sofort begannen die beiden zu streiten.
„Ich will nicht unten liegen“, sagte sie, und er sagte: „Ich will nicht unter dir liegen, sondern nur oben. Denn du bist nur dazu geeignet, unten zu liegen, während ich der Obere sein soll.“
Lilit sagte: „Wir sind einander gleich, da wir beide aus der Erde geschaffen wurden.“
Sie wollten einander nicht zuhören. Als Lilit dies erkannte, sprach sie den unaussprechlichen Namen aus und flog in die Lüfte davon ans Meer. Weil sie sich weigerte zurückzukehren, wurde sie zur Dämonin. Sie lauert an den Türen und verführt allein schlafende Männer. Jeden Tag sterben hundert ihrer Dämonenkinder. Sie selbst ist eine Gefahr für schwangere Frauen und Neugeborene.
Lilit ist Frau und ist Schlange. Sie ist die Verführerin Evas im Paradies, ist die Königin von Saba und die Geliebte Salomons. Sie streicht uns über Kopf und Glieder, schlängelt sich in unsere Gefühle, lässt sie stärker werden und unbeherrschbar. Sie prickelt auf der Haut, schmeckt nach reifen Sommeräpfeln, süß und herb, rau und weich. Sie bringt den Moment, bringt das Vergessen, das Begehren des Augenblicks, die Vollständigkeit im Jetzt, im Hier: Die Welten werden eins, das Paradies lässt sich erahnen.
Lilit wohnt in der Sommernacht, wenn der Wind lau ist. Sich zusammenballt zu Böen, in plötzlichen Sommerstürmen voller Lebenskraft und Rücksichtslosigkeit.
Lilit lebt im Paradies, in einer fernen und nahen Welt, in den Träumen und Sehnsüchten der Menschen nach Heilung, nach Ganzheit. In der Nacht sind die Grenzen durchlässiger. Dann ist sie der Alb, der auf der Brust sitzt, das Gefühl grenzenloser, angstmachender Freiheit in den dunklen Stunden des Morgens, vor Sonnenaufgang.
In Nächten wie diesen wachte Lele auf. Sie stellte sich ans Fenster ihrer Dachstube und blickte in den Obstgarten. Seit langer Zeit hatte sich niemand mehr um die Bäume gekümmert. Sie waren struppig geworden und alt. Die Äpfel fielen ins Gras und verrotteten, neue Triebe wuchsen und verkümmerten. Igel raschelten im Gras, Nattern schlängelten über die Ufersteine am Bach. Auf dem Wasser im Kanal glitzerte das Mondlicht.
Der Vater hatte ihn graben lassen, um damit das Wasser-Closett zu betreiben. Seit einigen Monaten stand es in einem eigens dafür errichteten Anbau im Hof. Es diente allein seiner eigenen Bequemlichkeit; kein anderes Haushaltsmitglied durfte dieses Wunderwerk der modernen Technik benutzen. Heimlich aber hatten sie alle schon dort gesessen. In aller Eile und mit klopfendem Herzen verrichteten sie ihr Geschäft, um dann an der Kordel zu ziehen und staunend zu beobachten, wie der Wasserschwall die fein bemalte Porzellanschüssel durchströmte und alles Schmutzige mit sich forttrug.
Der Obstgarten hatte Lele von Anfang an fasziniert und angezogen. Die Bäume, ächzend unter der Last ihres Alters, der Geruch nach Mädesüß und Minze, waren ihr Trost und Zuflucht geworden, als der Vater sie in seine Familie holte. Wenn immer es möglich war, kletterte Lele in einen der Bäume. Sie lauschte dem Flüstern des Windes, der durch das Gras strich und die Blätter bewegte, spürte seine Berührung auf der Haut. Er fuhr ihr über den Nacken, durchwehte lockend und sanft ihr Haar und erinnerte sie daran, dass sie nicht wirklich die Tochter dieses Hauses war, auch wenn die Stiefmutter sie mit aller Gewalt dazu zu machen trachtete. Wenn Lele erstmal verheiratet wäre, sicher untergebracht im Haushalt eines ehrbaren Mannes, wäre das Werk der Odette Marl vollbracht. Dann wäre die Schande getilgt, die Leles leibliche Mutter über die Familie gebracht hatte, das fremde Küken sicher im Hühnergehege untergebracht. Und wäre es nicht für alle das Beste?
Lele blickte in den verwilderten Garten, zu ihrem Lieblingsbaum, in dessen Geäst sie schon manche Mittagsstunde verbracht, sich in ihre eigene Zukunft hineingeträumt hatte. Während sie in der ausladenden Astgabel lag und in den Himmel blickte, war sie als Zirkusprinzessin durch die Lande gezogen, als geschickte Akrobatin, die auf dem Rücken lebendiger Pferde die gleichen Kunststücke vollführte wie auf dem Turnpferd. Mit ihrem Geliebten übernachtete sie in Scheunen, oder sie lagen unter einem südlichen Himmel und schauten in die Sterne. Sie sah sich als Wissenschaftlerin in einem richtigen Labor, eine fähige Assistentin ihrer Mutter Fanny Rotmund, die in Straßburg neue Farben erfand und sie mit nach Paris genommen hatte, als sie noch ein Säugling war. Paris – Was wohl aus mir geworden wäre, dachte Lele. Wenn ich dort hätte bleiben können. In Paris.
Vielleicht würde ich mal hinfahren, mit meinem zukünftigen Ehemann. Falls sich einer findet. Manchmal wünschte ich, es würde sich keiner finden. Und vielleicht, vielleicht, wird das gar nicht nötig sein. Wenn der Brief angekommen ist. Wenn ich eine Antwort erhalte. Ich wünschte, sie würde antworten. Was war das?
Lele beugte sich vor. Die Luft über dem Kanal schien sich zu verdichten, etwas nahm dort Gestalt an. Vom Fenster aus konnte sie nichts Genaues erkennen, nicht viel mehr als einen Schatten. Wehendes Haar und ein wildes Lachen, ein flüchtiges Leuchten über glänzendem Gras, dann Stille.
In der Kammer nebenan regte sich Emilie. Die Glocke der Annenkirche schlug die halbe Stunde. In der Ferne bellte ein Hund. Lele gähnte. Sie blickte hinauf in den fast vollen Mond, der nun auf den westlichen Horizont zustrebte. Sie schlüpfte ins Bett, zurück unter die Decke. Bald schon würde der Morgen grauen. Sie hatte sich mit Hans im Turm verabredet, musste also früh aufstehen. Und vielleicht, vielleicht, würde heute endlich der Brief eintreffen. Der Brief von Fanny Rotmund, ihrer Mutter, auf den sie so sehnsüchtig wartete.
Scherben
L
ele schlüpfte durch die Tür des Alchemistenturms, versteckte den Schlüssel in der Ritze neben dem Holunderbusch und balancierte auf dem Mauerabsatz über den Bach. Durch den Spalt in der Stadtmauer kletterte sie ins Freie und rannte den Stadtgarten entlang zum Turnplatz. Sie hatte nicht viel Zeit, deshalb ließ sie es mit einem Sprung über das Pferd bewenden, balancierte über den Balken, schwang sich auf der anderen Seite des Platzes über den Zaun und stand gleich darauf am Rand der Chaussee.
Die Luft war noch frisch; der Morgennebel stand zwischen den Baumruinen auf der anderen Seite wie ein zarter Schleier, ließ ihre Stämme kulissenhaft hervortreten und die Landschaft dahinter verschwinden.
Rasch überquerte Lele die Chaussee und einen weiteren Zaun, umrundete mit ausgestrecktem Arm ihren Apfelbaum, lief weiter, schlug ein Rad – eins, noch eins, und ein drittes – und erreichte den vertrauten Hof ihres Elternhauses. Befriedigt stellte sie fest, dass sie kaum außer Atem war.
Die Küche war erfüllt vom Duft nach Kaffee und frischen Pflaumen. Emilie stand am Spülstein und schrubbte sich die Hände, während Berthe Lele mit gerunzelter Stirn entgegenblickte. Ehe sie eine Frage stellen konnte, rannte Lele durch die Halle, die Treppen hinauf, und schlüpfte in ihre Kammer. Rasch streifte sie das Turnkleid ab und brachte es zum Lüften auf den Dachboden nebenan. Es roch wirklich nicht angenehm, das musste sie zugeben. Trotzdem war es keine Art, sich über den Gestank darin zu beschweren und würgend davonzulaufen, wie Emilie es mitunter tat.
Zehn Minuten später ging Lele in ihrem dunklen Kleid gemessenen Schrittes die Treppe hinab und öffnete die Tür zum Esszimmer.
„Du warst wieder draußen heute Morgen“, flüsterte Jette Lele zu. „Ich habe dich gesehen. Auf der Wiese.“
Friedrich saß still in seiner Ecke und studierte eine Ausgabe der Annalen. Die Tür öffnete sich, die Frau Mama trat ein. Die beiden Mädchen erhoben sich, während Friedrich nur kurz den Kopf wandte und sich sofort wieder in seine Lektüre vertiefte. Lele warf ihrer jüngeren Schwester einen warnenden Blick zu. Dass sie nur den Mund hielt und nichts erzählte von ihrem morgendlichen Ausflug!
Gleich darauf wurde die Tür erneut aufgerissen, und der kleine Robert stürmte herein. Er war gar nicht mehr so klein, sondern ein ausgewachsener Kerl, was er selbst bisher allerdings noch nicht mitbekommen hatte. Ihm auf dem Fuß folgte Bally, sprang kläffend an Leles Röcken hinauf und begrüßte den Rest der Gesellschaft mit heftigem Schwanzwedeln.
„Robert, bitte“, sagte die Mama.
„Er hat heute schon eine Ratte gefangen“, sagte Robert stolz.
„Dann hat er erst recht nichts hier zu suchen.“
„Mama!“
„Bring ihn raus. Wenn der Papa gleich kommt! Du weißt genau –“
„Papa ist schon gegangen. Bitte, Mama. Bally ist auch brav. Er legt sich neben die Anrichte und schläft. Bally, hier. Komm her. Leg dich. Mach Platz. Bally! Sofort kommst du her! Hierher!“
Natürlich gab der Hund erst Ruhe, nachdem Robert ihn einmal quer durch den Raum gejagt und schließlich beim Genick gepackt und in die Ecke gezerrt hatte. Mit schlagendem Schwanz und einem geöffneten Auge lag er auf seinem Platz und wartete auf die nächstbeste Gelegenheit, aufzuspringen.
Die Frau Mama ließ sich mit einem Seufzer auf ihren Stuhl sinken. Emilie erschien mit dem Kaffee, dicht gefolgt von Rose und Nora, den jüngsten in der Reihe der Geschwister. Bis auf den Vater war die Familie komplett.
Jette beobachtete, wie Lele ein Stück von ihrem Brot in den Kaffee tunkte und in den Mund steckte. Ihre Finger waren schon wieder aufgerissen und dunkel gefärbt. Wahrscheinlich hatte das mit ihren morgendlichen Ausflügen zu tun. Zu ihrem Bedauern hatte Jette bisher nicht herausfinden können, wohin ihre große Schwester in der Frühe verschwand und mit was sie sich beschäftigte. Es war überhaupt noch nicht lange her, dass ihr dieses Verschwinden aufgefallen und sie es in Zusammenhang mit Leles zerschundenen Händen gebracht hatte.
„Sélène“, sagte die Mama streng. „Du weißt genau –“
Lele lächelte freundlich. „Ich mache es nur en famille, Maman. Wirklich!“
Die Mama seufzte und presste die Lippen zusammen. Sie war nie lange streng mit ihren Kindern, aber bei Lele betrug diese Spanne kaum länger als das Blinzeln einer Katze. Das war von Anfang an so gewesen, seit Lele in die Familie gekommen war. Sie hatte immer ihr eigenes Leben geführt, und das nicht mal im Geheimen. Sie tat, was sie wollte! Tunkte das Brot in den Kaffee und balancierte auf der Teppichstange, und wenn sie dafür getadelt wurde, entschuldigte sie sich mit einem ebenso freundlichen wie herablassenden Lächeln. Sie war eine viel bessere Turnerin als Robert und ritt furchtlos seine Stute. Jette wünschte sich nichts sehnlicher als zu sein wie sie. So voller Mut und Lebenslust! Wenn sie doch nur wüsste, wie das ging! Wie nur, wie, konnte sie Lele ihr Geheimnis entlocken?
„Tante Marianne hat geschrieben“, sagte die Mama.
Friedrich blätterte in seinem Journal. Die Seite knisterte, als er sie umschlug. Er hatte das Heft neben seinen Platz gelegt und las mit gerunzelter Stirn.
„Was liest du?", fragte Lele.
„Essigsaures Cyan.“
„Von wem?“
„Schützenberger.“
„Sélène! Davon verstehst du doch nichts!“
„Schützenberger? War das nicht derjenige, welcher die hydroschweflige Säure –“
„Sélène! Friedrich!“
„Genau der“, sagte Friedrich und grinste.
„Du legst jetzt sofort dieses Heft weg“, sagte die Mama. „Wir sind hier am Frühstückstisch. Ich will von solch unappetitlichen Dingen nichts hören! Eure Tante Marianne hat geschrieben. Sie wünscht, dass eines von euch Mädchen im September wieder für ein paar Wochen zu ihr kommt.“
Die plötzliche Stille wurde von Friedrichs Prusten unterbrochen. Jette trat ihm unter dem Tisch gegen sein Bein, so fest sie konnte. Dieser schadenfrohe Kerl! Sollte er doch nach Elberfeld fahren und sich Tante Mariannes Schikanen aussetzen. Aber daran dachte natürlich niemand. Nur, weil er ein Junge war.
„Aua! Spinnst du?“
Kaum hatte Friedrich seine Stimme erhoben, sah Bally seine Stunde gekommen: Er sprang auf und gab seinen kläffenden Kommentar. Aufgeregt hüpfte er hin und her und bewegte den Schwanz dabei wie ein verrückt gewordenes Uhrpendel.
„Still, Bally, sei still. Sitz. Bally! Sitz!“
„Mein Fuß“, schrie Friedrich und boxte Jette in den Arm. „Du weißt doch genau, wie es damit ist!“
„Robert, du bringst auf der Stelle diesen Hund hinaus!“
Robert erhob sich träge. Bally sah sich aufgefordert, seine Begeisterung darüber und über den Lärm im Allgemeinen auszudrücken, indem er mit allen Vieren in die Luft sprang und zwischen Roberts Beinen hindurch in Richtung Tür raste. Robert taumelte, griff nach dem Tischtuch und stürzte, das Tuch samt Kanne, Geschirr und dem Rest des Frühstücks hinter sich her ziehend. Es schepperte gewaltig, dann herrschte Stille.
Das Tuch hing noch halb auf dem Tisch, auch zwei Tassen hatten sich oben gehalten sowie der Brotkorb. Die Kaffeekanne lag am Boden; sie hatte ihre Tülle verloren. Ein brauner Sturzbach ergoss sich aus dem Loch und verbreitete sich auf dem weißen Stoff, wo er schnell aufgesogen wurde. Jettes Marmeladenbrot war kopfüber in die Zuckerdose gestürzt, der Honiglöffel klebte an einem Stuhlbein und bewegte sich langsam auf den Fußboden zu.
„Huch“, sagte Robert und war schon wieder auf den Beinen. Verlegen wischte er sich die Hände an den Hosennähten ab. Bis auf die Mama waren alle aufgesprungen. Zwei Stühle waren umgefallen. Jette blickte sich nach Bally um und fand ihn mit eingekniffenem Schwanz hinter dem Lehnsessel am Fenster.
Rose brach in Tränen aus.
Nora kicherte und schlug sich gleich darauf die Hand vor den Mund.
Lele wandte sich ab, wahrscheinlich musste auch sie lachen. Jette biss sich auf die Lippen. Die Mama saß auf ihrem Stuhl vor der leeren Tischplatte, mit der Kaffeetasse auf halbem Weg zum Mund. Jette beugte sich hastig vor, damit niemand ihr Gesicht sehen konnte. Je verzweifelter sie versuchte, das Lachen zu unterdrücken, umso stärker wurde die Versuchung.
„Ich hole die Kehrschaufel“, brachte sie gerade noch hervor, und stürzte in Richtung Tür.
Mit einem leisen Knall stellte die Mama ihre Kaffeetasse auf der Tischplatte ab. „Robert“, sagte sie. „Das Geschirr. Ich habe es zur Hochzeit bekommen. Die Kaffeekanne, die Zuckerdose, Frühstücksteller zwölf Stück. Tassen und Untertassen. Alles zur Hochzeit. Es waren erst zwei Tassen kaputt und das Sahnekännchen. Und ein Frühstücksteller ist verschwunden. Nach dem Besuch dieser schrecklichen Frau. Und jetzt ist es – alles kaputt!“
Jette riss die Tür auf und lief davon, vorbei an Emilie und Berthe, hinaus auf den Hof. Ein Huhn stob gackernd zur Seite, als sie sich neben der Hintertür an die Wand lehnte. Sie wartete auf das Lachen. Endlich konnte sie ihm freien Lauf lassen! Sie wartete und wartete, aber es kam nichts.
Von drinnen hörte sie die Stimmen der anderen, hörte Schritte, hörte Türen gehen. Dabei hat Lele auch lachen müssen, dachte Jette erbost. Ich habe es genau gesehen. Aber sie wusste sich schneller wieder zu fangen. Sie weiß eben, wie es geht! Plötzlich fühlte sie sich den Tränen nahe. Sie würde nie so sein wie ihre große Schwester, nie. Sie hatte die schmalen Lippen ihrer Mutter und dieses Schielauge. Sie war weder so hübsch noch so klug wie Lele. Und außerdem hatte sie sich an der Hand verletzt.
Jette starrte auf das Blut, das aus dem winzigen Schnitt auf ihrer Handfläche quoll, und die Tränen traten ihr endgültig in die Augen. Wie albern, über das Missgeschick der anderen zu lachen. Wie dumm, sich hier zu verstecken. Ob jemand was davon mitbekommen hatte? Leise schlich sie zurück in den Küchenflur. Sie hörte Stimmen aus dem Esszimmer und Geschirrklappern. In der Halle tickte die große Standuhr, als sei nichts gewesen. Langsam ging Jette zurück. An der Esszimmertür blieb sie stehen. Die Mama war verschwunden, nur ihre Tasse stand noch auf der blanken Tischplatte. Lele und Emilie waren damit beschäftigt, die Scherben zusammenzuräumen. Sonst war niemand mehr zu sehen. Jette dachte kurz daran, den beiden zu helfen. Von oben hörte sie die Stimmen von Rose und Nora, von draußen Ballys Gebell. Niemand hatte bemerkt, dass sie verschwunden war. Niemand schien ihrer Hilfe zu bedürfen. Und der Schnitt in ihrer Hand war so klein, dass er bereits wieder zu bluten aufgehört hatte. Rasch lief sie die Treppe hinauf ins Kinderzimmer, warf sich auf ihr Bett und vergrub den Kopf unter ihrem Kissen.
Lele wrang den Lappen über dem Küchenbecken aus.
„Passen Sie auf“, sagte Berthe. „Es könnten noch Scherben darin sein.“
Emilie saß auf einem der Küchenstühle und war schon wieder erschöpft. Ihre hübsche Dienstmädchenuniform hatte Flecken bekommen. Ich sollte sie öfter mal mit in den Garten nehmen, dachte Lele. Den ganzen Tag hier im Haus und in der Küche, das ist doch nichts. Ob ihr das gefallen würde? Ich muss ihr ja nicht gerade die Brennnesseljauche unter die empfindliche Nase halten. Oder den Pferdemist.
„Ich habe sie wieder gesehen“, sagte Emilie. „Sie stand zwischen den Vorhängen und hat zugeschaut.“
Berthe seufzte.
„Ganz durchsichtig“, sagte Emilie mit zitternder Stimme. „Stand einfach da.“
Berthe schnaubte.
„Ganz deutlich habe ich sie gesehen. Eine alte Frau in einem schwarzen Kleid.“
„Jaja“, sagte Berthe. „Wahrscheinlich war sie es, die am Tischtuch gezogen hat. Wahrscheinlich haben wir hier auch einen Poltergeist, wie die da drüben in Amerika. Klopft gegen die Wand und verdreht die Bilder.“
„Wahrscheinlich ist es wegen der Mühle“, sagte Emilie mit gesenkter Stimme. „Wo die doch jetzt abgerissen werden soll.“ Ihre Wangen hatten wieder etwas Farbe angenommen.
„Wahrscheinlich ist es wegen deiner Einbildungskraft“, sagte Berthe. „Und wahrscheinlich solltest du dich mal an die Arbeit machen und die Möhren schälen, sonst gibt es wahrscheinlich kein Mittagessen. Und die junge Dame hier geht jetzt mal in ihr Zimmer und richtet sich die Haare. Der Herr Pastor kommt gleich, und da wollen wir doch keinen schlechten Eindruck machen.“
Nachdenklich ging Lele zurück in die Halle. Sie warf einen Blick in die Schale, doch die war noch leer. Meist kam der Postbote gegen halb zehn; es war also noch zu früh.
Sie setzte den Fuß auf die erste Stufe, überlegte – und stieg dann rasch hinauf zum Dachboden. Auch sie hatte die Frau gesehen, genau, wie Emilie sie beschrieben hatte, in der Ecke neben dem Fenster. Nur trug sie kein schwarzes, sondern ein tiefblaues Kleid, und wirkte keineswegs besonders alt. Wurde sie jetzt genauso verrückt wie Emilie? Oder gab es eine vernünftige Erklärung?
Lele erreichte das obere Treppenpodest und gleich darauf ihre Kammer. Sie löste ihr Haar, bürstete es durch und schlang es erneut zu einem Knoten. Man müsste es genauer wissen, dachte sie. Wann sie kommt und geht. Wer sie sehen kann. Vielleicht kommt sie tatsächlich aus der Mühle?
Die Kutsche rumpelte die Chaussee entlang und fuhr durch ein besonders tiefes Schlagloch. Die Federung quietschte. Insassen und Kutscher wurden in die Luft geschleudert und landeten unsanft auf ihren Hinterteilen. Adam Alexander Klimmisch verfluchte zum wiederholten Mal die Umstände, die ihn zu dieser vorsintflutlichen Art zu reisen zwangen. Würde sich das jemals ändern? Zwar hieß es, die Eisenbahn werde innerhalb der nächsten Jahre auch in seine Heimatstadt kommen, doch war das noch keineswegs ausgemacht. Viel zu viele Leute glaubten, dabei mitreden zu müssen, weil die Strecken über ihr Gebiet gingen oder sie ihre Interessen anderweitig bedroht sahen. Diese deutsche Kleinstaaterei war zu idiotisch! Da hatten die Franzosen es deutlich besser heraus. Immerhin war er diesmal mit der Ludwigsbahn bis nach Blassemünde gekommen, was ein deutlicher Fortschritt war. Der aber durch die zahlreichen Schlaglöcher auf dieser verdammten Chaussee wieder zunichte gemacht wurde. Schlingernd fuhr die Kutsche um eine Kurve und nahm dabei eine weitere Unebenheit in der Straße mit. Adam hielt sich die Seite. Er wünschte, sein Frühstück wäre etwas weniger reichlich ausgefallen. Die Eier und die dicke Scheibe Saumagen bildeten zusammen mit dem Wein und der Magensäure eine zähe Suppe, die in seinem Inneren herumschwappte. Die Luft im Wageninneren war unerträglich abgestanden, und die ausladende Frau auf der Bank neben ihm machte es für ihn immer wieder nötig, die Ellenbogen einzusetzen. Ein Herr in seinem Alter! Adam biss die Zähne zusammen. Er dachte an Nicolas, seinen neuen Kammerdiener. Fast beneidete er ihn um seinen Platz oben auf dem Kutschendach. Dort war es wenigstens luftig. Doch vergangene Erfahrungen hatten Adam gelehrt, diesen Aspekt nicht allzu wichtig zu nehmen: Auf dem Dach waren die Bewegungen der Kutsche wesentlich deutlicher zu spüren. Man musste sich gut festhalten und sich davor hüten, einzunicken, wollte man sich nicht unversehens mit gebrochenem Hals im Staub der Chaussee wiederfinden. Nicolas war noch ein halbes Kind und in seinem Beruf gänzlich unerfahren. Mehr konnte sich Adam zurzeit nicht leisten. Und selbst bei diesem Burschen war es zweifelhaft, ob er bleiben würde, wenn er dann und wann auf den versprochenen Lohn warten musste.
Es war zu verzwickt, dass er Fanny nicht erreicht hatte. Sie hätte ihm sicherlich aus dieser idiotischen Situation heraushelfen können. Mit Geld konnte man vieles lösen – wenn man welches hatte. So wie es im Augenblick stand, war Adam nicht nur gezwungen, seine Reise auf diese unangemessene Art fortzusetzen, sondern musste sich in den nächsten Tagen auch noch mit der ebenso engherzigen wie engstirnigen Verwandtschaft herumschlagen. Er war einfach nicht dazu geboren, sich von allein aufs Materielle ausgerichteten Leuten durchs Leben schubsen zu lassen!
Das größte Problem war seine Mutter. Sie schien es darauf angelegt zu haben, ewig zu leben. Zwar hatte er sie seit Jahren nicht gesehen, doch ihre Briefe klangen noch immer energisch und frisch. Wenn er sie nur endlich beerben könnte! Wenigstens konnte er sich darauf verlassen, dass sie das Geld zusammenhielt. Doch was nützte das, wenn er nicht drankam?
Genauso wenig, wie er an Fanny herangekommen war. Nach allem, was er für sie getan hatte! Man sollte meinen, sie habe ihn empfangen oder ihm wenigstens eine Note zukommen lassen können. Selbst wenn sie krank war, wie Cléophée Flachslandt behauptete, die alte Hexe. Selbst unter derart widrigen Umständen hätte Fanny sich zusammenreißen können. Er brauchte ja nicht viel, nur einen kleinen Kredit. Warum waren die Leute immer so ungefällig? Die Flachslandt war eine der schlimmsten. Völlig unempfindlich gegenüber seinem Charme und jeglichen Mitteln der Überzeugungskraft. Man konnte sich die Zähne an ihr ausbeißen. Auch Fanny war schon beim letzten Mal außerordentlich zugeknöpft gewesen. Doch das war Jahre her. Was war nur aus ihr geworden, dass sie sich vor ihrem alten Freund und Weggefährten verleugnen ließ? Und was mochte an dem Gerücht dran sein, sie habe einen Weg gefunden, das künstliche Indigo herzustellen? Wenn ihr das gelungen war, war sie eine gemachte Frau.
Die Kutsche verlangsamte ihre Fahrt. Der Postillon machte ausführlich von seinem Horn Gebrauch, schließlich hielten sie an. In die Passagiere kam Bewegung. Auch Adam stieg aus, um sich die Beine zu vertreten, und Nicolas kletterte aus seiner luftigen Höhe herab, sobald die Leiter angelegt war.
„Est-ce que nous sommes arrivés?", erkundigte er sich hoffnungsvoll.
Adam schüttelte den Kopf. Vor ihnen lag noch die Osterberger Höhe. Wenn sie Pech hatten, würden sie aussteigen und das Stück vor Ramslohe laufen müssen, weil die Postpferde sonst den Berg nicht heraufkamen. Adam konnte nur hoffen, dass in Tessen niemand sehen würde, wie er aus diesem jämmerlichen Gefährt stieg. Doch das war unwahrscheinlich: In einer Kleinstadt gab es immer jemanden, der nach Neuigkeiten Ausschau hielt, und danach verbreiteten sie sich wie Wasser aus einer geborstenen Leitung. Wenigstens konnte er standesgemäß im Elephanten absteigen. Der Wirt dort würde es kaum wagen, seine Kreditwürdigkeit anzuzweifeln. Und Adam würde schon eine Erklärung dafür einfallen, warum er mit kleinem Gepäck und in der Postkutsche anreiste.
Nach einer Pause quetschten sich die Fahrgäste wieder ins Kutscheninnere. Zu Adams Leidwesen gehörte auch die dicke Frau dazu. Als er einstieg, besetzte sie mit ihrer Leibesfülle bereits fast die gesamte Bank in Fahrtrichtung, und roch nun auch noch nach Zwiebeln. Adam unterdrückte seine Übelkeit und machte sich neben ihr so breit wie möglich. Er hatte während der Unterbrechung nichts weiter zu sich genommen als ein Glas Wein. Nun hoffte er, damit unbeschadet das letzte Wegstück bewältigen zu können.
Diese Mumiensache in Paris war wirklich zu ärgerlich. Sie hatte seine Reputation beschädigt und würde es ihm schwer machen, an seine früheren Erfolge anzuknöpfen. Selbst, wenn es ihm gelang, das Finanzielle zu regeln. Ägypten, dachte er, während seine Finger zu dem Schieferamulett mit dem heiligen Ibisvogel tasteten, das er um seinen Hals trug. Wahrscheinlich ist es ein Fingerzeig des Schicksals. Wenn ich das hier geregelt habe, werde ich nach Ägypten reisen, zu den Pyramiden und den Quellen der Magie, und werde verwandelt zurückkehren.
Bibelstunde
A
uf seinem Weg hinauf zur Villa des Fabrikanten Marl ließ Pastor Lepsius sich Zeit. Zwar hatte die Glocke der Annenkirche bereits die volle Stunde geschlagen, doch konnte er sich nicht zur Eile entschließen. Gemessenen Schrittes durchquerte er das Obere Tor und wandte sich dem Anwesen zu seiner Rechten zu.
Schließlich muss ich meine Würde bewahren, dachte er, und schob damit all die Gründe zur Seite, die ihn davon abhielten, der anstehenden Zusammenkunft anders als freudig entgegenzueilen. Natürlich würde es angenehm sein, wenn Emilie ihm die Tür öffnete und in der dämmrigen, nach Bohnerwachs und Blumen duftenden Halle aus dem Mantel half. Wobei – es hatte auch dafür schon bessere Zeiten gegeben. Vorsichtig tastete sich Pastor Lepsius in seinem Kopf an dem Thema Emilie vorbei und konzentrierte sich auf die anstehende Bibelstunde. Er hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, dieses bewusste Thema einmal zu behandeln. Seine Überlegungen einem ebenso geeigneten wie geneigten Publikum darzutun. Nur hatte sich bisher nie jemand gefunden. In einer Gemeindepredigt war es undenkbar, darüber zu sprechen, und vor der Fabrikantenwitwe Klimmisch und ihren Damen fürchtete er sich viel zu sehr, um sich in irgendeiner Weise zu exponieren. Wenn er nur nicht hier in der Provinz festhinge, ohne einen Gesprächspartner, der ihm ebenbürtig war! Was nützte das ausführliche Studium, was nützten seine umfassenden Kenntnisse des Altgriechischen, des Hebräischen und des Latein, was nützte ihm der Aufwand, den er getrieben hatte, um die alten Texte im Original zu studieren, wenn er mit seinen Gedanken dazu alleine in seiner Studierstube saß?
Hier in diesem Städtchen war man allzu sehr mit den profanen Dingen des Lebens beschäftigt, mit Hochzeiten, Taufen und Todesfällen, mit den Leuten, die von ihm Zusprache und Anerkennung verlangten, und allzu selten mal einen geistlichen Rat. Den sie dann – wenn überhaupt – nur widerstrebend annahmen und auf ihre eigene Art auslegten.
Die Fabrikantenwitwe Klimmisch war die Allerschlimmste. Pastor Lepsius hatte sie und ihre Freundinnen von seinem Vorgänger übernommen, und es verging keine der Bibelstunden in ihrem Hause ohne den mehr oder weniger offen ausgesprochenen Verweis, dass Pastor Böhne kompetenter, einfühlsamer, klüger gewesen sei. Nur hatte der sich mittlerweile entschieden, in den Missionarsdienst nach Afrika zu gehen. Wenn die Damen so weitermachen, dachte Pastor Lepsius erbost, werde ich auch irgendwann anfangen, darüber nachzudenken. Fragt sie mich doch tatsächlich, ob sie dem Böhne ihr Vermögen hinterlassen soll! Sie will meine Meinung doch gar nicht wissen! Sagt das nur, um mir zu zeigen, wie viel sie von ihm hält und wie wenig von mir. Pastor Lepsius spürte, wie sein Herz zu klopfen begonnen hatte. Er blieb stehen. Diese Weiber regten ihn wirklich auf. Immer wussten sie alles besser! Wozu brauchten sie ihn überhaupt, wenn sie die Heilige Schrift selbst so gut auszulegen vermochten? Es hätte ihn schon gereizt, gerade dieses eine Thema, das er schon so lange mit sich herumtrug, mit ihnen zu besprechen. Aber darauf konnten sie lange warten. Er wollte ihnen ja nicht noch Wasser auf ihre Mühlen geben!
Pastor Lepsius atmete tief durch und ging weiter. Sie hatten seine Weisheiten nicht verdient. Deshalb suchte er nun dieses Haus auf, mit seinen freundlicheren Bewohnern. Niemand war sanfter und ausgeglichener als die Frau Fabrikdirektor Marl. Und ihre älteste Tochter – ein so reizendes Mädchen, mit einem scharfen Verstand und einem jungen Geist, der durchaus noch formbar war. So sollte eine Frau sein, dachte Pastor Lepsius. Zurückhaltend, klug und tugendsam, voller Achtung für die Herren der Schöpfung. Er hatte den Vorplatz erreicht. Einen Augenblick verharrte er, musterte die ebenso bescheidene wie geschmackvolle Fassade des Hauses, das er zu betreten im Begriffe war, und betätigte die Türglocke.
Lele beugte sich über das Geländer und beobachtete, wie Berthe die Halle durchquerte und die Tür öffnete. Der Pastor hatte sich glücklicherweise verspätet. So hatten sie nach dem häuslichen Unglück heute Morgen Zeit gehabt, sich alle wieder zu beruhigen. Und die Post war noch immer nicht da.
Lele straffte die Schultern und ging gemessenen Schrittes die Treppe hinab. Insgeheim fand sie den Pastor ungeheuer komisch, mit seiner aufgeblasenen Figur und Haltung. Wie leicht man ihn aus der Fassung bringen konnte! Und er merkte es nicht mal: Sein Verstand arbeitete langsam und mahlend wie ein Pferdegöpel. Wenn es darauf ankam, traute er seinen eigenen Überlegungen nicht. Anfangs hatte Lele die Bibelstunden der Frau Mama sterbenslangweilig gefunden, doch seit einiger Zeit waren sie ihr zu einem Spiel geworden, an dem auch Friedrich und Jette ihren Spaß hatten.
Sie grüßte den Pastor, schüttelte seine Hand ab, die sich unversehens auf ihren Arm gelegt hatte, wechselte ein paar Worte mit ihm, über das herrliche Sommerwetter, bevor sie sich zu den anderen in den Salon begab und, ausgerüstet mit Nadel und Stickrahmen, in einer Sofaecke niederließ.
Die Frau Mama hatte sich wieder gefangen. Nur eine leichte Rötung ihrer Augen zeugte noch von ihrem Unglück. Letztlich waren zwei Tassen und ein Teller sowie die Zuckerdose zersprungen, doch hatte sie vor allem der Verlust der Kaffeekanne betroffen gemacht. Robert hatte die Gelegenheit benutzt, sich mit seinem Köter zu trollen. Er war immer froh, eine Ausrede zu haben, um nicht mit dem Rest der Familie und dem Pastor im Salon verbringen zu müssen. Hoffentlich würde er es nicht zur Gewohnheit machen, aus diesem Grund das kostbare Porzellan zu zerschlagen!
Die anderen Geschwister hatten sich im Raum verteilt, und Emilie saß, noch immer blass um die Nase, auf ihrem Stuhl gleich neben der Tür.
„Mein Mann lässt sich entschuldigen“, sagte die Frau Mama, wie jedes Mal. „Er ist sehr beschäftigt.“ Pastor Lepsius lächelte unbestimmt und ließ sich auf seinem Platz auf dem stabilsten der Rokoko-Sesselchen nieder, gleich neben dem Tischchen mit den geschwungenen Beinen, das unter der großen Familienbibel fast zusammenbrach. Die Frau Mama liebte diese Art von Einrichtung; den üppig mit Stuck verzierten Kamin, die dekorierten Tapeten, den prächtigen Kronleuchter, die schweren Vorhänge mit ihren Troddeln, Zierbändern und Posamenten. Heimlich schaute Lele nach der Frau im blauen Kleid; es wäre zu schön, wenn sie sich in Gegenwart des Pastors zeigte. Zwar konnte er sie wahrscheinlich nicht sehen, aber Emilie war eine zuverlässige Gradmesserin für das Übersinnliche und würde sich sicherlich nicht scheuen, aufzuschreien oder vielleicht sogar von ihrem Stuhl zu fallen.
Berthe kam als Letzte herein, schloss die Tür hinter sich und setzte sich mit ergeben gefalteten Händen auf den Stuhl neben Emilie. Die Fensterläden waren geschlossen. Das helle Sommerlicht fiel in matten Streifen auf den rot-weiß-golden gemusterten Teppich. Pastor Lepsius schloss die Augen und legte die Fingerspitzen aneinander. Lele warf einen Blick hinüber zu Jette, doch die blickte nur mürrisch vor sich hin und schien für heute ihre Lachlust verloren zu haben.
Pastor Lepsius räusperte sich. „Ich will heute“, sagte er, „mit euch, meinen lieben Brüdern und Schwestern, eine Bibelstelle besprechen, die mir ganz besonders am Herzen liegt.“
Endlich hatten sie die Osterberger Höhe erreicht. Alle Passagiere waren wieder eingestiegen, und nun ging es durch Wald und Felder in Richtung Tessen. Einmal noch versuchte Adams Nachbarin, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen, was er aber durch ein herablassendes Nicken und damit einhergehendes Schweigen erstickt hatte. An seiner Stelle zeichnete sie schließlich dem Sitznachbarn schräg gegenüber, einem subalternen und schlecht gekleideten Verwaltungsbeamten, ein Bild ihrer weitverzweigten Verwandtschaft und erwähnte dabei mehrmals den Neffen ihres angeheirateten Vetters, der eine hohe Position am nassauischen Hofe bekleidete. Adam blieb nichts anderes übrig, als sich angewidert der Betrachtung der Landschaft zu widmen, die im Tempo einer ausgedörrten Schnecke vor dem Kutschenfenster entlangkroch. Kurz vor dem Oberen Tor passierten sie die verfallene Mühle und gleich darauf den Obstgarten. Adam hatte, ohne weiter auf die Umgebung zu achten, seinen Gedanken nachgehangen. Nun schwappte der träge Duft von Kamille und Mädesüß durch das geöffnete Fenster über ihn hinweg, brachte ihm Bilder von gleißendem Wind, von Kirschgeschwistern und Bachgeplätscher und mit ihnen das altbekannte Gefühl, nicht Herr über seine Sinne zu sein. Sein Herz weitete sich und zog sich zusammen. War es denn möglich? Würde der Spuk denn nie ein Ende nehmen? Diese Bäume gehörten längst gefällt!
Gleich darauf erreichten sie das Tor und Adam hatte sich wieder gefangen. Er reckte die Schultern und atmete durch. Zwar fühlte sein Mund sich an wie mit Pelz ausgeschlagen, war sein Hals trocken wie ein löchriger Eimer. Dennoch sagte er sich, es sei nichts gewesen. Eine Erinnerung, nichts weiter. Eine missliche Situation aus der Vergangenheit, die längst überwunden war. Er musste sich deshalb nicht sorgen. Fanny war weit fort in Straßburg, und er selbst durch mancherlei Erfahrungen gegangen, die es ihm erlaubten, sich vor dieser Art von Zauber zu schützen.
Es würde nicht wieder geschehen.
Die Kutsche rumpelte mit angezogenen Bremsen die Klostergasse hinunter, rollte den Annenmarkt hinab und kam gleich darauf auf dem Posthof zum Stehen. Pikiert stellte Adam fest, dass die Reise seiner aufdringlichen Sitznachbarin ebenfalls hier endete. Dennoch war es eine Erlösung, endlich aus der Kutsche steigen zu können. Er nickte Nicolas zu. Der griff nach den beiden Koffern und dem Zauberkasten, den Resten von Adams weltlichen Besitztümern, und machte sich auf den Weg zum Elephanten.
Dort empfing ihn der Wirt mit den erwarteten Bedenken, ließ sich aber schließlich überreden, Adam das große Zimmer zum Hof hin zu überlassen. Standhaft, den Blick fest auf Nicolas’ zerzauste Erscheinung und die beiden heruntergekommenen Koffer gerichtet, behauptete er, das Eckzimmer mit Blick über den Annenmarkt sei bereits belegt. Was nachvollziehbar sein mochte, da er Adam zu besseren Zeiten schon in einer eigenen vierspännigen Kutsche hatte vorfahren sehen, allerdings von der gleichen Engherzigkeit und dem Mangel an Vertrauen zeugte, mit der auch andere Leute ihm in Momenten seines Lebens begegneten, in denen es ihm am nötigen Kleingeld mangelte.
Seufzend ergab sich Adam in sein Schicksal. Er wies Nicolas an, seine wenigen Habseligkeiten auszupacken und sich dann auf die Suche nach einem Schneider zu machen, der ihm den Riss in seiner grauen Hose flicken konnte. Er selbst ließ sich, erschöpft vom frühen Aufstehen und den Anstrengungen der Fahrt, aufs Bett sinken und schloss die Augen.
Pastor Lepsius fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er hatte lange auf diesen Moment hin gearbeitet, sich in jeder erdenklichen Weise und absolut ausreichend vorbereitet. Dennoch war er einigermaßen aufgeregt, als er die eng beschriebenen Blätter zur Hand nahm, die er vorbereitet hatte.
„Wir behandeln heute“, sagte er, „behandeln – eine Stelle beim Propheten Jesaia. Genauer gesagt, seine, äh, geht es um seine – kleine Apokalypse.“ Er fuhr sich erneut mit der Zunge über die Lippen. „Eine Stelle, die mich von jeher beschäftigt hat. In ihrer Sprachkraft. In der Gewalt ihrer Aussage. Ja.“
Seine Kehle war ausgedörrt. Er traute sich aber nicht, um ein Glas Wasser zu bitten: Wenn es ihm jetzt nicht gelang, die Spannung zu halten, würde ihn schon bald der Mut verlassen. Und dann wäre der große Moment vorbei. Wie durch einen Nebel schweifte sein Blick durch den Raum, in dem sein geneigtes Publikum saß: Die beiden Dienstboten neben der Tür, die Dame des Hauses in ihrem eleganten Kleid in elegischer Pose, samt ihrem halbwüchsigen Sohn und den Töchtern. Fräulein Sélène saß aufrecht, das Stickzeug in der Hand. Ein gütiges Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Der Herr des Hauses und sein ältester Sohn fehlten, was Pastor Lepsius in gewisser Weise bedauerte, aber auch erleichterte. Nicht, dass der jüngere Herr Robert jemals etwas Nennenswertes zu diesen Gesprächen beigetragen hätte. Aber der Herr des Hauses hätte sich doch zumindest das ein oder andere Mal blicken lassen und damit seine Wertschätzung zeigen können.
Nun, dachte Pastor Lepsius. Wenn ich in der heutigen Stunde erst einmal Zeugnis über meine Belesenheit und die hohe Kenntnis der alten Sprachen abgelegt haben werde, werden sich weitere Interessenten finden. Dies ist ja erst ein Anfang.
Er atmete tief und hoffte, dass seine Stimme im Lauf der Zeit etwas fester werden würde. „Es ist Ihnen ja bekannt“, sagte er, „vielleicht bekannt, dass die – äh – die Bibel von dem großen Martin Luther nicht einfach so aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt wurde. Es gab zuvor andere Fassungen, die Septuaginta und die Vulgata, in griechischer und lateinischer Sprache. Griechisch und Latein“, wiederholte er. „Und von verschiedenen gelehrten Männern gibt es verschiedene weitere Übersetzungen. Und natürlich Kommentare. Luthers Sprache ist ja inzwischen recht altertümlich –“
Er runzelte die Stirn. Das war nicht das, was er eigentlich sagen wollte. Wenn er so weiter machte, würde er noch den Faden verlieren. Das durfte ihm nicht passieren. Dies hier war schließlich keine Prüfung. Dies war, in einem wohlwollenden Kreis, ein geneigtes Publikum. Er blickte hinüber zu Fräulein Sélène. Sie saß anmutig über den Stickrahmen gebeugt, hob aber gerade jetzt den Blick, um ihn mit ihren klugen Augen zu mustern.
„Diese Stelle“, sagte Pastor Lepsius, und merkte, wie er sicherer wurde. „Diese Stelle, von der ich heute reden will, bezieht sich auf das Gericht des Herrn über Edom, einem heidnischen Volk, das sich gegen Israel wandte. Zur Strafe vernichtete es der Herr und verwandelte das Land der Edomiten in eine Wüstenei. Ich selbst habe mir die Mühe gemacht –“ Er griff fester nach seinen Blättern. „Es ist bei Luther und auch in der Septuaginta nicht ganz wortgetreu übersetzt. Luther spricht von einem Kobold, während die Septuaginta und in ihrer Folge auch die Vulgata – Aber hören Sie selbst. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Text selbst aus dem Hebräischen zu übersetzen. Ich werde ihn nun vortragen.“
Er räusperte sich ein weiteres Mal und begann: „Denn es ist der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Dann werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel, und sein Land wird zu brennendem Pech werden, das weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern ewiglich wird Rauch von ihm aufgehen. Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht, dass niemand hindurchgehen wird in Ewigkeit, sondern Rohrdommeln und Igel werden’s in Besitz nehmen, Nachteulen und Raben werden daselbst wohnen. In den Palästen werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren Schlössern, und es wird eine Behausung sein für die Drachen und eine Stätte für die Strauße. Da werden Marder und Geier einander treffen, und ein Feldteufel wird dem anderen begegnen. Lilit wird auch dort herbergen und ihre Ruhe dort finden. Der Igel wird dortselbst nisten und legen, brüten und aushecken in seinem Schatten. Auch die Raubvögel werden dort zusammenkommen.“
Mit einem Aufseufzen ließ Pastor Lepsius seine Blätter sinken. Er hatte es gewagt, und es war geschehen. Es war ihm gelungen, Lilit ins Spiel zu bringen. Er hatte ihren Namen ausgesprochen! Ab jetzt würde alles einfacher sein. Er konnte fortfahren, konnte sein Wissen um diese geheimnisvolle Gestalt weitergeben und die Gefahr, die von ihr ausging. Die kleine Gesellschaft hier war vielleicht nicht ganz das Publikum, das er sich hätte wünschen können: Die Köchin war auf ihrem Stuhl eingenickt, der junge Herr Marl las ganz ungeniert in einem Magazin, und die jüngeren Mädchen stichelten an den Monogrammen herum, die sie für den Fall ihrer Verheiratung an kleineren und größeren Wäschestücken anbrachten. Die Hausherrin selbst hatte gar ihr Strickzeug hervorgeholt und war, wie sich unschwer an ihren Lippen ablesen ließ, dabei, Maschen zu zählen. Einzig das älteste Fräulein Marl hatte ihre Handarbeit sinken lassen und schenkte Pastor Lepsius einen ihrer wohlmeinenden, wachen Blicke.
„Lilit?", fragte sie. „Wer soll das sein?“
Pastor Lepsius nickte ihr anerkennend zu. Sie hatte natürlich sofort den Sinn seiner Ausführungen erkannt. „Luther spricht von einem Kobold“, wiederholte er. „Und die Vulgata identifiziert sie mit Lamia, einer griechischen Göttin. In Wahrheit aber ist sie die erste Frau Adams.“
Er machte eine kurze Pause, wartete auf eine Frage, einen Ausruf, die aber unterblieben. Wieder nervös geworden, fuhr er fort: „Es gibt in der Bibel bekanntlich zwei unterschiedliche Stellen, die von der Erschaffung von Mann und Frau berichten: In Genesis eins, dort heißt es: ‚Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.’ Und gleich darauf, in Genesis zwei, steht geschrieben: ‚Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu.’ Und nun entsteht natürlich die Frage: Wie kann das sein? Warum schuf Gott zwei Frauen für Adam? Und wohin ist die erste verschwunden? Viele Gelehrte haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Einer von ihnen, Ben Sira, hat in seinem Alphabet die Geschichte erzählt. Ich bin bis nach Budapest gereist, um sie im hebräischen Original studieren zu dürfen.“
Pastor Lepsius schaute sich um. Befriedigt stellte er fest, dass es ihm tatsächlich gelungen war, die Aufmerksamkeit seines Publikums zu fesseln. Selbst der junge Herr Marl hatte seine Zeitschrift sinken lassen und blickte zu ihm herüber, und die Köchin war aus ihrem Dämmerschlaf erwacht. In ihren Augen stand fast so was wie eine Art Entsetzen. Frau Marl selbst blickte ihn schweigend an, mit einer Starrheit, die ein gewisses Unbehagen in Pastor Lepsius wachrief. Er wollte sich jetzt aber nicht aus dem Konzept bringen lassen.
„Die erste Frau Adams war eben jene Lilit, von der in Jesaia 34 die Rede ist. Sie war nicht – äh. Sie haben sich gestritten, und dann sprach sie den unaussprechlichen Namen aus und –“
Er sah, wie Frau Marl sich aufrichtete; ihr Blick war jetzt nicht nur mehr starr, er war geradezu drohend.
„– flog davon“, ergänzte Pastor Lepsius flüsternd. „Äh.“
Er biss sich auf die Lippen. Mit einem Mal dämmerte ihm, dass der Rahmen für seinen heutigen Vortrag doch nicht so glücklich gewählt war, wie er sich das zunächst vorgestellt hatte. Eine ehrbare Dame der Gesellschaft mit ihren minderjährigen Kindern und den Dienstboten! Was hatte er sich dabei gedacht?
„Worüber haben sie denn gestritten?", erkundigte sich Fräulein Sélène. Aufmerksam und interessiert blickte sie ihn an. Genau, wie er es sich gewünscht hatte. Was sollte er ihr antworten? Plötzlich spürte er die Schweißtropfen auf seiner Stirn. Sie mussten schon länger dort gestanden, so stickig, wie es in diesem Raum war. Dennoch würde er die Sache jetzt zu Ende bringen, beschloss Pastor Lepsius. Als Seelsorger kam es immer wieder vor, dass man in mehr oder weniger delikaten Situationen zurate gezogen wurde. Auch sie – gerade sie – galt es zu meistern. Doch die gnädige Frau ließ ihn nicht zu Wort kommen.
„Sélène! Sei nicht so vorlaut! Wie oft soll ich dir das noch sagen. Du hast Herrn Pastor Lepsius nicht zu unterbrechen. Du gehst auf der Stelle in dein Zimmer! Und alle anderen sind auch entlassen.“ Einen Augenblick war es ganz still, dann erhob sich die Köchin als Erste und öffnete die Tür. Auch die anderen standen auf. Eins nach dem anderen verließen sie den Raum.
Als die Tür sich geschlossen hatte, wandte sich Frau Fabrikdirektor Marl dem Pastor zu. „Das war eine sehr interessante Stunde“, sagte sie. „Ich bedauere, Sie bei Ihren wirklich bemerkenswerten Ausführungen unterbrechen zu müssen. Doch ist die Zeit schon fortgeschritten, und ich habe etwas von großer Wichtigkeit mit Ihnen zu besprechen.“
Adam erwachte in Verwirrung, schweißgebadet und erregt. Er blieb noch einen Augenblick liegen und starrte auf den fadenscheinigen Stoff des Betthimmels. Von der Annenkirche her drangen gedämpft die Schläge des Uhrwerks. Sie verkündeten die Mittagsstunde und hallten wider in dem Hof, auf den sein Zimmer hinausführte. Adam schloss die Augen und öffnete sie wieder, doch die Düsternis im Zimmer blieb. Nach und nach fielen ihm Einzelheiten seines Traumes wieder ein, zusammen mit dem Geruch, der ihn vorhin in der Kutsche so unvermittelt überrascht hatte, bittersüß und mächtig. Alles war wieder da gewesen: Haare im Wind und geflüsterte Worte, die Verlockungen seiner Jugend – „Nein, nein“, murmelte Adam. Er griff nach dem Amulett, das sich aber nicht an seinem gewohnten Platz befand. Adam fuhr auf, durchsuchte seine Kleider und die Bettwäsche, bis er es endlich in der Spalte zwischen Matratze und Bettgestell entdeckte, mit zerrissener Schnur. Ob das ein Zufall war? Er musste sich besser schützen.
Dass es diesen Obstgarten noch immer gab! Er hatte ihn lange vergessen, aus seiner Erinnerung verdrängt. Doch jetzt stieß es ihm auf wie ein ranziges Stück Butter. Einen Spruch vor sich hin murmelnd, knotete er die Schnur behelfsmäßig wieder zusammen und ließ das Amulett zurück an seinen Platz über seinem Herzen gleiten, wo es sich schnell erwärmte. Es war ein schönes, antikes Stück; mit einer echten Hieroglyphe auf der einen und dem heiligen Ibis auf der anderen Seite. Er hatte es einem Händler in einer der dunklen Gassen neben der Synagoge im Quartier Latin abgekauft, der ihm glaubhaft versicherte, es von einem Gewährsmann direkt aus Ägypten bezogen zu haben. Wie dem auch sei: Es hatte Adam stets gut geschützt. Und war nicht gerade sein Verlust und der damit einhergehende Traum ein Zeichen, dass es die Macht der Dämonen zu bannen vermochte? Abgesehen davon, dass Adam als Magier des achten Grades des Goldenen Ordens des Thot und der Seschat auf solch lächerliche Hilfsmittel wie ein angeblich ägyptisches Amulett keineswegs angewiesen war.
Adam erhob sich, ließ sich auf den Boden gleiten und ging mit unsicheren Schritten hinüber zum Fenster. Dort blieb er stehen, die Arme auf das Brett gestützt, und blickte hinaus in den Hof samt Kehrichthaufen, Latrinen und einem verkümmerten Rosenstock neben dem Hausbrunnen. Graue Bettlaken hingen auf einer Leine wie tote Fledermäuse und warfen scharfe, schmale Schatten auf das Pflaster. Zwei schwarze Katzen lagerten an den Steinen des Haussockels. Eine Schmeißfliege näherte sich zielstrebig dem geöffneten Fenster. Geschickt wich sie Adams Schlag aus. Sie war nicht die einzige im Raum; möglicherweise war er sogar von einer geweckt worden, die sich auf seiner Stirn niedergelassen hatte. In Erinnerung an die Berührung ihrer Beine auf seiner Haut fuhr sich Adam übers Gesicht. Er war noch immer nicht wieder ganz bei sich, konnte sich der Verlorenheit und des Verlangens nicht entziehen. Vielleicht würde ein Schluck des Birnenlikörs helfen? Hastig nestelte er den Schlüssel zum Zauberkasten aus seiner Tasche hervor und öffnete ihn. Mit einem geheimen Wort entfernte er zugleich den magischen Schutz, den er dieser unvollkommenen Technik beigegeben hatte und klappte ihn auseinander. Der silberne Becher in seiner Hand zitterte leicht, als er den Inhalt der kleinen Flasche hineinleerte. Warum war es nur noch so wenig? Mit einem Schluck spülte Adam den schlechten Geschmack aus seinem Mund, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass eine gewisse Ahnung zurückblieb: Das Licht so fahl und kalt, im Geäst der Bäume der Wind – Er wollte, durfte nicht mehr dran denken. Ganz gewiss war er nicht hergekommen, um von Neuem in ihre Fänge zu geraten! Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, versuchte ganz, sich auf die süße Schärfe zu konzentrieren, die in seinem Mund zurückgeblieben war. In seinen Gedärmen spürte er noch immer den verhassten, wollüstig schrecklichen Schauder. Kaum ließ er sich zu einem kurzen Schlummer in diesem verfluchten Gasthof nieder, war er diesem Gefühl der Niederlage erneut ausgesetzt. Im vorderen Zimmer mit seiner lichten Stuckdecke und den großen Fenstern wäre ihm das nicht geschehen! Aber hier, unter dem schweren Holzgebälk, war man natürlich gegen nichts gefeit. Und im Hof gleich zwei schwarze Katzen! Er hatte sich nicht mehr so desolat gefühlt, seitdem er diesen Ort vor zwanzig Jahren zum letzten Mal verlassen hatte. Sein ganz persönliches Land Edom, mit seinem Dorngestrüpp und den garstigen Tieren. Entschlossen kehrte Adam dem Fenster den Rücken. Er fragte sich, wo Nicolas mit seiner Hose abgeblieben sein mochte. Er hatte den Kerl vor allem deshalb engagiert, weil er leidlich Deutsch zu sprechen behauptete – eine Fähigkeit, die, wenn er sie denn jemals besessen hatte, ihm mit zunehmender Entfernung von der französischen Grenze immer weiter abhandengekommen war.
Es klopfte. Na endlich, dachte Adam.
Ein Dienstmädchen erschien in der Tür und knickste.
„Eine Dame ist da für Sie. Sie wartet im vorderen Salon.“
Frau im Baum
W
äre er nur früher losgeritten! Aber wie hatte er auch wissen können von dieser nicht enden wollenden Steigung kurz vor dem Ziel, und dass er sie gerade in der Mittagshitze erreichen würde. Am Ende hatte Jean Pierre Flachslandt von Aue absteigen müssen, weil dieser gemietete Klepper schier unter ihm zusammenbrach. Nun saß er schon seit einer Weile wieder im Sattel, und es ging gerade dahin. Aber sie waren doch beide recht in Schweiß geraten. Als sich ein kleiner Bach zu ihnen gesellte, sprang Jean voller Erleichterung ab. Er band das Pferd an einen naheliegenden Baum, damit es saufen konnte, und kühlte sich selbst die Füße. Danach lag er eine Weile auf dem Rücken und blickte hinauf ins Himmelsblau. Hummeln kamen vorbeigeschwommen, zwei weiße Falter umtanzten sich über den Gräserspitzen. Jean dachte nach.
Das gehörte nicht gerade zu seinen Stärken. Er hatte es nie für nötig befunden, Strategien zu entwickeln. Besser war es doch, erstmal zu schauen, was die Lage so hergab. Gut aufgestellt, mit beiden Füßen fest auf dem Boden und dann: En garde! Allez! Touché! Den Gegner beobachten, seine Schwächen erkennen, vorstoßen und zurückweichen, mit ausgemachten Finten ihn narren, geschickt zustoßen, wenn er sich eine Blöße gab – Was ein gutes Gefecht betraf, war Jean jederzeit bereit und mit allen Wassern gewaschen.
Sein Geschick und seine Erfahrungen im Bereich diplomatischer Verhandlungen hatte er dagegen nie unter Beweis stellen können. Solche Dinge waren das Terrain seines Bruders und seines Vaters gewesen. Niemand hatte je daran gedacht, ihn auf diesem Gebiet auszubilden, niemand je sein Interesse daran geweckt. Weshalb auch? Als jüngerer Sohn hatte Jean keinerlei Pflichten in dieser Richtung auszuüben gehabt. Und nun konnte er nicht mal mehr den Rat eines der beiden einholen. Nur den seiner Tante Cléophée. Auf den er, besten Dank auch, gut und gern verzichtete. Seit nunmehr zwei Jahren, seit dem Tod seines Vaters, war er das Oberhaupt der Familie Flachslandt von Aue, mitsamt Adelspatent und dem heruntergekommenen Straßburger Stadtpalais. Zwar war es allein Fanny Rotmunds Geld zu verdanken, dass nicht längst das Dach zusammengefallen war, und Tante Cléo hatte dort praktisch schon immer gewohnt. Dennoch gehörte das Haus von Rechts wegen ihm. Er war ein freier Mann!
Was Tante Cléo leider nicht daran hinderte, ihn weiterhin wie einen unwissenden Jungen zu behandeln, oder sie auch nur dazu bewogen hatte, ihm den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Weder sie noch Fanny hatten jemals Anstalten gemacht, ihre Wohnräume in der Beletage zu verlassen oder ihm zumindest eines der dortigen Zimmer anzubieten. Stattdessen ließen sie ihn im zugigen Obergeschoss hausen. Nicht, dass ihm das allzu viel ausmachte. Er war ganz zufrieden mit der Unabhängigkeit in den kahlen Räumen. Dennoch war es nicht in Ordnung.
Er war ein erwachsener Mann, den es sehr wohl etwas anging, was in seinem Hause geschah. Solange sein Vater lebte, war das anders gewesen. Da hatte er sich auch nie Gedanken über Fanny Rotmunds Labor und ihre Experimente gemacht. Er war es von jeher gewohnt, dass der Geruch nach Chemikalien in der Luft hing, sobald man die Haustür öffnete, und oft genug auch in der Straße davor. Ein- oder zweimal war was explodiert, aber es war nie jemand zu Schaden gekommen. Selbst in dem Raum, den Fanny Rotmund als Laboratorium nutzte, waren kaum Spuren zurückgeblieben, nachdem sie einmal geistesgegenwärtig den brennenden Vorhang heruntergerissen und darauf herumgetrampelt war. Es gehörte zu Jeans täglichem Leben, dass diese Frau mit ihren fleckigen Händen und der hellen Narbe auf der Wange mit ihnen zu Tisch saß und mit Tante Cléo und seinem Vater ihre neuesten Erfindungen diskutierte. Ihr liebstes Kind war dieses Blau, das ihm als Vorwand für seinen Auftrag dienen sollte. Künstliches Indigo! Sie experimentierte schon lange damit herum, und wie es schien, hatte sie gerade in den letzten Wochen vor ihrer Krankheit einen Erfolg erzielen können.
Richard Hervé war ein häufiger Gast an ihrer Tafel. In seiner Fabrik stellte er die Farbstoffe her, die Fanny gefunden hatte, darunter ein strahlendes Gelb und ein tiefes Violett. Über das Indigo hatte es lange Diskussionen gegeben. Dabei war es vor allem darum gegangen, wie man es in großen Mengen herstellen könne: In ihrem Laboratorium hatte Fanny Rotmund schon vor einiger Zeit einen Weg der Synthese gefunden, doch eignete der sich nicht für die massenhafte Produktion, die ein solches Rezept erst wertvoll gemacht hätte. All das hatten sie vor seinen Ohren besprochen – und sich dabei kaum Gedanken darüber gemacht, dass er nicht nur zuhören, sondern durchaus auch verstehen könne, was sie da beredeten.
Und sich seine eigenen Gedanken machte.
Mit dem Geld, das Hervé für Fanny Rotmunds Erfindungen zahlte, waren sie auch nach Vaters Tod ganz gut über die Runden gekommen. Seit einigen Wochen allerdings ging es Fanny schlecht, und es verlangte sie nach ihrer Tochter: Sélène Marl, eine junge Dame von nunmehr neunzehn Jahren, die in der Familie ihres Vaters in einer nassauischen Kleinstadt lebte, von der Jean in seinem Leben noch nicht gehört hatte.
„Da kannst du dich mal nützlich machen“, hatte seine Tante Cléophée befunden, als sie ihm die Idee für diese Reise nahezubringen suchte. „Ihr seid doch praktisch miteinander verwandt“, hatte sie behauptet.
Fanny Rotmund war skeptischer gewesen. „Es ist nur so, dass wir sonst niemanden wissen“, sagte sie und blickte ihn von ihrem Lager aus bittend an. Es war einer der heißesten Tage des Sommers. Die Luft stand über der Rheinebene, die Fensterläden waren geschlossen. Wie immer hing ein Geruch nach Chemikalien und Kaffee in ihrem Zimmer, wenn auch nicht in der Intensität früherer Zeiten. Auf dem großen Tisch stand eine komplizierte Anordnung von Kolben, Glasgefäßen, Röhren, Thermometern und Trichtern, im Regal die Flaschen und Gefäße, in denen sie ihre Zutaten aufbewahrte. Der Stuhl auf dem kleinen Schreibtisch am Fenster war zurückgeschoben, als habe die Bewohnerin des Zimmers sich gerade erhoben, um sich für einen kurzen Moment auf der Chaiselongue auszuruhen. Tante Cléo saß in dem großen Sessel und bemühte sich, einen ungezwungenen Eindruck zu machen.
Eigentlich roch es auch weniger nach den Chemikalien früherer Zeiten als nach Medizin. Die Glasgefäße auf dem Tisch waren trüb geworden und hatten Staub angesetzt. Fanny Rotmund selbst auf der Chaiselongue sah aus wie ein grauer Federwisch, der jederzeit auseinanderzufallen drohte. Jean hatte sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Er war erschrocken darüber, wie wenig von ihr geblieben war. Er fühlte sich an die letzten Tage der Krankheit seines Vaters erinnert, und obwohl er dessen Geliebte nie besonders gemocht hatte und ihr Verhältnis schwierig gewesen war, beschlich ihn bei ihrem Anblick das wohlbekannte Gefühl von Trauer und Verlust, das er nicht haben wollte. Auch deshalb hatte er sich schließlich zu dieser Reise bereit erklärt.
Der Gedanke dagegen, irgendwo auf der anderen Rheinseite eine Art Schwester zu haben, begeisterte ihn weniger. Von dem ein oder anderen erotischen Abenteuer abgesehen, konnte er mit jungen Damen nicht viel anfangen. Zwar schmeichelte ihn die Aufmerksamkeit, die sie ihm üblicherweise schenkten, doch hatte er noch nie eine gefunden, die sich für das Degenfechten interessierte oder seine Leidenschaft für das Zeitalter Ludwigs XIII. teilte. Den Gedanken, dass auch er mal eine Familie würde gründen müssen, bereitete ihm Unbehagen. Er ahnte, dass der Tag nicht weit war, an dem seine Tante ihn darauf ansprechen würde, wahrscheinlich mit einer ebenso passenden wie glanzlosen Kandidatin in der Hinterhand. Man konnte froh sein über jede Ablenkung, die sie davon abhielt, einen entsprechenden Plan in Angriff zu nehmen.
„Wir sollten ihn mit einem Vorwand ausrüsten“, sagte Tante Cléophée. „Irgendwas, das ihm erlaubt, sich mit deinem ehemaligen Gatten bekanntzumachen und sich in die Familie einzuführen. Was wir brauchen, ist ein Empfehlungsschreiben.“
„Was halten Sie von Hervé?“
„Wenn Jean sich dazu entschließen könnte, seine abenteuerliche Tracht abzulegen und wie ein gesitteter Bürger aufzutreten, wäre das ein guter Ausgangspunkt. In einen der Anzüge seines Vaters wird er nicht hineinpassen. Auch da könnten wir Hervé fragen. Hat nicht sein Sohn eine ähnliche Statur?“
Jean kannte die Art der beiden zur Genüge, über seinen Kopf hinweg über ihn zu reden und Entscheidungen zu treffen, und sträubte sich entsprechend. Am Ende war es ihnen zwar nicht direkt gelungen, ihn in einen Anzug zu stecken, doch hatten sie immerhin dafür gesorgt, dass er die notwendige Ausrüstung in seinen Reisesack packte.
„Du musst die Sachen dann aber aufbügeln lassen“, sagte Tante Cléo. „Sieh zu, dass du dich in einem respektablen Gasthaus einmietest, nicht in irgendeiner Spelunke. Sowas kommt schnell heraus in einer Kleinstadt. Und lass dir bloß nicht einfallen, deinen Degen umzuhängen. Am besten lässt du ihn gleich hier. Wir leben im 19. Jahrhundert! Wie oft soll ich dir das noch sagen. Und dass du mir keiner der jungen Damen schöne Augen machst. Du musst dich streng geschäftsmäßig verhalten, hörst du? Lass dir von Hervé genau sagen, was du zu tun hast.“ Und so weiter, und so fort. Was man unter streng geschäftsmäßig verstand, war ihr wahrscheinlich selbst ein Rätsel, und was den respektablen Gasthof anging, sollte sie das besser ihm selbst überlassen. Er hatte andere Vorstellungen, was er mit seinem Reisegeld anfangen wollte!
„Vor allem aber hütet Euch vor dem Spuk an der Mühle“, sagte Fanny Rotmund plötzlich. Ihre Stimme war so leise geworden, dass er sich tief zu ihr herabbeugen musste, um ihre Worte zu verstehen. „Dort ist ein alter Garten –“ Sie begann zu husten, und ihr letzter Satz endete in einem heiseren Krächzen. Sie schloss die Augen. Jean wartete, ob sie noch was sagen würde. Er wollte gerade nachfragen, als seine Tante ihn unterbrach: „Siehst du denn nicht, wie erschöpft sie ist! Hinaus mit dir! Je eher du dich auf die Reise machst, umso besser.“
Es war ja durchaus möglich, dass Tante Cléo es gut mit ihm meinte. Zumindest, solange sie der Überzeugung war, ihre Interessen wären auch die seinen. Deshalb hatte sie ihn am Morgen vor seiner Abreise noch einmal in ihr Zimmer gebeten. „Da ist noch was“, sagte sie. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Fanny hat es mir jetzt erst gesagt. Stell dir vor: Sie hat die Rezeptur für ihr Blau an ihre Tochter geschickt. Sie hat sie in den Brief gelegt, den ich persönlich für sie zur Post gebracht habe!“
Zwar war es tatsächlich Jean gewesen, der den Auftrag dazu erhalten hatten, dennoch hütete er sich, etwas darüber zu sagen. Tante Cléo war in der Lage, ihm die Schuld zu geben, an was auch immer.