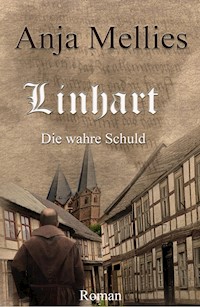
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anmerkung der Autorin Bei diesem Roman handelt es sich um eine fiktive Geschichte. Die Handlung, die örtlichen Gegebenheiten und die Personen sind frei erfunden. Ich wollte von einem Ereignis schreiben, das erzählt, wie beeinflussbar der Mensch ist. Wie im Mittelalter gibt es auch heute Menschen, die sich hinter der Religion verstecken, um Macht auszuüben. Und noch immer gibt es die Menschen, die sich benehmen wie Lemminge. Sei es aus Tradition, Angst, Neid oder Unwissenheit, sie folgen ihren Anführern bis weit über die Klippe, ohne zu merken, dass sie bereits fallen und viele andere Menschen mit sich reißen… Linhart ist der Schüler des Inquisitors Bartholomeus und reist viele Jahre an dessen Seite. Doch mit der Zeit beginnt er die Urteile seines Meisters und den Weg, der dazu führt, dass die Verurteilten ihre Schuld zugeben, anzuzweifeln. Er versucht, unter Lebensgefahr gegen eine herrschende Meinung anzukämpfen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anja Mellies
Linhart
Die wahre Schuld
© 2018 Anja Mellies
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:978-3-7469-1760-3
Hardcover:978-3-7469-1761-0
e-Book:978-3-7469-1762-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Ich fühlte mich fremd, als ich durch die Räume des Hauses ging, in dem mein Vater seine Kindheit verbracht hatte. Es war ein altes und sehr großes Haus. Ins Fachwerk waren ein Spruch, der Gottes Segen für die Bewohner garantierte, und die Jahreszahl 1545 geschnitzt. Seit über vierhundert Jahren gehörte es meiner Familie. Helmut und Elsbeth Frei waren meine Großeltern gewesen, und wenn ich ihren Wunsch erfülle, wird das Haus auch die nächsten Jahrzehnte im Eigentum der Familie Frei stehen.
Es war viele Jahre her, dass ich meine Großeltern das letzte Mal gesehen habe. Zwischen ihnen und meinem Vater kam es immer wieder zum Streit.
Irgendwann war eine Karte zu Weihnachten der einzige Beweis, dass meine Großeltern noch lebten. Mein Vater sprach nie über den Grund dieses Zerwürfnisses. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch nie danach gefragt. Als mein Vater starb, ging meine Mutter mit mir zurück nach London, den Ort, an dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Der Kontakt zu meinen Großeltern brach vollständig ab. Erst die Nachricht ihres Todes durch einen Anwalt brachte mich zurück nach Röhrenfurth.
Ich ging ziellos umher. Die Galerie an den Wänden zeigte etliche Porträts der Familie Frei. Alle bis auf eines waren sie handgemalt. Das letzte Bild dieser Galerie zeigte den Abzug einer alten, vergilbten Fotografie meines Vaters. Auf ihr war ein junger Mann zu sehen. Der dunkle Anzug, den er trug, saß perfekt. In den Händen hielt er eine Bibel, deren Alter man an dem aufwändig gearbeiteten, aber abgenutzten Einband erkannte. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals mit einer Bibel in der Hand gesehen zu haben.
Ich betrat die Bibliothek des Hauses. Maßgefertigte Regale aus Mahagoniholz reichten bis zur Zimmerdecke. Gegenüber der Tür standen ein imposanter Schreibtisch und ein Tresorschrank ebenfalls aus Mahagoniholz.
Die Bücher waren alt, die Einbände zum Teil in Leder gebunden. Sie standen in Reih und Glied. Besonders wertvolle Exemplare wurden durch Glastüren geschützt. Ich ging näher heran und erkannte, dass auf einigen Einbänden Jahreszahlen notiert und sie chronologisch sortiert waren. Die Seiten waren vergilbt. Sie waren von Hand beschrieben. Die Schriftzeichen waren in einer Art geschrieben, dass ich lange brauchte, sie zu entschlüsseln und den Inhalt zu verstehen. Es waren Auflistungen. Einnahmen und Ausgaben waren sorgsam untereinander geschrieben.
Dieser Raum war großartig. Überwältigt setzte ich mich auf den schweren Schreibtischsessel. Nachdem ich einen Augenblick innegehalten hatte, überlegte ich: Wenn in den Regalen schon so viele Schätze standen, welche würde der Tresor wohl verbergen? Bei der Testamentseröffnung gab mir der Notar einen versiegelten Umschlag. In dem mein Großvater mir, neben dem Umstand, dass er es bereute, mich nie richtig kennengelernt zu haben, zwei Zahlenkombination mitgeteilt hatte.
Gespannt öffnete ich den Tresor. Es war ein alter Schrank. Mein Großvater hatte ihn irgendwann aufarbeiten lassen. Die erste Zahlenkombination öffnete die originale Tür des historischen Schrankes. Die zweite einen modernen Stahltresor, der sich im Inneren des Schrankes verbarg.
In dem Tresor befand sich neben Wertpapieren, Schmuck und Bargeld ein mit vergilbten Leinen umwickeltes Päckchen. Neugierig nahm ich es heraus und entfernte vorsichtig den Stoff.
Es war ein auf vielen Bögen von Hand geschriebener Brief. Der Verfasser dieses Briefes stellte sich als Linhart vor. Es dauerte nicht lange und ich war fasziniert von dem, was ich las.
Kapitel I
Anno 10.06.1598
Da mein Wirken ein Ende gefunden hat, werden meine Tage wieder länger. Ich schaue aus dem Fenster und beobachte, wie der Schnee leise und leicht wie die Saat des Löwenzahns auf die Erde fällt und sie in eine weiße Decke hüllt. Die Natur hat sich zur Ruhe gebettet, so wie ich es tun werde. Erst der Frühling wird das Leben neu begrüßen, so wie er es einst bei mir tat.
Geboren als Sohn eines einfachen Schmieds hatte ich schon früh erfahren, dass das Leben nicht einfach ist. Das Essen reichte kaum, um die ganze Familie satt zu bekommen. Peter, mein ältester Bruder, half meinem Vater bereits als Kind in der Schmiede aus. Er war so lange der Handlanger unseres Vaters, bis dieser das Zepter aus der Hand legte und Peter die Schmiede übernehmen konnte. Ich aber hatte nicht die Privilegien des Erstgeborenen. Ich war gerade fünfzehn Jahre alt, als mein Vater mir erklärte, dass ich nun alt genug sei, dass ich hinaus ins Leben müsse, um mir eine eigene Existenz zu erarbeiten.
Katharina, meine Schwester, hatte es etwas leichter. Sie war eine anmutige Erscheinung und obwohl die Männer im Ort ihr Avancen machten, beschloss sie, ihr Leben Gott zu widmen. Der Tag, an dem mein Vater sie ins nahe gelegene Kloster begleitete, war auch der Tag, an dem ich Röhrenfurth verließ.
Die Jahre vergingen und mein Weg führte mich durch viele Orte. Als Tagelöhner stand ich auf der untersten Stufe der Gesellschaft, ein Ausgestoßener, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte, es sei denn, es war zu seinem Nutzen. Meine Entlohnung reichte bisweilen nicht, den Hunger zu stillen, und es gab Tage, da wagte ich es nicht einmal, von einer trockenen Unterkunft zu träumen. In den Sommermonaten war es einfach. Ich nächtigte im Freien, auf Feldern oder in den Hauseingängen abseits gelegener Gassen. Aber im Winter war es schwierig. Wenn ich Glück hatte, fand ich einen Holzverschlag, in dem ich mich vor der Kälte und Feuchtigkeit der Nacht schützen konnte, immer auf der Hut, nicht entdeckt zu werden.
Auch in dem Augenblick, als sich mein Leben ein zweites Mal rigoros änderte, war es so. Der Tag war kalt und es hatte geregnet. Wieder einmal hatte ich keine Möglichkeit gehabt, die nötigen Münzen für eine Mahlzeit und einen Schlafplatz zu verdienen. Ich schlich durch die Gassen der Stadt wie ein streunender Hund. Die meisten Menschen nahmen mich nicht wahr oder jagten mich mit einem Prügel drohend davon.
Der Sommer war feucht und kalt gewesen. Die Ernte verkam auf den Feldern. Die Menschen hungerten, doch ihre Lehnsherren forderten ihr Recht und holten sich das, was ihnen ihrer Meinung nach zustand. Da konnten sie keinen weiteren Esser gebrauchen und sie schützten das, was ihnen geblieben war, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Das bekam ich am eigenen Leib zu spüren. Ich ging über den Marktplatz vorbei an Ständen mit einer dürftigen Auswahl an heimischem Obst und Gemüse. Ich hatte Hunger und es war auch nur ein alter, nahezu vergammelter Apfel, den ich vom Marktstand nahm. Aber kaum hatte ich ihn unter meinem Cape versteckt, hörte ich die Rufe des Händlers, der mich als Dieb beschimpfte. An dem Tag war ich es, der versuchte, sich vor dem Zorn der Menschen zu schützen. Ich war es, den die wütende Menge zum Schafott zerrte. Wäre Bartholomeus nicht genau in dem Augenblick, in dem man mir einen Strick um meinen Hals legte, auf dem Platz erschienen, wäre mein Leben lange Vergangenheit und diese Zeilen wären nie geschrieben worden.
Damals appellierte Bartholomeus an die Barmherzigkeit der Leute. Er erzählte ihnen von der Gnade Gottes und bat für das Leben des ihm noch unbekannten Mannes. Er war es auch gewesen, der meine Wunden verband und mich in den folgenden Tagen pflegte.
Mit seiner Sprache und seinem ganzen Verhalten zeigte Bartholomeus seine Bildung. Er war streng in seinem Glauben. Seine Ausbildung beruhte auf Gottes Wort. Ich erfuhr, dass bereits seine Eltern dem Teufel zum Opfer fielen. Verkleidet als Gaukler kam Luzifer auch in die Stadt, in der er seine Kindheit verbrachte. Er war geblendet von den Kunststücken, die des Teufels Diener ihm zeigten. Er schlich sich trotz der Mahnungen seiner Eltern immer wieder in ihre Zelte. Sie verschwanden mitten in der Nacht. Es dauerte nicht lange und die Menschen im Ort spuckten Blut. Immer mehr starben, so auch seine Eltern. Ein Onkel brachte ihn in das Kloster nach Hersfeld. Dort erkannte er, dass er für seinen Ungehorsam mit dem Leben seiner Eltern bezahlt hatte, und dass er nur durch Buße ihre Seelen retten konnte.
Als Bartholomeus mir vorschlug, mit ihm zu gehen, zögerte ich nicht. Ich begann meine Lehrjahre mit dem Willen, mit Gottes Gerechtigkeit gegen die Macht des Teufels und seiner Helfer zu kämpfen.
In den nächsten Jahren wich ich nicht von Bartholomeus’ Seite. Von ihm lernte ich, Dinge zu erkennen, die im Verborgenen lagen und über den Verstand des Normalen hinausgingen. Er berichtete mir von den Versuchen des Teufels, die Herzen der Menschheit zu vergiften und von den Menschen, die den Verführungen des Bösen nicht widerstehen konnten. Er zeigte mir, welchen Schaden diese Menschen über die Welt brachten. Wie sie mit der Hilfe Luzifers Ernten vernichteten und Leid über Mensch und Tier brachten. Ich folgte dem Weg meines Meisters, ich stand ihm zur Seite und nahm ohne Misstrauen seine Urteile hin. Ich schaute zu ihm auf, identifizierte mich mit dem Glauben meines Lehrers. Auch das Lesen und Schreiben brachte Bartholomeus mir bei. Mit jedem Wort, welches ich in der Bibel gelesen hatte, verehrte ich Gott mehr. Ich las von der Barmherzigkeit, die mir einst das Leben rettete. Aber mit jedem Wort, welches ich las, wurde die Frage nach Bartholomeus’ Barmherzigkeit größer. Ich hatte das Gefühl, als wäre er mit jedem Urteil, das er gesprochen hatte, erbarmungsloser geworden. Und auch die Menschen um mich herum schienen immer leichter für ihre bedauernswerte Lage einen Schuldigen finden zu können.
Heute sind meine Zweifel an Bartholomeus’ Urteilsfähigkeit größer denn je.
Diese Zweifel manifestierten sich durch unser Tun in Frankfurt. Wie schon so oft hatte man uns gerufen, um bei der Überführung und Verurteilung einer vermeintlichen Hexe zu helfen.
Die Inquisition hatte mich an viele Orte geführt, aber von keinem war ich so fasziniert gewesen wie von dieser Stadt. Noch immer bin ich beeindruckt von den großen Häusern, die mit ihren verzierten Fassaden die gepflasterten Straßen der Stadt säumten. Die Waren, die die Händler in den untersten Stockwerken ihrer Häuser anboten, waren nicht zu vergleichen mit den einfachen Dingen, die ich bisher sah. Ich war beeindruckt von den Männern und Frauen, die mit erhobenen Köpfen und stattlicher Kleidung die exotischsten Gewürze, Stoffe aus feinster Seide und Produkte, deren Nutzen ich bis heute nicht kenne, begutachteten und kauften.
Aber ich sah auch das Elend und die Ungerechtigkeit, die ich schon so oft gesehen habe. Ich sah die Kinder, gekleidet in grobes und zerschlissenes Tuch, wie sie einem Pferdewagen hinterherliefen und sich freuten, wenn man ihnen ein Stück Obst zuwarf. Ich sah die Männer und Frauen, die abseits der großen Straßen um Almosen bettelten.
Unser Weg führte uns durch die engen Gassen der Stadt. Als wir die Gasse der Weber und Gerber entlanggingen, drang kaum ein Lichtstrahl zu uns durch. Es schien, als hätte Gott den Menschen, die hier ihr Leben fristeten, das Antlitz der Sonne verweigert. Es war dunkel und sudelig. Von den Häusern bröckelte der Lehm und das Fachwerk war verrottet. Aber nicht nur der Verfall der Gebäude zeugte von der niederen Zunft derer, die hier lebten, auch der Gestank in der Gasse ließ die bittere Armut der Menschen erkennen. Trotz eines Verbotes wurde Unrat aller Art, angefangen bei den Exkrementen der Anwohner bis zum Tierkadaver, auf der Straße entsorgt und verrottete in den viel zu engen Gassen. Bartholomeus und ich mussten Obacht geben, denn mehr als einmal wurde eines der Fenster in den oberen Stockwerken geöffnet und der Inhalt des Nachtgeschirrs auf die Straße entleert. Es war nicht wie in den vornehmeren Stadtvierteln. Es gab keine Abfallschächte oder Gräben, die regelmäßig gereinigt wurden. Auch die Wege waren nicht gepflastert. Wir versanken bis zum Knöchel im Morast. Freilaufende Hühner, Schweine und streunende Hunde wühlten im Schlamm auf der Suche nach etwas Fressbarem.
Der Geruch war kaum zu ertragen. Ich war es, dessen Schritte immer schneller wurden. Schatten huschten durch die engen und verwinkelten Straßen. Hinter jeder Ecke konnte das Böse lauern. Egal ob der einfache Vagabund, der versuchte, durch Diebstahl seine Familie zu ernähren, oder der Verbrecher, der, mit dem Teufel im Bunde, nicht einmal vor Mord zurückschreckte. Alles war hier in diesen dunklen Gassen zu Hause.
Ich habe noch nie so viele unterschiedliche Menschen an einem Ort gesehen. Bis zum heutigen Tage erkenne ich nicht, warum Reichtum und Armut so dicht beieinander wohnen. Ich ergründe nicht, warum die Menschen jeden Tag in die Kirche gehen und Gott um Vergebung anflehen, aber niemand den Armen, die in den schmutzigen Gassen ein erbärmliches Leben führen, etwas zu essen gibt. Diese Art Gottesfurcht ist es, die mich auch heute noch irritiert.
Als wir nach unserer Ankunft in Frankfurt den Gerichtssaal betraten, stand Helena bereits vor ihren Anklägern. Sie hatte lange rote Haare, die sie unter einer Haube versteckte. Ihr zierlicher, fast noch kindlicher Körper war von einem einfachen Leinengewand bedeckt. Sie war eine begehrenswerte junge Frau. Man warf ihr vor, mit Hilfe des Teufels ihren Herrn, einen geachteten Kaufmann, verführt zu haben. Die Anklage stützte sich auf die Aussage der Ehefrau, die gesehen hatte, wie ihr Mann am frühen Morgen die Kammer ihrer Magd verließ.
Die Verteidigung des Kaufmannes lautete, dass er, wann immer er das Zimmer seiner Bediensteten betrat, unter einem Zwang gehandelt hatte, dass er gegen seinen eigenen Willen den Geschlechtsakt mit ihr vollzog. Er behauptete, dass er selbst gesehen habe, wie Helena sich einem Dämon hingab; seiner Aussage nach einem Geschöpf mit schwarzen, knochigen Flügeln und spitzen Zähnen, dessen Krallen sich tief in Helenas Haut gebohrt hatten, während sie wollüstig Luzifer huldigte.
Auch am heutigen Tage bin ich mir sicher, für die Anwesenden stand Helenas Schuld außer Frage und das Urteil war bereits gesprochen, bevor die Verhandlung begann. Der Ankläger, ein Mann von hohem Stand, würde sich niemals freiwillig zu einer niederen Magd legen, da konnte nur Hexerei im Spiel sein. Trotz der Folter beteuerte Helena tagelang ihre Unschuld. Sie blieb bei ihrer Aussage, dass ihr Herr nie unter Zwang gehandelt habe, dass sie ihm nie einen Anlass gegeben habe, in ihr Zimmer zu kommen. Sie beschwor, nie mit dem Teufel intim gewesen zu sein und beteuerte, nur zu Gott zu beten. Sie sagte aus, dass ihr Herr in ihr Zimmer komme, wann immer es ihm gefiel. Aber mit jedem Wort, mit dem sie ihren Herrn beschuldigte, sich an ihr vergangen zu haben, wurden die Torturen der Folter heftiger. Und als sie am vierten Tag unter entsetzlichen Schmerzen ihre Schuld gestand, war ihr Körper von der Folter furchtbar gezeichnet.
Bis zu Helenas Hinrichtung vergingen weitere sieben Tage. Die Tage verbrachte ich an Bartholomeus’ Seite, die Abende in der mir zugewiesenen Kammer. Ich suchte nach Erkenntnissen, die die Zweifel, die in mir wuchsen, entkräfteten. Ich las in der Bibel von der Nächstenliebe und der Vergebung, aber auch von der Denunzierung des Satans und seiner Anhänger. Mir fielen die Worte meiner Mutter wieder ein, die in jedem nur das Gute gesehen und versucht hatte, auch mich in diesem Glauben zu erziehen. Aber auch die Erinnerungen an die Zeit, in der ich am eigenen Leibe erfahren hatte, dass der Mensch sich selbst der Nächste ist, kamen wieder.
Bis zur Hinrichtung hatte man Helenas Wunden gereinigt und zum Verheilen gebracht, hatte ihr zu essen und zu trinken gegeben, sodass ihr Körper sich erholt hatte. Noch immer haderte ich mit ihrem Schicksal. Denn auch ich bin ein Mann und kenne die Anziehungskraft, die eine Frau wie Helena auf Männer ausübt; wieso sollte es bei einem angesehenen Kaufmann anders sein? In der Nacht vor Helenas Hinrichtung sprach ich gegenüber Bartholomeus meine Zweifel aus. Er ermahnte mich, Obacht zu geben. „Das Böse will durch das Laster der Wollust auch deine Seele und deinen Leib schwächen, um dich auch mit anderen Lastern zu verführen. So will er dich vom rechten Weg abbringen und in die Dunkelheit der Sünde führen“, hatte er mir erklärt.
Er selbst lehrte mich, dass der Teufel nur mit der Zustimmung Gottes zu handeln vermag. An jenem Abend fragte ich ihn, ob es nicht so sei, dass Satan die Macht über den Menschen mit Gottes Zustimmung ausübt. Und wenn Satan mit Gottes Zustimmung handelte, sei es denn nicht an Gott, zu richten?
Die Inquisition handele in Gottes Namen und wir seien es, die seinen Willen auf der Erde vertreten, hatte Bartholomeus unser Handeln verteidigt.
Zu jener Zeit war es, dass ich begann, unser Handeln anzuzweifeln. Ich verstand nicht, dass ein Mensch, der unter dem Willen Satans steht, für seine Taten brennen muss, wenn Satan doch mit Gottes Zustimmung handelt.
Für Bartholomeus stand die Gerechtigkeit eines Schuldspruchs außer Frage. Selbst als ich ihn auf die Schmerzen der Folter hinwies, bestand er darauf, im Recht zu sein. Er hielt daran fest, dass Gott es nicht zulassen würde, dass jemand unschuldig verurteilt wird. Wären die Menschen ohne Schuld, könnte ihnen die größte Qual nichts anhaben, war die Aussage, mit der unser Gespräch endete.
Als der Morgen graute, wusste ich, ich konnte Helena nicht vor dem Feuer der Inquisition retten. Alles, was ich für das Mädchen tun konnte, war, Gott zu bitten, ihrer Seele gnädig zu sein und ihr einen schnellen Tod zu schenken.
Bartholomeus ermahnte mich, mich nicht vom rechten Weg zu entfernen. Aber ich wusste auch ohne die versteckte Drohung meines Meisters, dass mein Denken gefährlich war. Schon ein falsches Wort kann aus dem Ankläger einen Angeklagten machen.
Wie bei jeder Hinrichtung trat Bartholomeus auch an jenem Tag, an dem Helena ihr Leben verlor, vor die Angeklagte und forderte sie auf, dem Teufel und dem Bösen abzuschwören. Er versprach ihr, dass Gott ihrer Seele gnädig sein werde, wenn sie ihre Schuld bekenne und Buße tue.
Helena flehte um Gnade und schwor bei Gott, unschuldig zu sein. Aber als alles Flehen nicht half, änderte sich ihr Verhalten, sie wurde immer hysterischer und versuchte, sich aus den Griffen ihrer Wächter zu befreien. Es schien, als hätte sich Satan wirklich ihres Körpers bemächtigt. Aber genau so schnell, wie dieser Anfall gekommen war, verschwand er und sie brach weinend zusammen.
Nachdem sie sich wieder gefangen hatte, ließ sie sich widerstandslos auf den Scheiterhaufen führen. Nun schien es, als hätte sie sich mit dem, was ihr bevorstand, abgefunden. Als man sie an den Pfahl band, hörte ich das Gebet, das sie leise sprach. Als man das Feuer anzündete, erkannte ich in ihren Augen grauenhafte Angst und Verzweiflung. Je höher die Flammen schlugen, desto lauter wurde ihr Gebet. Bis die Ohnmacht sie von ihren Qualen erlöste, konnten ich und die herumstehenden Menschen hören, wie Helena für ihre Peiniger betete.
Nach Helenas Tod gingen die Menschen ihren Geschäften nach, als wäre nie etwas geschehen. Auch Bartholomeus und ich gingen zurück zum Anwesen des Vogtes, der uns für die Dauer des Prozesses eine Unterkunft gegeben hatte. Für Bartholomeus ging das Leben ohne Konsequenzen weiter. Im Gegensatz zu mir fühlte er keine Reue. Ich jedoch fühlte mich schuldig. Ich ließ zu, dass Menschen gefoltert und getötet werden, egal, wie sehr sie ihre Unschuld beteuerten. Ihr Weg war in Bartholomeus’ Händen vorherbestimmt. Mache ich die Augen zu, höre ich auch heute noch Helenas verzweifelte Schreie. Ich sehe die Angst in ihren Augen, ich rieche ihr verbranntes Fleisch, schmecke den Rauch und spüre die Hitze der Flammen. Ich versuchte meine Gedanken in eine glücklichere Zeit zu lenken, aber dann hörte ich das Gebet, das Helena für uns sprach. Und auch ich betete, dass der Herr mit Gnade über mich richtet.
Ich werde es sein, der sich für sein Handeln vor Gott rechtfertigen muss. Ich war entschlossen zu verhindern, dass unschuldige Menschen im Namen meines Gottes sterben. Ich wollte einen gerechteren Weg einschlagen. Nur war mir dieser Weg bisher verschlossen.
Der nächste Ort, an dem wir Gottes’ Wahrheit bezeugen sollten, war Röhrenfurth. Der Ort, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte. Auch dort und in den nahe gelegenen Orten trieben, wenn es nach Pater Josef, dem ansässigen Priester ginge, Hexen ihr Unwesen. Er, der Ortsvorstand und der Landesvogt sandten uns eine Bittschrift, in der geschrieben stand, dass der Schwarze Tod Röhrenfurth heimsuchte. Dass die Menschen, wie es Pater Josef formulierte, in seiner gottesfürchtigen Stadt starben, obwohl sie lebten. Dass ihnen die Glieder am lebendigen Leibe abfaulten und Dämonen von ihrem Körper und von ihren Seelen Besitz ergriffen. Dass das Getreide auf den Feldern verdarb und die Tiere verendeten.
Man beschuldigte Kungundt, eine Heilerin, der Hexerei. Man hatte sie in Gewahrsam genommen. Sie sollte es gewesen sein, die durch die Opferung neugeborener Kinder die Gunst des Teufels erlangen wollte. Und ihm und seiner Gefolgschaft in Röhrenfurt Einlass gegeben hatte. In der Bittschrift bat man Bartholomeus darum, seiner Pflicht gegenüber dem Herrn zu genügen und Kungundt der Hexerei zu überführen.
Ich kannte Kungundt. Ich kannte sie als eine weise und gottesfürchtige Frau. Eine Frau, die alles versuchte, um den Menschen zu helfen. Nie machte sie einen Unterschied zwischen Arm und Reich. Sie half jedem, egal, ob man sie in seine Gebete einschloss oder ihre Dienste mit ein paar Silbertalern honorierte. Auch meiner Mutter half sie bei der Geburt ihrer Kinder. Ich war entsetzt, als ich hörte, dass man sie dem Feuer übergeben wollte. Bartholomeus und ich sollten die Hand sein, die das Feuer entfacht.
---
Bartholomeus und ich verließen unsere Unterkunft, bevor die Kirchenglocke den Tag ankündigte. Obwohl es noch früh war, erwachte in den Straßen bereits das Leben. Es war Wochenmarkt. Auf dem Rathausplatz war man dabei, die Stände aufzubauen und Waren darauf zu platzieren. Für all das hatte Bartholomeus kein Auge. Er wies Händler ab, die aufdringlich wurden. Er führte mich auf dem schnellsten Weg aus der Stadt.
Wir hatten einen langen und beschwerlichen Weg vor uns. Der Landesvogt von Frankfurt hatte uns Pferde angeboten, die Bartholomeus aber mit dem Verweis auf das Gebot der Buße abgelehnt hatte. Um Gott zu gefallen, sei es ihm wichtig, den Weg zu Fuß zu gehen, erklärte er. Jedoch nahm er die Taler und den Proviant, welche der Voigt ihm anbot, dankend entgegen.
Die Wege, die wir gingen, lagen fernab der Hauptstraßen. Es waren von vielen Schritten ausgetretene Wege. Sie waren schmal und uneben und führten vorbei an Feldern über Wiesen und durch Wälder. Zum Teil waren sie so uneben und das Gestein so unregelmäßig, dass die Schritte, die wir taten, wohl überlegt sein mussten.
Wir waren bereits Stunden unterwegs. Die Luft war unerträglich warm und gewitterschwer. Der leichte Wind, der uns begleitete, als wir Frankfurt verließen, hatte sich zu einem Sturm entwickelt. In der Ferne konnte man ein leises Donnern hören und am Horizont vereinzelt das grelle Licht der Blitze erkennen, welche wie das Schwert der Justitia in die Erde einschlugen.
Das nahende Unwetter würde den gefahrvollen Weg in kürzester Zeit unbegehbar machen. Bartholomeus trieb mich zur Eile an. Den Vorschlag, über eine Einkehr nachzudenken, tat er mit der Begründung der drohenden Gefahr für Röhrenfurth ab. Der Pfad, den wir gingen, war kaum noch zu erkennen. Die dünne Kiesschicht verlor sich in den Gräsern des Waldbodens. Es dauerte nicht lange und das Gewitter hatte uns eingeholt. Es regnete heftig und die Dunkelheit, welche das Unwetter begleitete, wurde nur durch Blitze erhellt. Nicht lange und der Weg, den wir nahmen, war feucht und aufgewühlt.
Erst als der Sturm so heftig war, dass es die ganze Körperkraft kostete, sich gegen ihn zu stellen, hatte Bartholomeus ein Einsehen und entschied, dass wir im nächsten Ort haltmachen würden.
Es war ein kleiner Ort. Die Menschen lebten ihr Leben ohne Annehmlichkeiten. Die Häuser waren einfach gebaut. Die Wände waren aus Lehm und die Dächer mit Stroh bedeckt. Es gab keine gepflasterten Straßen. Das Leben selbst hatte die Gassen geschaffen, durch die wir gingen. Sie waren ausgetreten, uneben und mit allerlei Unrat verschmutzt. Der Regen hatte sie in schlammige, rutschige Wege verwandelt. Die Menschen im Ort schienen kein Interesse an uns Neuankömmlingen zu haben. Die Türen waren verschlossen. Doch im Licht der brennenden Kerzen konnte man in den Fenstern das Leben erkennen.
Die Herberge war das größte Haus vor Ort. Aber der Anschein von Größe war nur Blendwerk. Die Einrichtung spiegelte die Einfachheit des Ortes wider. Die Wände waren unbehandelt und der Lehm bröckelte und platzte an vielen Stellen ab. Das Mobiliar war einfach und rustikal. Der Zustand der Stühle und Tische wies auf ihr Alter hin. In der Luft lag ein unangenehmer Geruch, eine Mischung aus Speisen, Bier, Tabak und den Schweißabsonderungen schwer arbeitender Menschen. Aber es war warm und trocken. Die Tische in der Nähe der Feuerstelle waren besetzt. Uns blieb nur ein Tisch unweit der Tür. Der kalte Wind drang durch den Türspalt und es schien, als sei unser Tisch genau der, an dem die Kälte Rast einlegen wollte. Es dauerte lange, bis die Wärme des Feuers die Kälte aus meinem Körper vertrieben und meine Kleidung getrocknet hatte. Die Wirtin servierte uns die Suppe des Nachmittags. Sie war eine Frau, der man ansah, wie hart ihr Leben war. Die Haare waren ergraut, ihre Haut schien wie dünnes Pergament, tiefe Falten durchzogen ihr Gesicht und unter den Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab. Aber sie hatte eine aufrechte Körperhaltung, die keinen Widerspruch duldete. Nach dem Essen zog Bartholomeus sich auf das uns zugewiesene Zimmer zurück. Ich wusste, dass er sich dort auf die neue Verhandlung vorbereiten würde. Eine Gewohnheit, die er eigentlich nicht mehr vollziehen musste. Eine Zeremonie, der ich in der Gewissheit, den Verlauf der Verhandlung zu kennen, nicht beiwohnen wollte. Der Ablauf einer Verhandlung, angefangen bei Bartholomeus’ erster Begegnung mit den Angeklagten bis hin zur Verurteilung, lief immer nach demselben Schema ab. Auch wenn ich mir Bartholomeus’ Missfallen bewusst war, reagierte ich auf seine Aufforderung, ihm auf das Zimmer zu folgen, ablehnend. Ich blieb bis spät in die Nacht in der Schankstube, trank Weizenbier und meine Gedanken schweiften durch die vergangenen Tage.
---
Noch vor Sonnenaufgang verließen wir die Herberge. Immer noch war es kalt und windig, aber es hatte aufgehört zu regnen. Ich wusste, dass wir noch für Stunden unterwegs sein und Röhrenfurth erst in den Abendstunden erreichen würden. Ich hoffte inständig, dass es nicht wieder anfing zu regnen. Unser Weg führte uns über Pfade, die durch den Regen der letzten Tage aufgeweicht waren.
Auf den Feldern fing der Roggen bereits an zu blühen. Nach den feuchten und kalten Frühlingen der letzten Jahre betete jeder um eine gute Ernte. Denn die Kornspeicher waren leer, selbst in den Kammern des Lehnsherrn gingen die Vorräte zu Ende und jeder wusste, dass der Tag kommen würde, an dem er seine Belehnung einfordern würde. Schon oft hatten wir erleben müssen, wie verzweifelt die Menschen waren. Wie sie Gott um einen Ausweg aus ihrer Lage anflehten. Wie sie für ein bisschen Hoffnung bereit waren, ihren letzten Besitz bis hin zu ihrer Freiheit darzubieten. Aber wir hatten auch erlebt, dass es Menschen gab, die sich in ihrer Verzweiflung an die Macht des Bösen wandten. Menschen, die die Anhänger des Teufels um Hilfe baten.
Entgegen der Hoffnung, die mir innewohnte, als wir die Herberge verließen, hatte es doch zu regnen begonnen. Der Himmel war von dunklen Wolken bedeckt und als ich in der Ferne endlich mein Elternhaus erkennen konnte, war es nur ein schwarzer Schatten. Aber durch eines der Fenster erkannte ich ein schwaches Licht.
Als wir in Röhrenfurth ankamen, schien es, als hätte ich den Ort nie verlassen. Es ist kein großer Ort. Es gab Straßen, in denen man den Wohlstand der Hausherren erkannte. Häuser aus Backsteinen säumten diese Straßen. Aber auch hier gab es Wege, die man nach Einbruch der Dunkelheit lieber meiden sollte.
Wir gingen zum Marktplatz. In dem Moment, in dem wir diesen betraten, lichtete sich der Himmel. Nur einen kurzen Augenblick gaben die Wolken die letzten Strahlen der Sonne frei. Sie tauchten die alte Dorflinde, die seit jeher in der Mitte des Platzes stand, in ein dunkelrotes Licht. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Bereits als Knabe kannte ich die Bedeutung dieses Baumes. Ich kannte die Geschichten, die man sich über diesen Baum erzählte. Weit vor meiner Zeit als Galgen gepflanzt, sollen unter seinen knöchrigen Ästen viele Menschen den Tod gefunden haben. Mir war, als würde der Herrgott uns ein Zeichen geben. Bartholomeus und ich waren in der Stadt, um über Kungundts Leben, das Leben einer Frau, die ich ebenfalls seit meinen Kindertagen kannte, zu richten.
Bartholomeus hatte keinen Blick für dieses kurze Lichtspiel. Er eilte über den Marktplatz und hielt zielstrebig auf das Rathaus zu. Ich war froh, als ich endlich die warmen Räume des Rathauses betrat, an dessen Eingangstür wir von Pater Josef, Eckert Frei, dem Landesvogt der Gemeinde, und von Bernhard Schilling, dem Dorfvorstand, begrüßt wurden.
---
Sie hatten mich nicht erkannt. Hätten sie mich erkannt, hätten sie mich nicht mit soviel Respekt begrüßt. Nur Pater Josef schaute mich an, als würde er mich kennen, aber nicht wissen woher. Ich aber hatte sie bereits erkannt, als wir den Marktplatz noch nicht überquert hatten. Eckert Frei, der vom Grafen bestimmte Landesvogt. Sein Benehmen gegenüber den Menschen, die sein tägliches Brot erst möglich machten, glich eher dem des Grafen als dem seines Untergebenen. Jedes Jahr kam er auf den Hof, um den Anteil des Grafen einzufordern. Er benahm sich, als würde er über allem stehen. Es war ganz selbstverständlich, dass meine Mutter ihm von unserem Brot gab. War meine Schwester im Haus, verlangte er, dass sie ihm das Essen reichte. Während sie ihn bediente, hafteten seine Blicke auf ihrem Körper. Er sprach sie nie direkt an, sondern fragte unseren Vater, ob es nicht an der Zeit wäre, einen Mann für sie zu finden. Er sprach von ihren Vorzügen, als wolle er ein Stück Vieh zum Verkauf anbieten. Ich hatte es Katharina angesehen, wie unwohl sie sich neben ihm fühlte.
Der Ortsvorsteher Bernhard Schilling war nicht besser. Er war der Freund, den man brauchte, wenn man nicht in der Lage war, die Abgaben des Grafen zu zahlen. Er lieh dir die Abgaben. Gegen einen hohen Zinssatz gewährte er dir Zeit. Als Absicherung musstest du ihm nur dein Hab und Gut abtreten. Aber was sollten die Menschen machen? – wenn die Ernte keinen Ertrag brachte und das Geld kaum für das Nötigste reichte. Als ich damals Röhrenfurth verließ, stand auch mein Vater in seiner Schuld, eine Schuld, die nach dem Tod meines Vaters auf meinen Bruder, den Erben der Schmiede, übergegangen war.
Pater Josef dagegen war durch und durch ein Mann Gottes. So lange ich mich erinnere, war er der Pfarrer im Ort gewesen. Er hatte Peter, Katharina und auch mich getauft. Er war alt geworden. Aber ich glaube, es war nicht der Glaube an das Böse, der ihn um Jahre hatte altern lassen. Es war einfach nur die Zeit gewesen.
Eckert Frei führte uns in den Ratssaal. Pater Josef und Bernhard Schilling folgten uns. Der Landesvogt ging mehrere Schritte voraus, aber nur für einen kurzen Augenblick, dann hatte Bartholomeus ihn eingeholt. Auf mich wirkte es, als wollte Bartholomeus dem Landesvogt zeigen, wer hier die wichtigste Person war. Ich weiß, dass Bartholomeus das Benehmen des Landesvogts nicht guthieß. Beide erreichten ihr Ziel gemeinsam. Jedoch war es Eckert Frei, der uns mit großer Geste die Tür öffnen durfte.
Für eine kleine Stadt war der Raum erstaunlich pompös ausgestattet. Die Wände waren mit Malereien verziert und mit dunklem Holz vertäfelt. Es standen ein großer, mit Schnitzereien verzierter Eichentisch und zwölf passende Stühle im Raum. Auf dem Tisch waren Speisen angerichtet. Speisen, deren Duft mir meinen Hunger zeigten. Doch noch bevor wir mit der Mahlzeit begannen, eröffnete Bartholomeus ohne Umschweife das Gespräch. „In Eurem Schreiben bekundet Ihr, dass Ihr bereits eine Hexe in Gewahrsam genommen habt.“ Er setzte sich an die Stirnseite des Tisches.
„Ja, eine Heilerin. Kungundt die Weise, wie sie genannt wird“, bestätigte Eckert Frei. In seiner Stimme konnte man den Stolz auf seinen Ermittlungserfolg erkennen. Er setzte sich an Bartholomeus’ Seite.
Ich stellte die Frage, welche Anklage man gegen Kungundt ausgesprochen hatte. Aber der warnende Blick meines Meisters sagte mir, dass ich mich lieber im Hintergrund halten sollte. Noch ehe Eckert Frei oder einer der anderen auf meine Frage antworten konnte, wiederholte Bartholomeus diese.
Es wurde ihr die Opferung der Bäuerin Lotte und ihres ungeborenen Sohnes vorgeworfen. Eberhart, ihr angetrauter Mann, und seine Mutter waren als Zeugen benannt. Es wurde ihr vorgeworfen, durch das Opfer von menschlichem Leben dem Teufel gehuldigt und zusammen mit Luzifer den Schwarzen Tod in Röhrenfurth willkommen geheißen zu haben, erklärte Eckert Frei die Anklage.





























