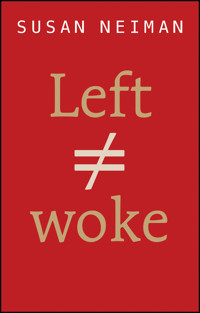Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die streitlustige Kritik einer überzeugten Linken an Identitätspolitik. „Susan Neimans klares Denken und ihre pfeilgenaue Sprache sind Rettung und Genuss.“ (Eva Menasse) Seit sie denken kann, ist Susan Neiman erklärte Linke. Doch seit wann ist die Linke woke? In ihrer von Leidenschaft und Witz befeuerten Streitschrift untersucht sie, wie zeitgenössische Stimmen, die sich als links bezeichnen, ausgerechnet die Überzeugungen aufgegeben haben, die für den linken Standpunkt entscheidend sind: ein Bekenntnis zum Universalismus, der Glaube an die Möglichkeit des Fortschritts und die klare Unterscheidung zwischen Macht und Gerechtigkeit. Als Philosophin überprüft sie dabei die identitätspolitische Kritik an der Aufklärung als rassistisch, kolonialistisch, eurozentristisch und stellt fest: Die heutige Linke beraubt sich selbst der Konzepte, die für den Widerstand gegen den weltweiten Rechtsruck dringend gebraucht werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die streitlustige Kritik einer überzeugten Linken an Identitätspolitik. »Susan Neimans klares Denken und ihre pfeilgenaue Sprache sind Rettung und Genuss.« (Eva Menasse)Seit sie denken kann, ist Susan Neiman erklärte Linke. Doch seit wann ist die Linke woke? In ihrer von Leidenschaft und Witz befeuerten Streitschrift untersucht sie, wie zeitgenössische Stimmen, die sich als links bezeichnen, ausgerechnet die Überzeugungen aufgegeben haben, die für den linken Standpunkt entscheidend sind: ein Bekenntnis zum Universalismus, der Glaube an die Möglichkeit des Fortschritts und die klare Unterscheidung zwischen Macht und Gerechtigkeit. Als Philosophin überprüft sie dabei die identitätspolitische Kritik an der Aufklärung als rassistisch, kolonialistisch, eurozentristisch und stellt fest: Die heutige Linke beraubt sich selbst der Konzepte, die für den Widerstand gegen den weltweiten Rechtsruck dringend gebraucht werden.
Susan Neiman
Links ≠woke
Aus dem Englischen von Christiana Goldmann
Hanser Berlin
Einleitung
Was dieses Buch nicht enthält: Tiraden gegen Cancel Culture oder Aufrufe zu Überparteilichkeit. Genauso wenig werde ich von der liberalen Tugend sprechen, sich um Verständnis für diejenigen zu bemühen, die unsere Ansichten nicht teilen, obwohl ich das eindeutig für eine Tugend halte. Doch verstehe ich mich nicht als Liberale. In Europa redet man gern von linksliberalen Werten, um das bedenkliche Wort »links« zu entkräften, zu dem ich weiterhin stehe. Meine Loyalität war von jeher parteiisch: Aufgewachsen bin ich in Georgia, während der Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung, und habe mich danach immer weiter nach links bewegt. Heute, wo selbst das Wort »liberal« in Amerika als Schimpfwort gebraucht wird, vergisst man leicht, dass es selbst dort einst Menschen gab, die sich ohne weiteres Sozialisten nannten. Anfang des Kalten Krieges schrieb kein Geringerer als Albert Einstein eine stolze Verteidigung des Sozialismus. Das würden heute immer weniger Menschen tun. Doch wie Einstein und viele andere lasse ich mich gerne eine Linke und Sozialistin nennen.
Von den Liberalen unterscheidet sich die Linke darin, dass sie nicht allein die politischen Rechte hochhält, die uns Rede-, Religions-, Bewegungs- und Wahlfreiheit sichern, sondern auch die sozialen Rechte reklamiert, die eine reale Ausübung dieser politischen Rechte erst garantieren. Liberale Autoren sprechen von »Ansprüchen« oder »sozialer Sicherung«. Solche Begriffe lassen es so aussehen, als wären faire Arbeitsbedingungen, Bildung, Gesundheitsfürsorge und Wohnen Fragen der Wohltätigkeit und nicht der Gerechtigkeit. Dabei sind diese und andere soziale Rechte auf faire Arbeitsbedingungen, Bildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnen und Teilnahme am kulturellen Leben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten, die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Die meisten Mitgliedstaaten haben dieses Dokument unterzeichnet, und doch hat bislang keiner dieser Staaten eine Gesellschaft geschaffen, die all diese Rechte sicherstellt — die Erklärung ist rechtlich nicht bindend. Mag das Dokument auch in sagenhafte 530 Sprachen übersetzt worden sein, mehr als einen Anspruch formuliert die Erklärung nicht. Linkssein heißt, darauf zu bestehen, dass diese Ansprüche nicht utopisch bleiben.
»Sich schrittweise durch die Veränderung des Rechts-, Fiskal- und Sozialsystems in diesem oder jenem Land auf den partizipatorischen Sozialismus zuzubewegen, ist durchaus möglich. Wir brauchen nicht auf die Einstimmigkeit des Planeten zu warten«, schreibt der Ökonom Thomas Piketty.1 Es reiche, die Steuern auf einen Satz zu erhöhen, der unter dem läge, den die Vereinigten Staaten und Großbritannien in der Ära des größten Wirtschaftswachstums nach dem Krieg erhoben haben. Piketty kommt zu dem Schluss, dass gerade die Desillusionierung über ökonomische und soziale Gerechtigkeit Identitätskonflikte auslöse.2 Es geht in diesem Buch auch nicht darum, dass sich die Linke mehr um ökonomische als um andere Formen der Ungleichheit kümmern sollte. Ich halte das zwar tatsächlich für richtig, aber dafür sind schon hinreichend Lanzen gebrochen worden. Mich beschäftigt vielmehr, warum sich sogenannte linke Stimmen der Gegenwart von philosophischen Ideen verabschiedet haben, die für den linken Standpunkt von zentraler Bedeutung sind: ein Bekenntnis zum Universalismus statt zum Stammesdenken, eine klare Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit und Macht und die Überzeugung, dass Fortschritt möglich ist. All diese Ideen sind miteinander verbunden.
Aber sie werden im heutigen Diskurs kaum noch erwähnt. Das hat recht viele meiner über die Welt verstreuten Freunde zu dem bitteren Schluss kommen lassen, sie gehörten nicht mehr zu den Linken. Auch wenn sie sich ihr Leben lang für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben, finden sie die Entwicklungen auf Seiten der sogenannten woken Linken oder radikalen Linken äußerst befremdlich. Ich bin dennoch nicht bereit, das Wort »links« aufzugeben oder mich der Meinung anzuschließen, man sei entweder woke oder reaktionär. Stattdessen möchte ich untersuchen, wie die selbsternannte Linke von heute Kerngedanken hat fallenlassen, an denen jeder Linke festhalten sollte.
In einer Zeit, in der auf allen Kontinenten antidemokratische und nationalistische Bewegungen wachsen, stehen wir da nicht vor drängenderen Problemen als dem, die Theorie zu klären? Eine Kritik an denen, die vermeintlich die gleichen Werte teilen, könnte narzisstisch klingen. Doch sind es wahrlich keine kleinen Unterschiede, die mich von denen trennen, die sich für woke halten. Die Differenzen betreffen nicht bloß Stil und Ton, sie treffen ins Herz dessen, was es heißt, links zu sein. Die größere Gefahr mag von den Rechten ausgehen, doch die Linken von heute haben sich selbst der Ideen beraubt, die wir unbedingt brauchen, um dem allgemeinen Rechtsruck zu widerstehen.
Die Verschiebung nach rechts findet international statt und ist gut organisiert. In Bangalore, Budapest und anderswo kommen rechte Nationalisten regelmäßig zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und Strategien abzusprechen, auch wenn jede Nation dabei ihre Zivilisation für die höhere hält. Die Solidarität unter den Rechten zeigt, dass nationalistische Überzeugungen nur am Rande auf der Idee fußen, Ungarn/Norweger/Juden/Deutsche/Angelsachsen/Hindus seien der beste aller möglichen Stämme. Was sie eint, ist vielmehr das Prinzip des Stammesdenkens selbst: Echte Verbindungen entstehen nur zwischen Menschen gleicher Stämme, folglich haben wir keine tiefen Verpflichtungen gegenüber anderen. Es ist mehr als ironisch, dass die Stammesdenker von heute besser kooperieren als diejenigen, deren Engagement sich, ob sie es nun wissen oder nicht, aus dem Universalismus speist.
Woke bezeichnet keine eigentliche Bewegung. Der Ausdruck stay woke ist zum ersten Mal 1938 in dem Lied Scottsboro Boys des großen Bluesmusikers Leadbelly belegt. Gewidmet war es neun schwarzen Teenagern, deren Hinrichtung wegen Vergewaltigungen, die sie nie begangen hatten, erst durch jahrelange internationale Proteste verhindert werden konnte. Wach bleiben für Ungerechtigkeit, wachsam für Anzeichen von Diskriminierung, was sollte daran falsch sein? Doch innerhalb weniger Jahre wandelte sich der Begriff woke vom Lobes- zum Schmähwort. Was ist da geschehen?
Von Ron DeSantis bis zu Rishi Sunak und Éric Zemmour ist woke zu einem Schlachtruf geworden, der zum Kampf gegen alle Antirassisten aufruft, ähnlich wie der Begriff Identitätspolitik ein paar Jahre früher umgekrempelt worden ist. Dennoch liegt die Schuld nicht allein bei den Rechten. Barbara Smith, Gründungsmitglied des Combahee River Collective und Schöpferin des Begriffs, betont, dass Identitätspolitik inzwischen auf eine Weise gebraucht wird, die nie beabsichtigt worden ist. »Es bedeutet absolut nicht, dass wir nur mit Menschen zusammenarbeiten würden, die so sind wie wir. Unser Credo ist es, mit Menschen ganz diverser Identitäten an gemeinsamen Problemen zu arbeiten.«3
Man könnte dennoch auf die Idee kommen, schon in den ursprünglichen Absichten habe der Keim zum Missbrauch gelegen. Dass aber weder die Wörter Identitätspolitik noch woke Politik mit der notwendigen Nuanciertheit eingesetzt wurden, ist offensichtlich Beide führten zu Entfremdungen, die sich die Rechten schnell zu Nutze machten. Universitäten und Unternehmen neigen eher dazu, woke Tendenzen zu eskalieren als Aktivisten, die vor Ort arbeiten. Der schlimmste Missbrauch geht vom woken Kapitalismus aus, der die Forderung nach Vielfalt zum Zwecke der Profitsteigerung gekapert hat. Der Historiker Touré Reed hält diesen Vorgang für wohlkalkuliert: Unternehmen glauben, dass Schwarze einzustellen ihnen Zugang zu deren Märkten verschafft.4 Oft geschieht eine solche Vereinnahmung direkt und unverhohlen. McKinseys Bericht für die Filmindustrie erklärt: »Die Industrie konnte durch die Thematisierung der anhaltenden rassistischen Ungerechtigkeit jährlich 10 Milliarden Dollar zusätzlich an Gewinn machen — etwa sieben Prozent mehr als der geschätzte Ausgangswert von 148 Milliarden Dollar.«5 Selbst abgesehen von der kruden Ausbeutung dessen, was mit fortschrittlichen Zielen begonnen hat, ist woke vielfach zur Symbolpolitik geworden, anstatt sozialen Wandel einzuleiten. Woker Kapitalismus war das dominierende Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2020, zugleich wurde der Eröffnungsredner Donald Trump mit stehenden Ovationen begrüßt.6 Der Umstand, dass rechte Politiker das Wort woke verächtlich ausspucken, sollte uns nicht davon abhalten, es zu untersuchen.
Kann man woke definieren? Es beginnt bei der Sorge um ausgegrenzte Menschen und endet bei ihrer bloßen Reduktion auf das Ausgegrenztsein. Mit dem Gedanken der Intersektionalität hätte deutlich gemacht werden können, inwiefern wir schließlich alle mehr als eine Identität haben. Stattdessen führte er dazu, sich ausschließlich auf die Identitäten zu konzentrieren, die die stärkste Ausgrenzung erfahren, und sie zu einem Wald aus Traumata zu verdichten.
Woke hebt hervor, in welcher Weise die Rechte einzelner Gruppen beschnitten worden sind, versucht hier Abhilfe zu schaffen und Wiedergutmachung zu leisten. Doch wenn vor allem Machtungleichgewichte im Fokus stehen, bleibt die Idee von Gerechtigkeit oft auf der Strecke.
Die Woke-Bewegung fordert Nationen und Völker dazu auf, sich mit den Verbrechen in ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Oft wird aber daraus geschlossen, dass die Geschichte aus nichts als Verbrechen besteht.
Das Verwirrende an der Woke-Bewegung ist, dass sie von Empfindungen angetrieben wird, die traditionell bei der Linken zu finden sind: Mitgefühl für die Ausgegrenzten, Empörung über die Misere der Unterdrückten, die feste Überzeugung, dass historisches Unrecht wiedergutzumachen ist. Doch diese Empfindungen sind durch eine Reihe theoretischer Annahmen so aus der Spur geraten, dass sie schließlich ausgehöhlt werden. Theorie ist ein derart modischer Begriff, dass er sogar zum Namen einer Modemarke geworden ist. Das Wort mag heute keinen klaren Gehalt mehr haben, aber es hat eine Richtung. Was unterschiedlichste intellektuelle Bewegungen mit dem Wort Theorie verbinden ist die Ablehnung des erkenntnistheoretischen Begriffsrahmens und der politischen Annahmen, die das Erbe der Aufklärung waren. Man muss nicht Jahre damit zubringen, Judith Butler oder Homi Bhabha zu entschlüsseln, um von Theorie beeinflusst zu sein. Nur selten bemerken wir überhaupt die inzwischen in die Kultur eingebetteten Annahmen, denn sie werden meistens als selbstverständliche Wahrheiten betrachtet. Da sie als schlichte Beschreibungen der Wirklichkeit auftreten und nicht als Ideen, die wir in Frage stellen können, lassen sie sich nur schwer direkt anzweifeln. Wer im Studium gelernt hat, allen Wahrheitsansprüchen zu misstrauen, wird zögern, eine Falschheit anzuerkennen.
Ein guter Ort, um damit anzufangen, ist die New York Times, denn sie gibt in mehr als einem Land den Ton an. Zwar steht sie wie seit jeher für den neoliberalen Mainstream, doch seit 2019 ist sie zunehmend und demonstrativ woke geworden. Diese Entwicklung hat nicht nur zu dem umstrittenen Projekt 1619 geführt, sondern auch zu einem wirklichen Fortschritt, der sich vor allem darin zeigt, dass die Stimmen und Gesichter schwarzer und brauner Menschen öfter vertreten sind. Doch was machen wir mit diesem 2021 gedruckten Satz? »Trotz der indischen Wurzeln von Vizepräsidentin Kamala D. Harris könnte die Regierung Biden mit Modis hindu-nationalistischem Programm zunehmend weniger Nachsicht üben.« Wer den Satz zu schnell liest, dem entgeht die krasse theoretische These: Politische Ansichten hängen von der ethnischen Herkunft ab. Wer nichts über das heutige Indien weiß, weiß vermutlich auch nicht, dass die schärfsten Kritiker von Modis rabiatem Hinduzentrismus selbst Inder sind. Die mutigsten unter ihnen sprechen von Faschismus.
Etwa zur gleichen Zeit wunderten sich viele amerikanische Medien über ein überraschendes Detail der Präsidentschaftswahlen von 2020. In seiner ganzen Regierungszeit war Donald Trumps Rassismus gegenüber Schwarzen und Latinos unverkennbar, dennoch erhielt er mehr Stimmen aus dieser Gruppe als vier Jahre zuvor. Statt einmal kurz in Frage zu stellen, ob Demographie wirklich Schicksal ist, beeilten die Journalisten sich, uns das Rätsel damit zu erklären, dass die Gemeinschaften der Latinos recht verschieden seien: Puerto-Ricaner seien nun einmal keine Kubaner, Mexikaner keine Venezolaner. Jede Gemeinschaft habe ihre Geschichte, ihre eigene Kultur und eigene Interessen und müsse als solche respektiert werden. Sieht man einmal davon ab, dass dies kaum den Anstieg der Stimmen aus der afroamerikanischen Wählerschaft erklärt, wird die Zerlegung von Stämmen in Unterstämme uns nicht weiterbringen. Menschen sind verschieden. Weder schwarze noch weiße noch braune Gemeinschaften sind homogen. Wir handeln oft aus Gründen, die nichts mit unserer Stammeszugehörigkeit zu tun haben.
Obwohl sie von progressiven Medien geäußert werden, unterscheiden sich solche Unterstellungen nicht sehr von denen, die Donald Trumps Praxis bestimmten: die Ernennung eines Neurochirurgen zum Direktor des Amts für Stadtentwicklung, weil er schwarz ist; die Betrauung seines untauglichen Schwiegersohnes mit einer der weltweit heikelsten außenpolitischen Aufgaben, weil er Jude ist; die Berufung einer erzreaktionären Katholikin als Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg, weil sie eine Frau ist; die Entsendung einer diplomatischen Katastrophe auf den Botschafterposten in Deutschland, weil er schwul ist. Die Tatsache, dass Berlin schon fast ein Jahrhundert lang eine schwulenfreundliche Stadt ist, hinderte ihre Bewohner nicht daran, sich undiplomatisch entsetzt über die unzähligen politischen Fettnäpfchen zu zeigen, in die Richard Grenell trat. Liz Truss’ kurze Amtszeit ist nur das jüngste Beispiel für einen solchen Kurs: die Ernennung eines beispiellos diversen Kabinetts, das die konservativste Politik der jüngsten britischen Geschichte vertreten hat. Die Feigenblätter waren nicht groß genug, um diese Schande zu verdecken.
Was ist nun wesentlicher: die Zufälle unserer Geburt oder die Prinzipien, die wir beurteilen und vertreten? Traditionell kaprizierte sich die Rechte auf das Erste, während die Linke das Zweite betonte. Das kehrt sich um, wenn eine liberale Politikerin wie Hillary Clinton der Wahl der ersten weiblichen Premierministerin in Italien als »Bruch mit der Vergangenheit« Beifall zollt und dabei ignoriert, dass Giorgia Meloni der faschistischen Vergangenheit Italiens näher steht als jeder andere Regierungschef seit dem Krieg. Es ist kein Wunder, dass die Theorien, die die Woken beflügeln, ihre mitfühlenden Einstellungen und emanzipatorischen Absichten untergraben. Denn diese Theorien wurzeln nicht nur tief im Reaktionären, einige ihrer Autoren waren waschechte Nazis.
Eine Reihe wissenschaftlicher Studien beschäftigt sich damit, wie eng die philosophische Arbeit von Carl Schmitt und Martin Heidegger mit ihrer Parteizugehörigkeit verwoben war, aber hier ist nicht der Ort, einen Weg durch diese Textfluten zu bahnen. Ein Großteil der Literatur ist von der Sorte »ja, aber«, wobei das »aber« anzeigt, dass der fragliche Denker nicht jeden Satz der Naziideologie unterschrieben hat oder gelegentlich leise Kritik übte oder früh aus der Partei ausgetreten ist. Andere steigen in komplexe Begriffsanalysen ein und erklären, dass ein wichtiger Teil ihres Denkens unvereinbar mit dem Nazismus sei. Die Komplexität verfolgt den Zweck, die Empörung zu beschwichtigen, als könnte nur philosophische Seichtheit Entrüstung hervorbringen. Die Tatsache, dass beide Männer sich nicht nur in den Dienst der Nazis gestellt haben, sondern dies auch noch viele Jahre nach dem Krieg rechtfertigten, ist ein alter Hut. Was die Gemüter hingegen heute erhitzt, sind rassistische Äußerungen in der Philosophie des 18. Jahrhunderts.
Wie immer man die Beziehung zwischen ihrer jeweiligen Philosophie und ihren politischen Überzeugungen deutet, so viel ist sicher: Schmitt lehnte den Universalismus und jede Vorstellung von Gerechtigkeit ab, die über den Begriff von Macht hinausgeht, und Heideggers Antimodernismus und Glorifizierung bäuerlicher Tugenden waren beherrschender und tiefer verwurzelt als irgendeine andere seiner Überzeugungen. Diese philosophischen Haltungen beeinflussten zweifellos ihre Entscheidung, sich den Nazis anzuschließen, ebenso wie ihre Weigerung, diese Entscheidung nach dem Krieg zu verurteilen.
Angesichts dessen ist es erstaunlich, dass Leute, die sich mit dem Kolonialismus auseinandersetzen, Schmitt studieren oder dass Philosophen, die für Arbeiterrechte kämpfen, davon reden, Heidegger gegen den Strich zu lesen. Tatsächlich haben viele der theoretischen Annahmen, auf die sich die bewundernswertesten Impulse der Woken stützen, ihren Ursprung in der intellektuellen Bewegung, die sie zutiefst verabscheuen. Die besten Grundsätze der Woken, wie etwa die Forderung, die Welt nicht nur aus einer einzigen geographischen Perspektive zu betrachten, stammen direkt aus der Aufklärung. Doch die heutige Ablehnung der Aufklärung geht meist Hand in Hand mit der Unkenntnis ihrer Thesen. Dieses Buch habe ich in der Hoffnung geschrieben, dass Philosophie die Verwirrungen auflösen kann, die von der Theorie gestiftet wurden — und dabei zugleich unsere politische Praxis stärkt. Es gibt keine Hoffnung auf Fortschritt, wenn man den Ast absägt, auf dem man sitzt — auch wenn man es nicht weiß.
Dies ist kein akademisches Buch. Ich bin mir durchaus bewusst, dass zu den meisten der hier behandelten Fragen viele Bände geschrieben worden sind. Keine der Untersuchungen, die ich hier anstelle, ist erschöpfend. In einer akademischen Arbeit würde man meine Thesen zu Foucault, zu Schmitt oder zur Evolutionspsychologie noch weiter ausdifferenzieren. Aber mir geht es nicht darum, die bestmögliche Interpretation dieser und anderer Denker vorzulegen. Was ich verstehen will, ist ihr Einfluss auf die gegenwärtige Kultur. Dass es Lesarten gibt, die eine wohlwollendere Interpretation ihres Denkens liefern, bezweifle ich nicht. Manche davon habe ich gelesen. Gerade weil sie kompliziert und kontraintuitiv sind, handelt es sich nicht um die Lesarten, die häufig rezipiert werden. Ist denn gute Philosophie nicht oft kompliziert und kontraintuitiv? Manchmal gewiss. Aber wenn nicht einmal ein Doktorstudium ausreicht, um einen Text zu verstehen, ist es nur schwer vorstellbar, dass solche theoretischen Werke so befreiend sind wie ihre Absichten. Die Adepten der Theorie unterscheiden sich von den Denkern der Aufklärung wohl vor allem darin, dass diese nicht bloß für ein kleines, ausgewähltes Publikum schreiben wollten. Ihre Schriften waren klar, frei von Jargon und wollten eine möglichst große Leserschaft erreichen. (Selbst Kant, der schwierigste der Aufklärungsphilosophen, hat fünfzehn lesbare Aufsätze für das allgemeine Publikum verfasst.) Ich gebe mir Mühe, ihrem Beispiel zu folgen.
Universalismus und Stammesdenken
Beginnen wir mit der Idee des Universalismus, der einst für die Linke bestimmend war: »Internationale Solidarität« war ihre Parole. Genau das unterschied sie von der Rechten, die weder Verbindungen noch Verpflichtungen gegenüber denen anerkannte, die nicht zu ihrem Kreis gehörten. Die Linke bestand darauf, dass ihr Kreis die ganze Welt einschloss. Links sein, das hieß: die streikenden Bergarbeiter in Wales, die Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg oder die Freiheitskämpfer in Südafrika zu unterstützen. Ob sie nun dem eigenen Stamm angehörten oder nicht. Das verbindende Glied zwischen uns sollten nicht Blutsbande sein, sondern gemeinsame Überzeugungen — vor allem und besonders die Überzeugung, dass wir Menschen, trotz aller trennenden Unterschiede in Raum und Zeit, im Grunde auf vielfältige Weise eins sind. Die Feststellung, dass unsere Geschichte und unsere Geographie uns beeinflussen, ist trivial. Die Ansicht, dass sie uns bestimmen, ist falsch.
Wer würde bezweifeln, dass gemeinsame Erfahrungen besondere Bande zwischen uns stiften? Wir neigen alle dazu, eher den Menschen zu vertrauen, deren Codes wir nicht mühsam entziffern müssen, deren Witze wir sofort verstehen, deren Anspielungen uns nicht entgehen. Wer Universalist sein möchte, muss eine Abstraktion vollziehen. Durch das Erlernen von Sprachen, das Eintauchen in andere Kulturen wird die Abstraktion konkreter, auch wenn nicht jeder so begabt darin ist wie der große Künstler und Aktivist Paul Robeson. Doch auch ohne diese Begabungen gibt es viele Möglichkeiten, andere Kulturen kennenzulernen — auch wenn wir dort nie ganz zu Hause sind. Wir werden nie dieselbe Beziehung zu einer Kultur haben wie diejenigen, die von ihren Wiegenliedern in den Schlaf gelullt wurden. Dennoch: Gute Literatur, Filme und Kunstwerke können Wunder wirken.
Das Gegenstück zum Universalismus wird oft als identitäre Bewegung bezeichnet. Der Ausdruck führt jedoch in die Irre, denn er suggeriert, unsere Identitäten ließen sich auf höchstens zwei Größen herunterbrechen. Tatsächlich besitzen wir alle eine Vielzahl von Identitäten, denen, je nachdem, wo wir gerade im Leben stehen, ganz verschiedene Bedeutungen zukommen. Wie der Philosoph Kwame Anthony Appiah uns erinnert:
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hätte niemand, der nach der Identität eines Menschen fragte, die Kategorien race, Gender, Nationalität, Region oder Religion erwähnt.7
Sobald wir unsere eigenen Kinder großziehen, verliert die Tatsache, dass wir alle irgendjemandes Kind sind, schnell an Bedeutung. Doch wir brauchen nur das Haus unserer Eltern zu betreten, um sofort in die Zeit zurückzufallen, in der wir vor allem »Kind« waren. Wenn wir morgens unseren Liebhaber verlassen und in die berufliche Rolle an unserem Arbeitsplatz schlüpfen, hat sich unsere Identität abermals verändert. Ist nun eine dieser Identitäten wichtiger als die anderen? Immer und überall? Solche Identitätsverschiebungen sind ziemlich universell, und es gibt noch viel mehr Beispiele. Eine politisch aktive Person kann sich nicht vorstellen, dass Politik sie je kaltlassen könnte. Ein leidenschaftlicher Fußballfan kann sich seine Identität nicht unabhängig von seiner Treue zu einem Verein vorstellen. Nicht jeder identifiziert sich mit der Tätigkeit, die ihm seinen Lebensunterhalt sichert, doch wer es tut, für den wäre die Vorstellung, einen ganz anderen Beruf auszuüben, undenkbar. Er könnte sich nicht mehr als der, der er ist, vorstellen.
Je nach Persönlichkeit wären diese Identitäten mindestens genauso bedeutsam wie die zwei, von denen die Identitätspolitik meint, sie seien zentral: die Zugehörigkeit zu einer Ethnie und zu einem Geschlecht. Es bedarf keines langen Nachdenkens, um zu erkennen, dass selbst diese beiden weniger determiniert sind, als man annimmt. Wie Chimamanda Ngozi Adichie uns in ihrem Roman Americanah so brillant vor Augen geführt hat, lebt es sich als schwarzer Mensch in Nigeria dramatisch anders als in Amerika. Und Nigerianer zu sein ist nur außerhalb des Landes eine Identitätszuschreibung; in einem Land, dessen Bürger durch eine bewegte Geschichte und mehr als fünfhundert Sprachen getrennt sind, bedeutet die Bezeichnung nichts. Ein Leben als Jüdin in Berlin und als Jüdin in Brooklyn ist mit so grundverschiedenen Erfahrungen verknüpft, dass sich zwei verschiedene Identitäten herausbilden. Ich weiß, wovon ich rede. Ein Jude in Tel Aviv hat ebenfalls seine eigene Identität. Doch ein Jude, der dort geboren ist, nimmt eine andere Stellung in der Welt ein als ein Jude, der erst in späteren Lebensjahren dorthin gezogen ist. Gibt es eine Identität als Inder, die für Brahmanen und Dalits, Hindus und Muslime gleichermaßen gilt? Kann man jemandem die Identität »schwul« zuweisen, ohne zugleich zu erwähnen, ob er in Teheran oder in Toledo wohnt? Der Historiker Benjamin Zachariah bemerkt dazu:
Früher einmal galt es als anstößig, ziemlich dumm, antiliberal und fortschrittsfeindlich, anderen Menschen Essenzen zuzusprechen. Doch heute ist es nur verwerflich, wenn andere es tun. Sich selbst zu essentialisieren oder sich Stereotype beizumessen gilt nicht nur als erlaubt, sondern als Selbstermächtigung.8
Wer noch vor zwei Jahrzehnten sämtliche Essentialisierungen strikt verworfen hat, gibt sich nun damit zufrieden, alle Elemente unserer Identität auf zwei zurückzusetzen. Die jüngsten Anstrengungen für mehr Diversität betonen oft, wie wichtig es sei, Führungspositionen mit Leuten zu besetzen, die »aussehen wie ich«. Ein bemerkenswert kindlicher Ausdruck, aber was sehen Kinder tatsächlich? Menschen, deren Wurzeln (zumindest teilweise) in Afrika liegen, können eine große Bandbreite von Hauttönen und Haarstrukturen haben, und weder der Farbton der Haut noch die Struktur des Haares sind die einzigen optischen Eigenschaften, die wir wahrnehmen. Ein Kind, das gesagt bekommt, jemand »sehe wie es aus«, könnte ebenso gut fragen: Ist er größer oder kleiner? Dicker oder dünner? Älter oder jünger? Und wie sieht es mit dem Geschlecht aus?
Dass optische Eigenschaften wichtig sind, wird niemand bezweifeln. In meiner Kindheit galt in Amerika nur als attraktiv, wer nicht nur weiß, sondern auch blond war. Auf wen das nicht zutraf, der atmete erst auf, als Barbra Streisand die Bühne betrat, und erst recht, als der Scheinwerfer auf Angela Davis fiel. So verschieden sie waren, waren beide schön, und keine sah aus wie Marilyn Monroe. Die Woke-Bewegung hat uns bewusst gemacht, dass weiß gerade nicht als eine Identität betrachtet wurde, sondern als ein Mittelding zwischen Norm und Neutralität, so wie Malkreiden mit der Angabe Hautfarbe suggerierten, dass Haut immer pastellrosa ist. Diversität ist ein Gut, aber eben nicht das einzige. Ich bin nicht die Erste, die darauf hinweist, dass die Diversifizierung von Machtstrukturen schnell zu noch stärkeren Repressionssystemen führen kann, sofern man nicht hinterfragt, wie und wofür die Macht eingesetzt wird. Es ist auch nicht damit getan, wenn konservative Regierungen die ehemals Ausgegrenzten ins Kabinett berufen. Auf Anregung von Ian Malcolm fragte der kanadische Komiker Ryan Long eine Reihe von Passanten, ob sie nicht auch der Meinung seien, Verhörspezialisten — so nennt die CIA ihre Folterer — sollten diverser werden. Die Tatsache, dass man ihn ernst nahm, ist alles andere als lustig.9
Die Reduktion unserer vielen Identitäten auf Ethnie und Geschlecht ist nur augenscheinlich eine Frage von Äußerlichkeiten. Indem man den Fokus auf genau diese beiden Dimensionen menschlicher Erfahrung legt, erfasst man die Eigenschaften, die die meisten Traumata mit sich bringen. Die Identitätspolitik hängt mit einer Verschiebung zusammen, die Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzte: Nicht mehr der Held war das Subjekt der Geschichte, sondern das Opfer.10 Zwei Weltkriege haben uns den Drang ausgetrieben, überkommenen Formen des Heldentums zu huldigen. Zunächst war der Impuls, die Opfer der Geschichte in den Blick zu nehmen, ein Streben nach Gerechtigkeit. Bisher war die Geschichte stets eine der Sieger gewesen, während die Stimmen der Opfer ungehört blieben. Sie wurden so zweifach ausgelöscht: in Fleisch und Blut und in der Erinnerung. Um geschehenes Unrecht wiedergutzumachen, sollte der Spieß umgedreht werden und die Geschichten der Opfer in das Narrativ einfließen. Wenn ihre Geschichten unsere Aufmerksamkeit erringen, dann können die Opfer auch ihren Anspruch auf unser Mitgefühl und auf Gerechtigkeit geltend machen. Als Sklaven damit begannen, ihre Erinnerungen niederzuschreiben, gewannen sie mit diesem Schritt Subjektivität und Beachtung — und damit langsam, aber sicher Anerkennung.
Am Anfang dieser Entwicklung standen also die besten Absichten. Sie sprach laut aus, dass Macht und Recht nicht immer zusammenfallen, dass unterschiedlichsten Menschen übelste Dinge geschehen und dass wir, wenn wir es schon nicht ändern können, wenigstens verpflichtet sind, es zu bezeugen. Verglichen mit den vorangegangenen Jahrtausenden, in denen die Überlebenden eines Gemetzels, sei es durch die Hand römischer Legionäre oder mongolischer Invasoren, nicht mehr als ein lakonisches »Schade« erwarten durften, war dies ein Schritt vorwärts. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen, als wir den Stellenwert der Opfer neu bestimmten. Was als Empathie begann, schlug geradezu ins Krankhafte um. Die Geschichte des Schweizers Binjamin Wilkomirski stellt den Extremfall dieser Tendenz dar. Er behauptete, seine Kindheit in einem Konzentrationslager verbracht zu haben, was sich als freie Erfindung herausstellte. Früher versuchten Schurken, ihre schwierige Herkunft zu verbergen, und dichteten sich einen adeligen Stammbaum an, um auf der sozialen Leiter aufzusteigen. Theoretisch konnte jeder der Sohn eines fahrenden Ritters oder eines lüsternen Papstes sein. Dieses Gütesiegel ist heute einem anderen gewichen: Unter vermeintlich elenden Bedingungen geboren worden zu sein, garantiert neue Formen von Status.
Wilkomirski war kein Einzelfall. Um rassistischer Diskriminierung zu entkommen, gaben sich hellhäutige Afroamerikaner früher als Weiße aus und verließen ihre Familien, um ein freieres, wenngleich traurigeres Leben in der herrschenden Klasse zu führen. Kürzlich aber verloren mehrere weiße Amerikaner ihre Arbeitsstellen, die sie bekommen hatten, weil sie sich fälschlicherweise als Schwarze ausgegeben hatten. Ein afroamerikanischer Schauspieler erhielt eine Gefängnisstrafe, weil er einen rassistischen Angriff auf sich inszeniert hatte.11 Ein deutsch-jüdischer Popstar zog Aufmerksamkeit und Empörung auf sich, weil er einen antisemitischen Vorfall erfand, den auch die gründlichsten Polizeiermittlungen nicht bestätigen konnten.12 Diese Selbststilisierung zum Opfer ist deshalb so perfide, weil dabei die wahren Opfer rassistischer, tagtäglich vorkommender Angriffe verhöhnt werden. Was mich im Moment noch mehr interessiert, ist die Tatsache, dass Derartiges überhaupt möglich ist. Was kürzlich noch ein Stigma war, verleiht mittlerweile Ansehen