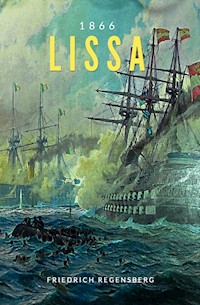
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wieder feuert ein 300-Pfünder, und seine Riesengranate tötet und verwundet auf dem Linienschiff 6 Mann, demontiert ein Deckgeschütz und zerstört den Kompaß und den Maschinentelegraphen. Der "Kaiser" wehrt sich aus Leibeskräften mit seinen 92 Geschützen, indem er dem gefährlichen Gegner in rascher Folge konzentrierte Breitseiten versetzt, und weicht einem vom "Affondatore" versuchten Rammstoß glücklich aus, Als nach einem zweiten, ebenfalls vergeblichen Versuche beide Schiffe dicht aneinander vorübergleiten, beginnen die beiderseits auf Deck aufgestellten Mannschaften ein lebhaftes Gewehrfeuer: Fähnrich Proch stürzt, tödlich getroffen, von der Kreuzmars des "Kaiser" herab; auf dem "Affondatore" wird der Kommandant des vorderen Turmes, Lt. Gregoretti, verwundet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LISSA
1866
von
Friedrich Regensberg
_______
Erstmals erschienen in:
Franck’sche Verlagshandlung W. Keller & Co.,
Stuttgart, 1907
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt-Verlag, Leipzig
ISBN: 978-3-96559-137-0
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Seesieg bei Lissa.
Der Seesieg bei Lissa.
Trafalgar—Lissa—Tsuschima! Diese drei Schlachtennamen bedeuten zugleich Marksteine in der neuzeitlichen Entwicklungsgeschichte der Kriegsmarine und der Seetaktik. In der Schlacht bei Trafalgar (21. Okt. 1805), die noch in die Glanzzeit der Segelschiffsflotten fiel, schlug Nelson die vereinigte französische und spanische Flotte entscheidend und sicherte dadurch Englands unumschränkte Herrschaft über die See. Ein Jahrhundert später fiel dann die eigentliche Entscheidung im ostasiatischen Kriege nicht in der Mandschurei, sondern auf dem Meere, indem die japanische Flotte unter Admiral Togo am 27. und 28. Mai 1905 die russische bei der Insel Tsuschima in der Straße von Korea vernichtete.
In der Zeit zwischen der Schlacht von Trafalgar, die ein Ende machte mit der Draufgängertaktik der Engländer im 18. Jahrhundert, und der größten Seeschlacht der Neuzeit hat sich eine völlige Umgestaltung der Mittel und Waffen des Seekrieges vollzogen durch die Einführung des Dampfes als Motor und den Wettstreit zwischen Panzer und Artillerie. Dieser nahm seinen Anfang, als gegen die Sprenggeschosse von Paixhans’ Bombenkanonen Holzschiffe nicht mehr brauchbar erschienen. 1858 ward die erste Panzerfregatte erbaut; 1861 das erste gepanzerte Turmschiff („Monitor“) im amerikanischen Sezessionskriege, in dem das Zusammenwirken von Heer und Flotte entscheidend gewesen ist, und der zugunsten des Nordens endete, weil diesem schließlich die Seeherrschaft zufiel. Das gewaltige Ringen der Union mit den Konföderierten ist zur See nur ein Küstenkrieg gewesen; schon begegnen wir in ihm aber den neuen Waffen des Seekrieges: Dampfkraft, Panzer und Sporn, Torpedo und Mine, auch das Unterseeboot erscheint, jedoch alles noch in technischen Anfängen.
Sechzig Jahre nach Trafalgar und vierzig Jahre vor Tsuschima wurde die Taktik des modernen Seegefechts geboren, als sich bei Lissa am 20. Juli 1866 zum ersten Mal Panzerschiffe in offener Seeschlacht begegneten. Im Sezessionskriege hatte es die ersten Einzelkämpfe zwischen den neuen Streitwerkzeugen gegeben1: hier erst kam es zu einem Zusammenstoß der gepanzerten Riesen im großen. Wie Erzherzog Albrecht zu Lande mit der Südarmee bei Custoza2 am 24. Juni das an Zahl weit überlegene italienische Heer geschlagen hatte, so führte Held Tegetthoff nun auch Österreichs junge Marine zu einem glorreichen Siege über die ganz erheblich stärkere italienische Flotte.
— — — — — — — — — — — — —
Wie ein riesiger Lugaus entsteigt den blauen Fluten der Adria — ungefähr in der Längenmitte dieses Meeres — das Felseneiland Lissa. Dalmatien ist das südlichste der österreichischen Kronländer, von denen es auch das wärmste Klima besitzt. Seiner Küste sind, neben zahlreichen kleineren Klippen (Scoglien), 20 größere Inseln vorgelagert; die bedeutendsten — in der Richtung von Norden nach Süden — heißen: Arbe, Pago, Brazza (die größte und bevölkertste), Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta und Meleda. Von diesen Eilanden des dalmatinischen Archipels ist am weitesten südwestlich vorgeschoben (weiter in dieser Richtung liegt nur das winzige Busi) der 15 km lange und 8 km breite Felsklumpen Lissa: einen halben Grad südlich von dem am Westufer des Adriatischen Meeres gegenüberliegenden italienischen Kriegshafen Ancona, 70 Seemeilen (à 1852 m) von der italienischen und 30 Seemeilen von der dalmatinischen Küste entfernt. Schroff fallen ringsum seine Küsten zum Meere ab; im Innern herrscht gleichfalls der nackte Felsboden vor, doch gibt es auch fruchtbare Täler.3
Der höchste Punkt und das Wahrzeichen von Lissa (für den Seemann das Peilungsobjekt) ist der mit Fichtenwäldern bedeckte Monte Hum (585 m). Die Insel besitzt mehrere treffliche Häfen: vor allem im Westen die weite Bucht von Comisa und im östlichen Teil der Nordküste den Hafen von San Giorgio, an dem der Hauptort Lissa (4800 Einwohner) liegt. Die einzige wirkliche Straße auf der Insel führt von Lissa durch einen 310 m hohen Pass, an der Maxfeste vorbei, nach Comisa, sonst verbinden nur Saumwege die einzelnen Befestigungen.
Die Eilande an der Küste Dalmatiens hießen bei den Alten die liburnischen Inseln; sie wurden schon früh von Inselgriechen, dann um 380 v. Chr. durch Dionys den Älteren von Syrakus mit Kolonien besetzt. Dieser Tyrann gewann die erste Seeschlacht bei Lissa, wo er mit Hilfe der Lessinaner und Lissaner Schiffe über die Illyrier siegte. Zur Zeit der Römer, an die noch Reste eines antiken Theaters, Thermen usw. erinnern, war Lissa bereits Flottenstation. Die Insel kam dann unter die Herrschaft der Byzantiner und später unter die der Venetianer. Wegen ihrer strategischen Wichtigkeit besetzten sie 1811 die Engländer: sie erbauten das den Eingang zum Hafen von Lissa verteidigende Fort Georg (55 m über dem Meere) und auf beiden Seiten der Bucht die steinernen Defensionstürme Robertson (50 m Seehöhe), Bentink (75 m) und Wellington (190 m). Nachdem die Franzosen Dalmatien besetzt hatten, suchten sie vergeblich die mit ihren Kreuzern die Adria beherrschenden Briten aus diesem Besitz zu vertreiben. Ihr von Dubourdieu befehligtes Geschwader wurde im Treffen bei Lissa am 12. März 1811 von dem englischen unter Kommodore Hoste gänzlich geschlagen. 1815 fiel Österreich das Eiland zu, auf dem nun die bestehenden Befestigungen verstärkt und neue Werke: Batterien und Schanzen, hinzugefügt wurden. Zur Verteidigung des Hafens von S. Giorgio die Batterien Mamula (33 m Seehöhe) und Zupparina (28 m) auf der Landzunge zwischen jenem und der Bucht Karober; ferner die Batterie Schmid (16 m) auf einer vorspringenden Landspitze der Ostseite des Hafenbeckens und die offene Batterie Madonna (13 m) im Hintergrunde des Hafens. Die Batterien Magnaremi (165 m) und Perlitsch (253 m) zur Verteidigung der Bucht von Comisa, die Maxfeste zur Sperrung der Straße Comisa-Lissa; die Batterie Nadpostranje (170 m) zur Verteidigung des Hafens von Manego. Endlich waren noch an der Südostküste und auf dem 270 m hohen Rücken S. Cosmo-Andrea südlich des Hafens S. Giorgio 7 Geschützeinschnitte gemacht und mit Geschützen versehen worden. Alle diese Werke konnten jedoch modernen schweren Geschossen nicht lange widerstehen; auch waren die dem feindlichen Feuer ausgesetzten Böschungen bei dem Mangel an Erdreich nur mit Mauerwerk und Steinen verkleidet. Auf dem vorhin erwähnten Bergrücken, wie auf dem Monte Hum und dem Wellingtonturme waren optische Signalstationen errichtet; in telegraphischer Verbindung mit dem dalmatinischen Festlande stand Lissa durch ein Kabel, das über die Inseln Lesina und Brazza als Zwischenstationen gelegt war.
Wenn man nach dem Passieren des Leuchtturms und des Forts in die Bucht von Lissa einfährt, wird auf einer kleinen Halbinsel der stille Friedhof des Städtchens sichtbar, dessen Grabkreuze ein auf hohem Sockel liegender Löwe überragt: das Denkmal der gefallenen Helden von Lissa. Der Schauplatz des Sieges der horizontal rot-weiß-rot gestreiften kaiserlichen Kriegsflagge über die italienische Trikolore (senkrecht grün-weiß-rot gestreift) liegt im Nordwesten von Lissa, zwischen diesem und den Nachbareilanden Lesina und Solta; vorausging die zweitägige Beschießung der Inselfeste durch die italienische Flotte unter Persano. Die schwache österreichische Besatzung behauptete nicht nur das Eiland, sondern bereitete durch ihren wahrhaft heroischen Widerstand zugleich den Erfolg Tegetthoffs vor.
Es befanden sich auf Lissa 5 Komp. Marine-Infanterie, 2 Komp. Küsten-Artillerie, I Detach. Genietruppe und 1 Matrosendetachement, zusammen 1833 Mann, von denen nach Abzug der Geschützbedienungen nur 950 Streitbare für die Abwehr von Landungsversuchen blieben. In den fortisikatorisch recht schwachen Werken waren 88 Geschütze aufgestellt, durchweg glatte Kanonen, Haubitzen und Mörser; nur ein kleiner Teil eignete sich für einen Kampf mit neuzeitlichen Panzerschiffen. Allerdings lagen die Inselbefestigungen großenteils ziemlich hoch über dem Meeresspiegel, trotzdem aber waren die österr. Geschütze den italien. gegenüber durchaus unzulänglich an Zahl wie an Kaliber. Man hatte weder S. Giorgio noch die übrigen Hafen durch Seeminen, Barrikaden oder andere Hindernisse, welche die lokale Verteidigung selbstredend sehr erleichtert haben würden, verschlossen. Allzu aussichtsvoll konnte die Aufgabe, mit so geringen Mitteln Lissa gegen die furchtbaren Schiffskanonen der Italiener zu verteidigen, daher nicht erscheinen. Zum Glücke für die Sache der Kaiserlichen befand sich jedoch hier — ebenso wie bei der Flotte — der richtige Mann auf dem entscheidenden Posten: Insel- und Festungskommandant war Oberst Urs de Margina (ein Rumäne aus Siebenbürgen), der sich schon bei Solferino, wo ihm das Maria-Theresienkreuz zuteilwurde, als tapferer und entschlossener Führer bewährt hatte.
Er war willens, die ihm von seinem Kaiser anvertraute Inselfeste bis aufs äußerste zu halten, und wusste die Besatzung mit dem gleichen Geiste zu erfüllen, bestens hierin unterstützt von den ihm zugeteilten Offizieren: Geniemajor Hiltl, Hauptmann Klier vom Küsten-Art·-Regt. und dem Kommandanten der Infanteriebesatzung, Major Kratky vom Marine-Inf.-Regt.
Am Morgen des 18. signalisierte der optische Telegraph auf dem Humberge das Nahen der italienischen Flotte mit Kurs Nordwest, zuerst von 9, dann von 22 Schiffen. Gegen 9 Uhr ließ der Kommandant auf der Piazza S. Spirito im Orte Lissa als Alarmsignal 3 Kanonenschüsse abfeuern, alle Batterien zur Bereitschaft ausrufend. Ebenso rasch und ordnungsmäßig bezog die Marine-Infanterie die ihr im Voraus zugewiesenen Posten. Telegraphische Meldungen gingen sogleich ab an das Generalkommando in Zara auf dem Festlande, behufs Weitergabe an Admiral Tegetthoff, der die kaiserl. Schlachtflotte auf der Reede von Fasana, etwas nördlich Pola, versammelt hielt.
Die ersten Schüsse fielen auf der Westseite der Insel, zwischen den Batterien bei Comisa und den feindlichen Schiffen: der Kampf war nun eröffnet.
Ungeachtet aller Tapferkeit der kaiserl. Besatzung konnte sein schließlicher Ausgang kaum zweifelhaft sein, wenn Tegetthoff mit der Flotte nicht rechtzeitig zum Entsatze herbeikam. Auf die ihm zugegangene Drahtnachricht: „Comisa mit 12 Schiffen angegriffen“, stellte er telegraphisch an das Inselkommando das Ansuchen: „Bitte angeben, welche Gattung Schiffe, um zu entnehmen, ob Angriff auf Lissa Diversion oder ob das Gros der feindlichen Flotte dort engagiert ist.“ Gegen 2 Uhr nachm. traf dann die Meldung ein: „Hafen von Lissa angegriffen.“ und bald hernach: „Heißes Kanonengefecht bei Lissa ohne Schaden.“ Bevor wir jedoch die Vorgänge auf und bei Lissa am 18. und 19. Juli weiter schildern, haben wir zunächst den angreifenden Teil, die italienische Kriegsflotte, ins Auge zu fassen.
— — — — — — — — — — — — —
Sachverständige Beurteiler hielten es bei Ausbruch des Krieges für ziemlich wahrscheinlich, dass Erzherzog Albrecht mit seiner Südarmee den Italienern trotz ihrer numerischen Überlegenheit eine Schlappe beibringen werde, wenn man auch keinen so glänzenden Sieg wie den von Custoza vorhersehen konnte. Dagegen musste es nach aller menschlichen Berechnung wohl als ausgeschlossen erscheinen, dass die österreichische Flotte der italienischen mit Erfolg entgegen zu treten vermöchte, so groß waren die Unterschiede nach Schiffszahl und Ausrüstung. Die italienische Flotte war 1860 durch Vereinigung der sardischen und neapolitanischen Kriegsmarine entstanden und zählte zunächst 82 Fahrzeuge. Cavour bot alles zu ihrer Vergrößerung auf, damit Italien über eine Flotte verfüge, die imstande sei, die Herrschaft auf der Adria zu erringen. Von 1861-66 wuchs die Seemacht des jungen Königreiches um 31 Schiffe, wofür die Regierung gegen 200 Millionen Franken aufwendete, die bei dem kläglichen Stand der Finanzen größtenteils von Frankreich entlehnt werden mussten. Die neuen Panzerschiffe wurden unter dem Einfluss der von Nordamerika ausgegangenen Umwälzung mit Benützung der jüngsten Erfindungen gebaut und mit Geschützen modernster Gattung4 ausgerüstet; im eigenen Lande ließ sich nur ein geringer Teil davon herstellen, deswegen wurden die namhaftesten französischen, nordamerikanischen und englischen Schiffswerften und Geschützgießereien mit Aufträgen bedacht. Unverkennbar blieb jedoch gegen den Eifer für Vergrößerung und Verbesserung des Materials die Sorgfalt für gediegene Ausbildung des Flottenpersonals nicht unerheblich zurück.
Als sich mit Beginn des Jahres 1866 die Anzeichen des Kriegsausbruches vermehrten, besaß Italien eine seinem voraussichtlichen Gegner Österreich bedeutend überlegene Schlachtflotte von 140 Kriegsschiffen (eingerechnet 16 noch im Bau begriffene) mit 11 321 Kanonen, 30 210 Pferdekraft und 187 077 Tonnengehalt, deren Bemannung 23 842 Köpfe stark war. Nach den Erfahrungen im Sezessionskriege kamen schon damals als eigentliche Schlachtschiffe nur noch Panzer in Betracht, deren die Flotte 12 besaß, während 12 andere noch (größtenteils auf inländischen Werften) im Bau begriffen, jedoch der Vollendung nahe waren.
Am 3. Mai 1866 ordnete König Viktor Emanuel die Zusammenstellung einer Operationsflotte in der Adria von 3 Geschwadern (Schlacht-, Hilfs- und Belagerungsgeschwader) an, bestehend aus 31 seiner besten Schiffe. Zugleich ergingen Befehle zur Ausrüstung noch weiterer Fahrzeuge, um jene Flotte auf den Stand von 38 Kriegsschiffen zu bringen. Ein Teil der Schiffe lag im Hafen von Ancona, der ‚Ellbogenstadt‘ — so benannt von den Syrakusanern, die sie auf jenem Punkte der adriatischen Westküste angelegt hatten, wo diese aus nordnordwestlicher in die westnordwestliche Richtung umbiegt. Den übrigen, in inländischen Hafen befindlichen oder von auswärts kommenden Fahrzeugen ward als Sammelplatz bezeichnet der süditalienische Hafen von Tarent (in der nördlichsten Ecke des gleichnamigen Golfes).
Zum Oberbefehlshaber ernannte der König den Admiral Carlo Conte Pellion de Persano, der, einer altpiemontesischen Familie entsprossen, am 11. März 1806 zu Vercelli geboren und 1824 in die sardinische Marine eingetreten war. Als Konteradmiral hatte er Garibaldi wesentliche Dienste geleistet bei seinem Angriff auf Sizilien und Neapel und bei der Eroberung von Ancona und Gaäta mitgewirkt. Im Herbst 1860 zum Vizeadmiral befördert, war er von März bis Dezember 1862 Marineminister unter Ratazzi. Bezeichnend für Persano ist, dass er beim Rücktritt dieses kurzlebigen Ministeriums kein Bedenken trug, sich selbst wenige Tage vor der Amtsniederlegung zum Admiral zu ernennen. 1865 trat er kraft königl. Dekrets in den Senat ein, wurde also lebenslängliches Mitglied der Ersten Kammer des ital. Parlaments. Seine Brust schmückten die höchsten Orden seines Königs und anderer Fürsten, und man betrachtete es in Italien als selbstverständlich, dass der für einen Seehelden ersten Ranges geltende Persano, der sich unbestreitbare Verdienste um die Organisation der Flotte erworben hatte, diese auch im Kriege befehligen würde. Es gab freilich Fachmänner, die eine weniger günstige Meinung über ihn hegten, allein sie dienten unter ihm und waren daher nicht in der Lage, jener Volksstimmung öffentlich entgegenzutreten.5
Persano traf am 16. Mai in Ancona ein, übernahm das Flottenkommando und hisste seine Flagge an Bord der Panzerfregatte „Re d’Italia“. Bereits am 10. Juni — noch vor der Kriegserklärung — erhielt er vom Marineminister, General Angioletti, Verhaltungsmaßregeln für die Eröffnung der Feindseligkeiten zur See, deren erster und wichtigste: Punkt lautete: „Das Adriatische Meer ist von feindlichen Schiffen zu säubern; sie sind anzugreifen und zu blockieren, wo immer sie sich befinden mögen.“
Durch Tagesbefehl vom 15. Juni erteilte der Admiral den ihm unterstellten Schiffen allgemeine Vorschriften, aus denen folgendes hervorzuheben ist:
Wenn die gesamte Flotte vereint fahren und in Aktion treten soll, wird sie in die Flotte der Panzerschiffe und jene der ungepanzerten Schiffe eingeteilt sein. Jede Flotte wird in Gruppen geteilt.





























